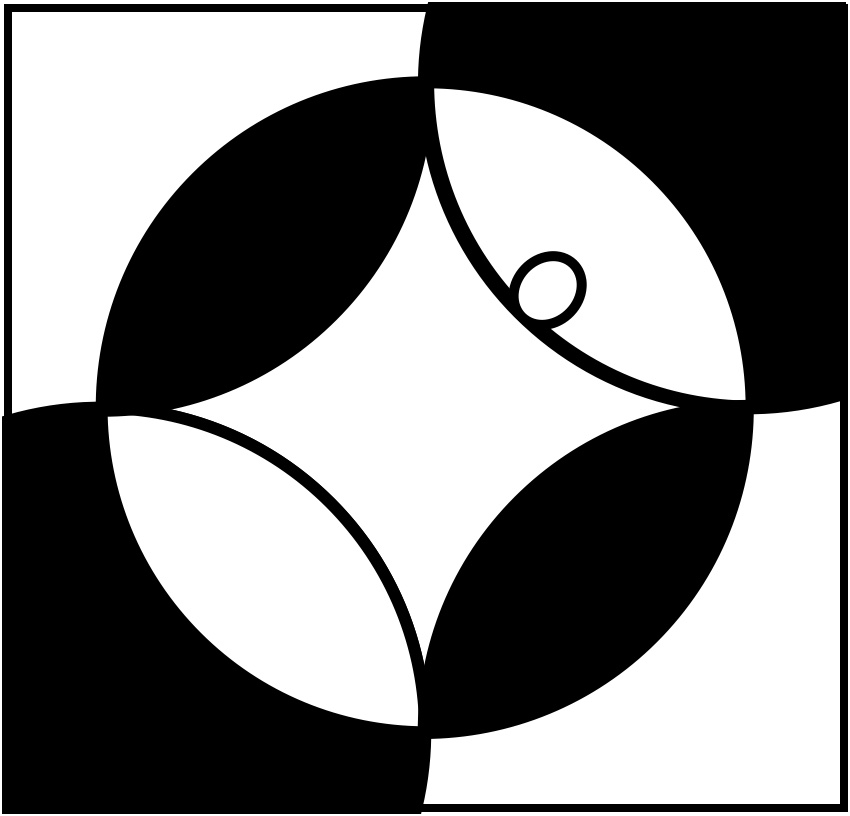Sven Bergmann: „Die Tochter” bei Rosenstock-Huessy
Fast sein ganzes Leben hat sich Eugen Rosenstock-Huessy mit der Tochter beschäftigt. Schon seine eigenen Schwestern kamen ihm irgendwie merkwürdig vor und der Schüler konnte bereits in Homers Ilias verfolgen, welch gewaltige politische Folgen der Raub einer Tochter zeitigen konnte. In seinem rechtsgeschichtlichen Studium war die korrekte Zuordnung von Schwertmagen oder Kunkelmagen, also der Verwandschaftsverhältnisse väterlicher- oder mütterlicherseits grundlegend. Es gibt außer ihm keinen anderen Juristen, Historiker oder Soziologen, dessen gesamtes veröffentlichtes Werk der Rolle der Tochter in Geschichte und Gesellschaft nachspürt, angefangen mit dem gleichnamigen Kapitel seiner ersten nichtwissenschaftlichen Schrift „Die Hochzeit des Kriegs und der Revolution“ bis zum letzten Kapitel seiner Soziologie: „Antiope oder die Binität“. Der Kulturwissenschaftler Klaus Theweleit (Buch der Königstöchter. Von Göttermännern und Menschenfrauen. Mythenbildung vorhomerisch, amerikanisch, Berlin: Matthes & Seitz 2020) veröffentlichte seine ersten Studien rund fünfzig Jahre später und in der Geschichtswissenschaft ist das Thema erst jüngst prominent präsentiert worden: Michael Borgolte, Königin in der Fremde. Frühmittelalterliche Heiratsmigration und die Anfänge der europäischen Bündnispolitik, Göttingen: Wallstein Verlag 2024.
Vater, Mutter, Sohn und Tochter sind für Eugen Rosenstock-Huessy die großen Namen, die sich dem Menschen mit den Stämmen eingebrannt haben. Wie kein anderer Ägyptologe konnte er mit dieser Einsicht den Extremfall der Pharaonendynastie deuten, die in den Inzest flüchtete, um sich nicht auf eine Ebene mit normal Sterblichen zu begeben. Das Thema der Tochter war dem Autor so bedeutsam, daß er seinen Freund Bas Leenman bat, das Kapitel von 1920 nach seinem Tod „in einem schönen, weißen Bändchen“ erneut zu veröffentlichen (Eugen Rosenstock-Huessy, Die Tochter. Das Buch Rut, verdeutscht von Martin Buber, hrsg.v. Bas Leenman, Mössingen-Thalheim: Talheimer Verlag 1988.).
Heute ist das Thema der Tochter, der politischen Stimme der ehemals stimmlosen Tochter allgegenwärtig. Man mag nur an die „Me too“ Bewegung denken, an den Widerspruch in der katholischen Kirche oder den Protest von Töchtern gegen patriarchal-autoritäre Regime und ihre überlebten Rituale. Man wird Eugen Rosenstock-Huessy zugute halten müssen, daß er diese Tendenz schon vor einhundert Jahren erkannt und benannt hat. Daneben sehen manche Heroen von einst schrecklich alt aus: „Da die „Moderne“ nichts vom Ritus hielt – diese Moderne, die einem heut bereits total veraltet vorkommt – so leugnete sie, daß Blasphemie möglich sei. Und da die Moderne ja nicht an ihre Tochter zu denken brauchte, weil sie entweder gar nicht erst empfing oder die Frucht abtrieb, so brauchte sie nicht zu gewärtigen, daß die eigene Tochter von dem abtrünnigen Geistlichen so geschändet werden könnte.“ (Eugen Rosenstock-Huessy, Im Prägstock eines Menschenschlags oder der tägliche Ursprung der Sprache, in: ders., Die Sprache des Menschengeschlechts. Eine leibhaftige Grammatik in vier Teilen, 2. Bd., Heidelberg: Verlag Lambert Schneider 1964, S.521f.)
Deshalb: Zeit ist’s für die Tochter
aus dem Mitteilungen 2025-08