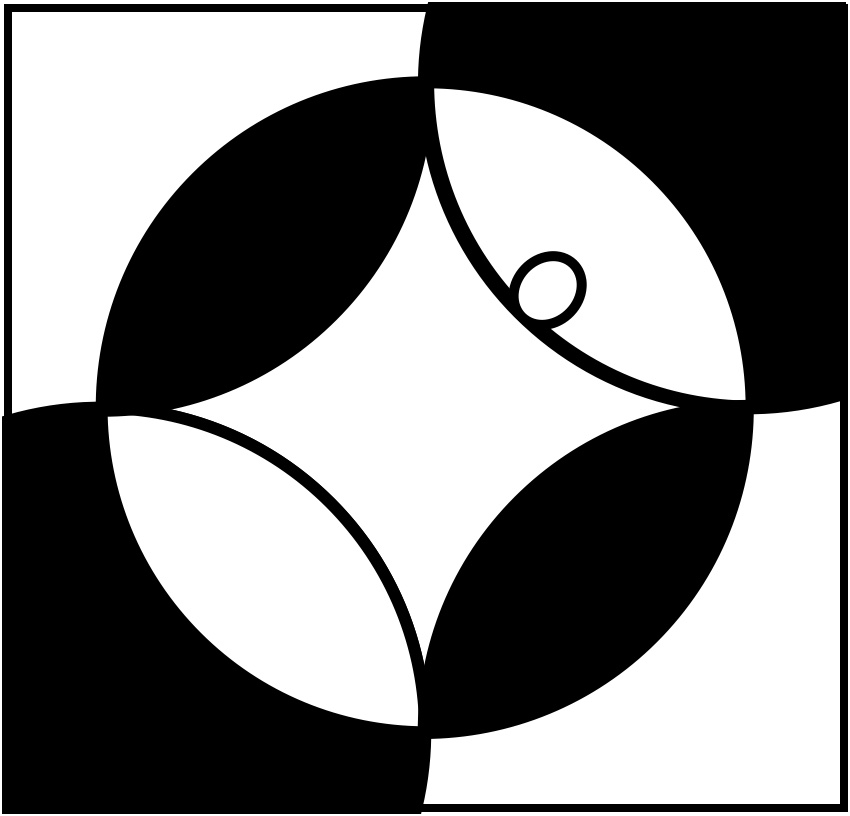Mitteilungen 2024-12
Eugen Rosenstock-Huessy Gesellschaft e.V.
„Ökonomien können ihre Zwecke auf verschiedenen Wegen erreichen. Die ideale Ökonomie ist vielförmig. Die Ko-Existenz Englands, Rußlands, der USA, Deutschlands und all der anderen Länder ist doch genügender Erweis, daß Ökonomie verschiedentlich wird zu fungieren haben. Zutaten kapitalistischer, sozialistischer, feudaler, kommunistischer, mönchischer, väterlicher, merkantilistischer Vorgehensweisen treten in die gesunde Ökonomie ein, sowohl die Züge der Familien-Ökonomie, eines Typs ganz für sich. Flotte, Familie, Konvent, Krankenhaus, ein Künstler, eine Fabrik stellen diese Verschiedenartigkeit der Wirtschaften deutlich genug dar. Ein Land, das ohne Familie, Kloster, Studio, Eremit, Lager, Hafen, nur von Fabriken und Schulen leben wollte, wäre ein Ungeheuer.
Kinder in einem Heim leben in einer Wachstumsökonomie: sie empfangen mehr als sie geben, und doch geben sie trotzdem in einem beträchtlichen Ausmaß. Vielleicht in einer Fabrik wird von uns erwartet, mehr zu geben als wir empfangen, gewöhnlich wird sie aber so nicht wirksam. Auf jeden Fall ists da eine Ökonomie des Herausbringens, nicht des Wachstums. Ein Kloster ist ein Haushalt der Intensivierung. Ein künstlerischer Genius braucht zu allen Zeiten einen Patron, das heißt er ist und bleibt ein ökonomisch Ausgestoßener. Machen seine Werke Geld, ist er wahrscheinlich kein Genius. Das gilt wenigstens in der Wissenschaft. (Als Heinrich Hertz, der Entdecker der Wellentheorie, an eine große Universität gerufen wurde, schüttelte er traurig den Kopf: Nun rufen sie mich und zahlen mir ein großes Gehalt und jetzt bin ich ein erloschener Vulkan.) Eine Flotte ist das Lieblingskind der ganzen Nation. Nun spezialisieren sich Nationen auf einen besonderen ökonomischen Zug und sollten darin fortfahren.
Daß jemand versuchen will, diese widersprüchlichen Ökonomien der verschiedenen Stufen, Phasen und Beschäftigungen auf die Zwangsjacke eines reinen Kapitalismus, reinen Kommunismus oder irgendeines Reinen zu reduzieren, hat mich mein ganzes Leben lang ein Geheimnis gedünkt. Offenbar ist die irdische Existenz des Menschen nicht rein, sondern unrein, Ökonomien sind unrein, Rassen sind unrein, Gesellschaft ist unrein; und desto besser sind sie, je gemischter sie sind. Ich gebe zu, gewisse Mischungen scheitern. Aber diese werden aus bloßer Augenblickslaune heraus, ohne Eifer und Enthusiasmus getan. Ich bin da kein Äxteschleifer, den Grad der Mischung oder Beimischung in Wirtschaften betreffend. Aber deren Zulassung als das Prinzip unserer materiellen Existenz – und was sonst ist Wirtschaft? – ist das Sine qua non eines Weltfriedens. Das ist die eine wichtige Entdeckung: auch ein Weltfrieden hat eine Minimum-Bedingung.” Eugen Rosenstock-Huessy, Mad economics or Polyglott Peace (1944), stimmstein 4, p.93ff (1993)
Vorstand/board/bestuur: Dr. Jürgen Müller (Vorsitzender);
Sven Bergmann; Thomas Dreessen; Dr. Otto Kroesen
Antwortadresse: Jürgen Müller, Vermeerstraat 17, 5691 ED Son, Niederlande,
Tel: 0(031) 499 32 40 59
Mitteilungen Dezember 2024
Inhalt
- Einleitung - Jürgen Müller
- Matthäus und Lukas im Zwiegespräch - Otto Kroesen
- Nachruf: Edzard Reuter - Thomas Dreessen
- Geleitwort zur Reprint-Ausgabe der Daimler Werkszeitung 1919/20 - Reuter/Gentz
- Was bewegt die Ukrainer? - Otto Kroesen
- Peter Sloterdijk: Der Kontinent ohne Eigenschaften - Sven Bergmann
- Wir brechen noch einmal auf - Claus Friese
- Verrückte Ökonomie oder vielsprachiger Frieden - Thomas Dreessen
- Vormerken der Jahrestagung 17.10. – 19.10.2025 - Jürgen Müller
- Adressenänderungen - Thomas Dreessen
- Hinweis zum Postversand - Thomas Dreessen
1. Einleitung
Liebe Mitglieder und Freunde,
Angesichts der sich verstärkenden politischen Spannungen antworten Regierungen mit Initiativen der De-Globalisierung. Abhängigkeiten werden neu strukturiert. Wir sollten uns in diesem Zusammenhang eine Einsicht Rosenstock-Huessys in Erinnerung rufen: »Der technische Fortschritt erweitert den Raum.« Die Beziehungen der Menschen verflechten sich immer vielfältiger und über immer weitere Räume hinweg. Die einzelnen Menschen geraten in immer größere Abhängigkeit von Faktoren, die sie nicht selbst beherrschen. Zunächst dachte man nur so, daß das, was im Haushalt verloren ginge, der Nationalökonomie zugeschanzt würde. Die Frage ist aber, ob sich das wirkliche Leben tatsächlich in der Hauptsache zwischen Familie und Nation abspielt. Denn der technische Fortschritt zerschlägt ja auch die Einheit des nationalen Raumes. Die Staatsgrenzen haben mit den Wirtschaftsgrenzen überhaupt nichts zu tun. Durch den technischen Fortschritt wurde eine Bewegung ausgelöst, die vom Haus in die Welt hinein, nicht aber vom Haus in die Provinz oder in den Staat hinein geht. Daher war auch die nationale Wirtschaftsautarkie vom technischen Fortschritt her gesehen eine unsinnige Illusion. (in Friedensbedingungen der planetarischen Gesellschaft, 2001, S.104). In dieser Perspektive sehen wir also keinen Aufbau einer Autarkie sondern eine Korrektur und Diversifizierung extremer Abhängigkeiten. Auch bei Konzepten, wie eine realistische Wirtschaftsstruktur aussehen soll, plädiert Rosenstock-Huessy gegen Reinheit und für Vielfalt. Daß diese Vielfalt nicht nur vereinzelt, sondern strukturell vorhanden sein soll, bezeichnet Rosenstock-Huessy sogar als Vorbedingung für einen Weltfrieden.
Otto Kroesen berichtet von zweimal zwei Stimmen. Haben die Ukrainer eine Stimme? so fragt er und hört auf zwei von ihnen. In der Geschichte ihres Volk-werdens entdeckt Otto Parallelen zu der der Niederländer. Außerdem fällt sein Blick auf die Bibel in der von zwei verschiedenen Stammbäumen von Jesus geschrieben wird. Wie kann das sein? Eine Antwort findet Otto im Briefwechsel der beiden Autoren.
Dankbar gedenken wir Edzard Reuter und drucken das Geleitwort zur Reprint-Ausgabe der Daimler Werkszeitung 1919/20 hier nochmals ab.
Noch ein weiteres: In seinem neusten Buch: Der Kontinent ohne Eigenschaften: Lesezeichen im Buch Europa widmet sich Peter Sloterdijk unter dem Titel: Out of Revolution: Wie ein deutscher Historiker den Europäern ihre Autobiographie schreibt in einem ganzen Kapitel Eugen Rosenstock-Huessys großem amerikanischen Werk.
Jürgen Müller
2. Matthäus und Lukas im Zwiegespräch
Einleitung
Wo kommt Jesus Christus her? Nur Lukas und Matthäus haben eine Geburtserzählung. Markus überspringt das. Markus beginnt mit Johannes dem Täufer und der Taufe Jesu, und dann, als Jesus aus dem Wasser steigt, wird er sofort von Gott adoptiert, so wie nach römischem Brauch die Kaiser ihren gewünschten Nachfolger als Sohn adoptierten. Der Geist kommt wie eine Taube auf ihn herab, und er hört eine Stimme: „Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden“ 1. So wie die Genealogie der Pharaonen und der römischen Kaiser angesichts dieser Adoptionspraxis nicht von großer Bedeutung ist, so ist bei Markus auch keine Geburtsgeschichte vonnöten, um Jesus als Gottes Sohn „auf den Schild zu heben“. Dies ist ein ganz anderer Ansatz.
Matthäus und Lukas können es so nicht angehen. Sie müssen beide begründen, warum mit Jesus Christus ein ganz neuer Zeitabschnitt in der Geschichte anbricht. Die Genealogie ist also keine gewöhnliche Genealogie, sondern begründet, warum diese neue Zeit anbricht. Aber Matthäus und Lukas brauchten diese Geburtserzählungen jeweils auf andere Weise. Wahrscheinlich waren sie mit der Arbeit des jeweils anderen nicht sehr zufrieden. Sie haben gegensätzliche Schwerpunkte und betonen daher andere Aspekte.
Kenner von Rosenstock-Huessy wissen, dass für ihn die Evangelien, die Geburt und das Ereignis der Ankunft Jesu Christi eine zentrale Rolle in seiner Interpretation der gesamten Gesellschaftsgeschichte von den Stämmen bis zur Gegenwart spielen. Hier folge ich seinem Ansatz. Dabei verspreche ich dem Leser, dass ich später nochmals darauf zurückkommen werde. Man kann sich als Theologe (und ein bisschen bin ich das immer noch), Rosenstock-Huessys Interpretation nicht anschließen, ohne ihre Glaubwürdigkeit im Lichte gängiger biblischer Interpretationen zu prüfen.
Matthäus ist der Zöllner Levi, der nach seinem eigenen Evangelium von Jesus zum Jünger berufen wurde (Matthäus 9, 9-13). Er ist also einer der Zwölf. Nach der Überlieferung schrieb er sein Evangelium auf Aramäisch, vielleicht sogar auf Hebräisch. Später wurde es dann übersetzt. Nach Rosenstock-Huessy schrieb er das Evangelium während der Verfolgung der christlichen Gemeinden, nach der Steinigung des Stephanus. Viele flohen daraufhin nach Syrien, Damaskus, Galiläa und jene Regionen. Paulus verfolgte die Kirche bis nach Damaskus. Matthäus gehört also auch zu der ersten Periode, in der die Apostel über die Auslegung des Alten Testaments im Licht der Verkündigung, Kreuzigung und Auferstehung Jesu Christi nachdachten. Seine Haltung ist laut Rosenstock-Huessy eine des Protests: Der Gerechte wird von den jüdischen Führern abgelehnt. Das macht sie zu Heuchlern. Sie töteten ausgerechnet den besonders Gerechten im Namen des Gesetzes. Außerdem weiß Matthäus als Steuereintreiber aus eigener Erfahrung, was es heißt, ausgeschlossen zu sein.
Lukas schloss sich als griechischer Arzt der Gemeinde in Jerusalem an, reiste später mit Paulus und Barnabas nach Antiochia und begleitete Paulus von dort aus immer wieder auf seinen Missionsreisen, bis hin zu seinem Aufenthalt in Rom. Lukas denkt in Generationen. Er schreibt sein Evangelium an Theophilus, also die Generation nach ihm. Und er schreibt auch die Apostelgeschichte, die erste Generation von Nachfolgern und über Paulus, der eigentlich schon zur zweiten Generation gehört. In seiner Auslegung hat er die griechisch sprechenden, neu gewonnenen Gläubigen als Leser im Blick, aber auch die Juden, denn die jüdische Inspiration, die sich nun von der Gesetzlichkeit Jerusalems befreit hat, gründet im ganzen Römischen Reich eine neue (christliche) Gemeinschaft, die eine Alternative sowohl zur jüdischen Revolte als auch zum Römischen Reich darstellt. Soviel zu diesem Hintergrund.
Ich habe oft festgestellt, dass selbst nachdenkende Kirchenmitglieder, die die biblischen Geschichten kennen, keine Ahnung von der Aufteilung der Themen der Geburtserzählungen zwischen Lukas und Matthäus haben. Ob die Hirten zu Lukas oder zu Matthäus gehören, wissen die meisten nicht und es ist ihnen auch egal. Deshalb hier auch die folgende Übersicht:
| Matthäus | Lukas |
|---|---|
|
|
Wir stellen uns vor, dass Matthäus und Lukas über ihre unterschiedliche Herangehensweise miteinander korrespondiert haben könnten. In dieser Vorstellung könnten sie auf die folgende Weise korrespondiert haben. Sie schrieben sich gegenseitig Briefe. Stellen Sie sich vor, diese wären in meinen Besitz gelangt, und ich zitiere hier kurz die wichtigsten Passagen.
Korrespondenz
Lukas: In den Gemeinden, die Paulus und ich in Kleinasien, Griechenland und an anderen Orten gegründet haben, auch in der Gemeinde in Rom, können die Leute mit deinem Evangelium nichts anfangen. Ich sollte natürlich nicht übertreiben. Wir kommen damit zurecht, denn es ist das einzige, was wir haben. Sonntag für Sonntag lesen wir daraus, wie Du es vorgesehen hast, parallel zu den Lesungen nach dem synagogalen Schema. Von der Synagoge kommend, erhalten die Gemeindemitglieder dann einen christlichen Kommentar zum alttestamentlichen Text. Das hast Du Dir übrigens schlau ausgedacht! Man liest Deine Geschlechtsregister im ersten Kapitel Deines Evangeliums parallel zu den Geschichten von Abraham und Sara aus der Genesis, die keine Kinder bekommen konnten. Du kannst also mit dem Geschlechtsregister von Abraham bis Jesus Christus beginnen. Die Geschichte von den Weisen liest Du parallel zu der Geschichte von Jakob und Esau, die sich wiedersehen, als Jakob von Laban zurückkehrt. Und so wie Jakob nach der Begegnung mit Esau fliehen musste, müssen auch die Weisen auf dem Rückweg König Herodes ausweichen. Sehr schön, weil es so auf das synagogale Schema abgestimmt ist! Und doch gibt es in diesen Geschichten alles Mögliche, das wir in Rom nicht bringen können. Aber lass mich damit anfangen: Warum hast Du das überhaupt getan - die Geburtsgeschichten zu schreiben? Was weisst Du über die Geschehnisse in der Kindheit von Jesus? Wurdest Du nicht erst berufen, als Du ein Zöllner warst, der von Jesus zum Jünger gemacht wurde? Warum also?
Matthäus: Warum soll ich nichts darüber wissen können? Versuch doch mal, wie ein Rabbi zu denken. Dann wirst Du mich vielleicht auch verstehen. Die Rabbiner wissen zum Beispiel, von welchem Baum Eva im Paradies gegessen hat. Das steht nicht in der Schrift. Trotzdem wissen sie es. Es war ein Feigenbaum. Ein Feigenbaum hat viele Blätter, und auch Adam und Eva bedeckten sich aus Scham mit Feigenblättern, als Gott sie rief. Ein Feigenbaum kann trügerisch sein. Er kann viele Blätter haben, und dann denkt man, dass er Früchte tragen wird. Und schaut man dann unter die Blätter, dann ist nichts da. Deshalb. Verstehst Du das? Nun, genauso geschah es mit dem Kind Jesus, wie ich es Dir gesagt habe. Israel befindet sich in einer Sackgasse. Das ist schon einmal geschehen. Ich zeige das auch in diesen Perioden von dreimal vierzehn Namen. Jedes Mal muss Gott einen neuen Anfang machen. Jedes Mal ist eine neue Inspiration nötig. Der Sohn Davids wird in Bethlehem geboren. Der heidnische König Herodes, der von den Edomitern abstammt, will ihn töten. Du weisst, dass unter uns Rabbinern (ich weiß nicht, ob ich inzwischen selbst einer bin) Edom mit dem Römischen Reich gleichgesetzt wird. Joseph und Maria müssen nach Ägypten fliehen, weil Joseph das im Traum gesehen hat - so war es auch bei einem früheren Joseph. Er träumte und sah voraus, dass seine Brüder sich vor seinem Stern beugen mussten 2. Genauso müssen sich die Könige von überall her vor dem Christuskind im Stall verbeugen. Siehst Du? All das ist in der Heiligen Schrift vorhergesagt. Wie kann ich davon nichts wissen? Das ist der wahre Ursprung von Jesus.
Lukas: Das ist schön, aber Du drückst es zu stark aus. Du sagst auch, dass bei Herodes ganz Jerusalem erschrocken war, als die Weisen kamen, um den neuen König zu suchen. Du stellst also das Königreich Israel unter Herodes als eine ägyptische Diktatur dar, die vom Volk in Jerusalem unterstützt wird 3. Joseph musste mit seiner Familie nach Ägypten fliehen, weil es dort besser war. Nun, so kann ich nicht weitermachen. Verstehst Du nicht, warum? Das führt nur zu Streit mit den Juden. Du suchst zu viel den Konflikt. Und die Christen aus den Heiden haben von dieser Kritik an Israel überhaupt nichts, weil sie in einen Konflikt hineingezogen werden, der nicht der ihre ist.
Matthäus: Warum ein Konflikt, an dem sie keinen Anteil haben? Herodes und die Weisen und der Stern - das ist doch auch alles ägyptische Mythologie, die von den römischen Kaisern übernommen wurde, wie ihr wisst. Auch sie gehorchen dem Rhythmus der Sterne, dem landwirtschaftlichen Kalender, und die Magier können aufgrund der Stellung der Sterne Vorhersagen machen, so wie sie in Ägypten den Anstieg des Nils vorhersagen konnten. Dies verleiht auch der hierarchischen Herrschaft der Römer einen religiösen Anstrich. Und da Herodes aus Edom stammte, was nach Ansicht von uns Rabbinern für das Römische Reich steht, muss all dies doch auch die Christen aus den Nichtjudenländern ansprechen?
Lukas: In der Tat, das stimmt. Darüber muss ich nachdenken. Denn natürlich kennen sie Herodes nicht. Vielleicht sollte ich etwas mit dem Kaiser machen. - Du merkst, dass ich darüber nachdenke, dein Werk selbst wieder aufzunehmen und ein Evangelium zu schreiben. Denn obwohl wir dein Evangelium in unseren Gottesdiensten verwenden, muss ich zu viel erklären und alles ein bisschen anders darstellen, weil der Kontext ein anderer ist. Deshalb sollte ich vielleicht etwas über den römischen Kaiser und die Volkszählung unter Quirinius sagen. Das war zwar erst zehn Jahre später, aber Du verstehst, wegen der Symbolik. Der Kaiser spricht und ihr müsst einfach gehen.
Matthäus: Aber Herodes ist ein wesentlicher Teil der Geschichte. Er steht für den Kompromiss der jüdischen Führer mit der römischen Macht. Das führt zum Kindermord an den Kindern in Bethlehem. Und in der Tat erinnert das an den Kindermord in Ägypten, an den Befehl des Pharaos, alle neugeborenen Kinder in den Nil zu werfen, als das Volk Israel in Ägypten war. So sieht es heute in Israel aus, dank dieses Kompromisses mit der römischen Macht. Deshalb war ich froh, dass Joseph der Name des Vaters von Jesus ist, das konnte ich gut gebrauchen. Joseph träumt in der alttestamentlichen Geschichte alles Mögliche, auch unser Joseph bekommt Träume. Die Weisen, sie waren die Vorhersager von Ereignissen aus der Position der Sterne. Wieder eine Parallele zu Joseph: Hier kommt der echte Stern. Dieser Stern geht vor den Weisen her, so wie die Wolkensäule vor dem Volk Israel auf seiner Reise durch die Wüste herging.
Lukas: So verstehe ich es besser, danke. Aber nimm die Tatsache, dass ganz Jerusalem zusammen mit Herodes erschrocken ist, als die Weisen kommen, um zu fragen, wo der König geboren wurde - damit verärgerst Du wiederum die Juden, nicht wahr? Weisst Du, wie viel Mühe wir uns geben mussten, um den Aposteln in Jerusalem klarzumachen, dass die Heiden nicht beschnitten werden sollen und auch nicht Juden werden sollen, um überhaupt teilnehmen zu können? Die Juden aus Jerusalem sind immer noch hinter uns her, weil sie meinen, dass dies eigentlich nötig wäre. Du hast es in deinem Evangelium viel zu weit getrieben, indem Du die jüdischen Führer mit ägyptischen Pharaonen gleichgesetzt hast!
Matthäus: Aber so war es auch. Doch wenn Du selbst etwas schreiben willst, dann schreib doch zuerst die Geschichte der Verfolgung auf, die nach der Steinigung des Stephanus stattfand. Die Situation war so bedrohlich, dass nur die Apostel es wagten, in Jerusalem zurückzubleiben 4. Sie hatten das Gefühl, dass sie weiterhin im Tempel auftreten mussten, um Besucher für die neue Sache zu gewinnen. Dein eigener Freund Paulus, damals Saulus, spielte eine wichtige Rolle bei der Verfolgung. Ich halte es für ein großes Risiko, dass spätere Historiker die Ernsthaftigkeit dieser Verfolgungen anzweifeln werden. Du wirst nicht viel davon aufgezeichnet finden. Also, schreib darüber! Gewöhnliche Kirchenmitglieder mussten nach Galiläa und Syrien fliehen. Christus ist uns dorthin vorausgegangen, sagte ich in meinem Evangelium, um uns zu ermutigen! Offensichtlich, denn wo der Druck ist, da ist er auch.
Lukas: Damals war es so, gut, dass Du mich daran erinnerst. Aber später haben Paulus und ich und andere auch viele Heiden mitgebracht, und die sollen das auch verstehen können, und man soll sie nicht mit allerlei Widersprüchen belästigen, die für sie nicht mehr relevant sind. Außerdem müssen wir mit den Juden zurechtkommen. Das hat nicht nur strategische Gründe, sondern knüpft an deinen Stammbaum und die Rede des Stephanus an: Es geht darum, eine Epoche in eine andere zu übertragen. Die Inspiration Israels muss auf die Christen aus dem Heidentum übertragen werden. Manchmal ist das so etwas wie eine Spaltung ohne Übertragung. Ich werde in meiner Version der Geschichte an die Patriarchen anknüpfen, denke ich. Das ist die Frühzeit Israels, oft noch ohne die Institution der Beschneidung und mit einem hebräischen Volk aus Sklaven und anderen Randgruppen. Diese Patriarchen waren Hirten, oder? Heute sind die Hirten nicht so beliebt. Sie sind arm, stehlen und lassen ihre Schafe auf dem Land anderer Leute laufen. Immer wieder findet Gott in den Verlorenen und Ausgestoßenen einen Anknüpfungspunkt. Sie sind ein Heer von Engeln, die die Ankunft des neuen Königs begrüßen. Wunderschön, findest Du nicht?!
Matthäus: Tut mir leid, zu dieser Art von Humor bin ich nicht fähig. Erinnere dich: Der Gerechte wurde hinausgeworfen und zum Sündenbock gemacht. Der Sohn Davids wurde von den Kindern Israels verworfen. Er hat dem Gesetz Substanz verliehen, und ohne ihn wäre das Gesetz nur eine förmliche Sache, Formalismus. Ich muss also das Gesetz gegen diese Machthaber in Stellung bringen, das wahre Gesetz, das sich im Glauben an Christus zeigt. Deshalb habe ich mich in meinem Evangelium rabbinisch verhalten: Poesie, Rhythmus, Sprichwörter, dreifache Sequenzen, um einen Punkt zu machen, alles von den Rabbinern abgeschaut. Hier, in Jesus, möchte ich sagen, findet die ganze rabbinische Tradition ihre Erfüllung und Inkarnation.
Lukas: Da haben wir es wieder, das Gesetz. Du machst das viel zu streng! Nicht ein Jota willst Du das Gesetz abschaffen 5. Jesus ist nur für die Juden da, die verlorenen Kinder Israels, sagst Du. Du bist zu sehr in deinem Streit festgefahren. Du willst mit dem Kind auch das Badewasser retten. Dabei ertränkst Du aber das Kind im Badewasser.
Matthäus: Paulus hat nicht ganz Unrecht. Er setzt den Geist des Gesetzes gegen den Formalismus des Gesetzes ein. Der Formalismus des Gesetzes macht tot und der Geist macht lebendig. Aber schüttet er damit nicht wiederum das Kind mit dem Bade aus? Ich muss erst noch sehen, was für ein undiszipliniertes Durcheinander das mit den Christen aus den Heiden wird. Wie dem auch sei, hier in Palästina ist das einfach nicht aktuell. Israel beginnt mit Abraham. Ich habe mich bemüht, verschiedene Perioden im genealogischen Register aufzuzeigen, genau wie Stephanus in seiner berühmten Rede: eine Phase vor dem Königtum, eine Phase mit den Königen und eine dritte Phase nach dem Exil. Jedes Mal leben wir in einer neuen Dispensation, in einer neuen Ära. In ähnlicher Weise müssen wir nach Jesus das Gesetz mit den Augen des verworfenen Gerechten lesen. Auch das ist eine neue Ära. So sehe ich das.
Lukas: Diese dreimal vierzehn Generationen, das ist ein guter Anfang. Das zeigt, dass eine Genealogie nicht statisch ist. Jedes Mal im Laufe der Zeit müssen sich die Dinge ändern, das ist gut. Übrigens, weisst Du, dass Du einen vergessen hast und dass Deine letzte Reihe, die nach dem Exil, nur dreizehn Namen hat? Eine Kleinigkeit, wohlgemerkt. Aber im Ernst: Du gehst nicht weit genug zurück. Auf diese Weise bist Du nicht umfassend genug. Wenn ich etwas schreibe, dann gehe ich in meiner Version bis zu Adam zurück. Ich habe etwas in meinem Kopf mit sechs Reihen von sieben Geschlechtern. Dann beginnt die nächste Siebenreihe mit Jesus. Und damit schließt sich der Kreis: von Adam zum neuen Adam. Das ist umfassender und lässt Platz für eine neue und letzte Siebenreihe, die mit Jesus Christus beginnt.
Matthäus: Zu welchem Preis macht man das so? Wenn man das Gesetz und insbesondere die Beschneidung weglässt, verliert man die Kontinuität. Wenn wir das Gesetz mit dem messianischen Blick des gekreuzigten Gerechten lesen, ist das ein gewaltiger Bruch, oder? Erinnern wir uns daran, dass die versprengten Anhänger Jesu Christi nach dem Mord an Stephanus eine harte Zeit hatten. Inzwischen haben sich diese Verfolgungen etwas beruhigt und es gibt eine lebendige Gemeinde in Jerusalem. Schließlich blieben die Apostel selbst an allen großen Festen im Tempel, um dort den Namen Jesu zu verkünden. Aber wir müssen vorsichtig sein. Wir können es uns nicht leisten, zu nachsichtig mit dem Gesetz zu sein.
Lukas: Ich muss sowohl Kontinuität als auch Wandel zeigen. Deshalb beginne ich mit dem Priester Zacharias im Tempel. Er erhält die Verheißung eines neuen Anfangs, eines Sohnes, der Johannes heißen soll. Das ist der Hintergrund für Johannes den Täufer. Zacharias und Elisabeth sind kinderlos, aber wie Abraham und Sarah erhalten sie die Verheißung eines Kindes. Zacharias schweigt und man kann das Unglauben nennen, aber im Buch Daniel schweigt Daniel auch, weil er überwältigt ist 6. Zacharias steht also für das gedemütigte Israel. Maria hat Miriam, die Schwester von Mose, als Vorbild, und Elisabeth hat die Frau des Priesters Aaron als Vorbild. Das alles schwingt mit. Das ist eine gute rabbinische Methode, nicht wahr? Das habe ich mir also gut von dir abgeschaut! Hannahs Hymne aus dem Buch Samuel ist das Vorbild der Hymne Marias. Es wird ein neuer Anfang gemacht. Hier spricht das wahre Israel. Das neue Israel kann auf uralte Beispiele eines solchen Neuanfangs zurückgreifen. Und zum Abschluss stelle ich zwei alte Menschen vor, Simeon und die Prophetin Hanna. Sie freuen sich über die Erfüllung der alten Verheißungen an Israel. Sie bestätigen die Kontinuität.
Matthäus: Es ist gut, dass Du für die Kontinuität eintrittst und sie zeigt. Aber Du sollest dann auch zeigen, dass es Dir mit dem Gesetz ernst ist! Auch das ist nicht nur in der Situation, in der wir uns befinden, notwendig, sondern es ist ein Wert an sich. Auch die Heiden sollen sich darauf einlassen. Sonst verlieren wir den Anschluss.
Lukas: Darüber denke ich wirklich anders. Aber ich will es nicht auf die Spitze treiben. Ich will ja die Apostelgeschichte neben dem Evangelium schreiben. Auch darin will ich Kontinuität und Wandel zeigen. Die Apostel, darunter auch Jakobus, der Bruder Jesu, waren sich einig, dass für Christen aus den Heiden das Gesetz nicht gilt, insbesondere die Beschneidung 7. Dieser Raum ist also dankenswerterweise vorhanden. Aber in meinem Buch Apostelgeschichte will ich das orthodoxen Juden, wie Du einer bist, nicht wieder unter die Nase reiben. Ich werde es positiver gestalten und mehr Gebrauch von der Metapher des Todes und der Auferstehung machen 8. Der Punkt, an dem sich die Geister scheiden, ist also nicht unbedingt das Gesetz, sondern der Glaube an die Auferstehung. Das ist für mich die entscheidende Metapher.
Matthäus: Ich möchte nicht darüber streiten. Ich bin mehr auf der Linie von Jakobus. Er stimmt zwar zu, dass Heiden, die zum Glauben kommen, nicht beschnitten werden müssen, aber vor allem, weil er nicht streiten will. Mit Nachdruck fügte er hinzu, dass es glücklicherweise noch überall Synagogen gibt, in denen ausreichend über Mose gepredigt wird 9. Das gibt einem Raum, und vielleicht ist es notwendig, aber ich halte es für ein abenteuerliches Unterfangen. Man kann den Geist wehen lassen, aber wenn die Menschen die Regeln und die Disziplin des Gesetzes nicht mehr befolgen, wo soll das enden?
Lukas: Es ist ein Abenteuer. Aber wir müssen es auf uns nehmen. Die Heiden haben die Macht Christi, des gekreuzigten Gerechten, wie Du es ausdrückst, erkannt und bilden eine neue Gemeinschaft, die sich wie ein Feuer über das ganze Römische Reich ausbreitet. Die Menschen erkennen, dass das Römische Reich moralisch leer ist. In der ecclesia finden sie Mitmenschen, Verbündete, die über die Grenzen der Familienbande hinweg füreinander eintreten. Nicht umsonst nennen wir uns in der ecclesia Brüder und Schwestern. Sie ist eine alternative Familie, die alles miteinander teilt und sich um die vielen Witwen und Armen kümmert. Das führt zu positiven, aber auch zu vielen negativen Reaktionen. Es erfordert unglaublichen Mut, sich selbst und die eigenen Interessen auf diese Weise zu überwinden. Paulus sagt es auch überall mit Nachdruck: Eine enorme Bedrängnis steht uns noch bevor und wir müssen darin ausharren. Denn diese neue Gemeinschaft heißt nicht umsonst ecclesia: öffentliche Versammlung. Überall ist die öffentliche Versammlung von den Römern abgeschafft worden, in allen Städten und Dörfern. Die haben nichts mehr zu sagen. Im Grunde genommen sagt das Volk nun: Hier ist das Volk! Langfristig macht das der römischen Macht ein Ende, darauf kann man warten. Aber weil das schon schwer genug ist, sollte man nicht etwas verlangen, was nicht wirklich notwendig ist. Und gleichzeitig ist es ganz wichtig, dass wir in dieser neuen Gemeinschaft auch die Juden mitnehmen, die es mit ihrem Glauben ernst meinen. Denn euer Herodes ist jetzt in Rom. Du siehst schon, dass die begeisterten Konvertiten verfolgt werden. Ich muss ihnen helfen, standhaft zu bleiben. Die große Krise, von der Paulus immer wieder spricht, rückt näher.
Matthäus: Wir sehen beide, dass wir als neue Gemeinschaft von Christen enormen Spannungen ausgesetzt sind. Wie können wir die Einheit unter uns bewahren? Die Situation Israels in Jerusalem erfordert eine andere Vorsicht als die, die Du brauchst. Wir müssen als Gemeinschaft in Palästina mit dem formalistischen Legalismus der jüdischen Führer fertig werden, die sich mit der römischen Macht arrangiert haben. Du und Paulus und andere haben eine Bewegung in Gang gesetzt, die die römische Macht schließlich von innen heraus untergraben kann. Wie können wir das zusammenbringen?
Lukas: Auch Paulus spricht in seinen Briefen oft von einer großen Krise, die bevorsteht. Und sie rückt näher. Wenn man nüchtern ist, kann man vorhersehen, dass die radikalen Zeloten und ihre Anhänger den Kompromiss der jüdischen Führer mit der römischen Macht in Stücke schlagen werden. Man kann auch vorhersehen, dass die Selbstbereicherung des Römischen Reiches und die privilegierte Stellung Roms das Reich in eine Krise stürzen werden. Auch Du hast diese Krise und diesen Konflikt mit Rom in deinem Evangelium vorausgesehen. Du selbst hast den Untergang des Tempels vorausgesagt. Aber Du nimmst immer noch an, dass es, wie zur Zeit der Makkabäer, um die Aufstellung des Kaiserbildes im Tempel gehen wird 10. Auch damit blickst Du auf eine frühere Krise zurück. Es wird jetzt wirklich nicht mehr so sein wie damals. Wenn ich dieses Kapitel von Dir in meiner Evangeliumsversion übernehme, werde ich auch daran etwas ändern. Ich werde sagen, wenn die Leute sehen, dass Jerusalem von Armeetruppen umzingelt ist, dann können sie sich ausrechnen, dass das das Ende der Stadt sein wird 11. Das scheint mir aktueller zu sein. Wenn das passiert, wird es auch die Christen in Rom treffen. Sie werden, was auch immer die Juden in Palästina tun werden, unter schwerer Verfolgung leiden. Wo wird das hinführen? Ich muss es also tun. Ich muss meine Version darlegen und sie so schnell wie möglich erscheinen lassen.
Matthäus: Ich grüße dich aus Syrien! Zum Glück sind wir weit weg von Jerusalem. Ich bin sicher, dass sich die christlichen Gemeinden, sollte es dazu kommen, aus Jerusalem zurückziehen werden. Wir beteiligen uns nicht am Kampf gegen Rom. Es sind Dunkle Zeiten. Haltet auf Deine Weise durch.
Verantwortung
Schon seit längerer Zeit beschäftige ich mich mit den Zusammenhängen der vier Evangelien. Der Grund dafür ist natürlich die wichtige Stellung, die die Evangelien im Werk von Rosenstock-Huessy 12 einnehmen. Für ihn ist Christus der Wendepunkt in der Zeit, in der Geschichte. Dieses Ereignis muß seine Spiegelung auch in den Evangelien gefunden haben. Darüberhinaus übt er massive Kritik an der Bibelwissenschaft seiner Zeit, weil sie nicht anerkennt, dass die Evangelien diese Wende in der Geschichte beschreiben. Übrigens trägt unsere Zeit immer noch diese überholte Bibelwissenschaft mit sich herum.
Ein Teil meiner Motivation, mich mit diesem Thema zu befassen, besteht auch darin, dass ich als Pfarrer oft Schwierigkeiten hatte, gut aus den Evangelien zu predigen. Ich hatte Angst vor billiger Gnade, wie Bonhoeffer es nennt. Vor allem zu Beginn meiner Laufbahn fiel es mir leichter, mich mit der alttestamentlichen Kritik an ungerechten Verhältnissen und der Sehnsucht nach einer Zukunft in Gerechtigkeit und Frieden zu befassen. Dass die Evangelien und das Neue Testament im Allgemeinen über diese jüdische Spannung zwischen Anfang und Ende hinausgehen, das wusste ich schon damals, aber ich konnte es eigentlich nicht gut artikulieren, weil ich es nicht so artikulieren wollte, dass die Spannung zwischen Anfang und Ende dadurch aufgehoben wurde. Und das würde passieren, sobald Liebe und Gnade gepredigt werden. Ich habe also Nachholbedarf, und das tue ich, indem ich darauf aufmerksam mache, dass Jesus Christus einen Weg zwischen Anfang und Ende, einen Weg vom Anfang zum Ende eröffnet. Eine Kette von gescheiterten Heiligen, die sich ganz hingegeben haben, eine Kette von Epochen, eine Kette von Versuchen, die nicht gelingen, bietet eine Reihe von Zwischenschritten. Die Teilnahme an diesem Weg kann zwar den Stress nehmen (so kleine Schritte, dass man nicht vorankommt), aber sie kann einem auch bewusst machen, dass die Vollendung nicht ohne einen selbst erreicht wird (Hebräer 11). Das ist der christliche Weg.
Die Evangelien sehen diesen christlichen Weg, indem sie jedes Mal ein Stück Antike überwinden und diese doch auch wieder auf den christlichen Weg umschalten, vorschalten, sagt Rosenstock-Huessy. Matthäus überwindet den Tribalismus Israels, sucht aber auch nach einem Stamm, der keine Sündenböcke braucht. Markus überwindet die Hierarchie des Imperiums, ermöglicht aber auch eine Hierarchie, die den Blick für die Unterschicht hat. Lukas überträgt die Inspiration Israels von einer Epoche in die nächste und ermöglicht eine Abfolge von Epochen, die dennoch nicht Stillstand und Wiederholung ist, gerade wenn die Inspiration Israels der tragende Grund dafür ist. Johannes schreibt Poesie, aber es ist keine willkürliche Phantasie, sondern eine Poesie, die in dem am Kreuz auferstandenen Christus ein Gravitationszentrum findet, um das sie kreist. So kann eine ursprünglich heidnische Form auf den christlichen Weg gebracht werden.
Jeder, der sich am Studium der Evangelien beteiligen möchte, zum Beispiel durch eine Antwort auf diesen Beitrag, ist willkommen. Wir können uns austauschen, vielleicht mal eine Rosenstock-Huessy-Tagung dem Thema widmen, wir können uns gegenseitig auf Publikationen aufmerksam machen. Rosenstock-Huessy folgt der kirchlichen Tradition, die davon ausgeht, dass die Evangelien eigentlich alle, mit Ausnahme des Johannesevangeliums, vor dem Jahr siebzig, vor dem Fall Jerusalems, geschrieben wurden. Es gibt nur wenige Exegeten, die ihm in diesem Punkt folgen. Einer, der ihm folgt, ist John A.T. Robinson (der übrigens Rosenstock-Huessy nicht kennt) 13, der über die Datierung der neutestamentlichen Schriften geschrieben hat. Es gibt auch nicht viele Leute, die die Zwei-Quellen-Theorie in Frage stellen, nach der Markus das erste Evangelium wäre und Lukas und Matthäus noch aus einer verlorenen zweiten Quelle geschöpft hätten, einer Quelle, die hauptsächlich Worte Jesu enthält. Markus enthält nur wenige Worte und Gleichnisse. William A. Farmer muss hier natürlich erwähnt werden 14. In unserer Zeit auch Richard Bauckham 15. Auch er vertritt den Standpunkt, und darin stimmt er mit Rosenstock-Huessy überein, dass die Evangelien durch die Annahme von Quellen im Hintergrund, deren Belege fehlen, ihrer Glaubwürdigkeit beraubt werden.
Otto Kroesen
3. Nachruf: Edzard Reuter
Dankbar gedenken wir des verstorbenen Edzard Reuter (16.Februar 1928 bis 27.Oktober 2024). In seiner Funktion als Vorstandsvorsitzender der Daimler-Benz AG hat er die Reprint-Ausgabe der Daimler Werkszeitung 1919/20 möglich gemacht. Reuter bekennt sich darin zum „Erzvater des Kreisauer Kreises“ dem in planetarischen Dimensionen denkendem Menschen. Er benannte die eigentliche Aktualität der Intuitionen Rosenstock-Huessy als „die Erkenntnis, daß das „soziale Problem“ auch eine geistig-kulturelle Dimension hat, die von dem nur szientistischen und materialistischen Geist nicht gesehen wird.“ Möge seine Erinnerung uns inspirieren in unseren Krisenzeiten! Thomas Dreessen
4. Geleitwort zur Reprint-Ausgabe der Daimler Werkszeitung 1919/20
Die Rosenstock-Huessy-Gesellschaft hat uns um Zustimmung und Unterstützung zum Nachdruck der Daimler Werkzeitung der Jahre 1919/20 gebeten. Wir folgen ihrem Wunsch gern, denn das in dieser Zeitschrift dokumentierte Zusammenwirken zwischen der Leitung eines Wirtschaftsunternehmens und einem jungen, hochbegabten und sensiblen „christlichen Sozialrevolutionär” stellt einen bemerkenswerten Versuch zur Lösung gesellschaftspolitischer Probleme in schwerer Zeit dar.
Für Daimler-Benz war dies ein wichtiger Ansatz in der Geschichte des Unternehmens, der es verdient, auch in der Gegenwart bedacht zu werden. In solchem historischen Wissen allein geht allerdings nicht auf, was Rosenstock-Huessy inhaltlich als seine Überzeugung eingebracht hat. Neben vielem anderen, aber durchaus stellvertretend, sei insoweit auf einen seiner Schlüsselsätze verwiesen, in dem er feststellt: Die Weltwirtschaft muß „den Gegenrhythmus zu ihrer eigenen technischen Rhythmik kontrapunktisch selber erzeugen”.
Rosenstock-Huessy meinte mit dieser Aussage nichts anderes als das, was auch Novalis im Sinne hatte, als er erklärte, daß jeder technische Fortschritt nur menschendienlich und -verträglich sein kann, wenn er von einer entsprechenden geistig-ethischen Anstrengung begleitet wird. Bereits Rosenstock-Huessy war sich der Tiefe der Fragestellung bewußt, die auch die gegenwärtige Diskussion um Problem und Krise der Industriegesellschaft bewegt, wenn von einer Unternehmenskultur, ja einer Unternehmensphilosophie die Rede ist.
Was die eigentliche Aktualität der Intuitionen Rosenstock-Huessys ausmacht, ist die Erkenntnis, daß das „soziale Problem” auch eine geistig-kulturelle Dimension hat, die von dem nur szientistischen und materialistischen Geist nicht gesehen wird. Seine konkreten Antworten. die er im Blick auf die damalige Situation gegeben hat, mögen zeitbedingt sein, aber seine Intention verdient es, auch unter veränderten und fortgeschritteneren Bedingungen der Gegenwart bedacht und ernstgenommen zu werden.
Wir wünschen uns, daß dieses frühe anspruchsvolle Dokument einer Werkzeitung und die in der Einleitung festgehaltenen Zusammenhänge seiner Entstehung auch Wissenschaftlern bei ihren Arbeiten Nutzen bringen. Wir freuen uns zu wissen, daß die Veröffentlichungen des Gesamtwerkes von Rosenstock-Huessy mit dem Neudruck vervollständigt werden können. Wir hoffen, daß damit auch Anregungen gegeben werden, die wissenschaftliche Forschung auf sozialpolitisch wichtige Problemlösungsversuche im Rahmen einer industriellen Betriebsgemeinschaft zu erstrecken.
Rosenstock-Huessy hat auch nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Daimler-Benz AG auf dem Gebiet der Erwachsenenbildung zusammengearbeitet. Im Begleittext zur Neuauflage seiner Buches „Der unbezahlbare Mensch” hat er 1962 die Fruchtbarkeit des „lebendigen Sprechens“ mit über 100 Ingenieuren unseres Hauses über die Gesetze des technischen Fortschritts erwähnt. Das Protokoll dieser Tagung ist unten angefügt.
Es erfüllt uns mit Genugtuung, daß dieser von Walter Hammer später „Erzvater des Kreises” genannte, in planetarischen Dimensionen denkende Mann schon der Daimler-Motoren-Gesellschaft nahestand und in deren Vorstandsmitglied Professor Riebensahm einen vorausdenkenden Partner fand.

5. Was bewegt die Ukrainer?
Heldentum
Seit dem Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine 2022 bin ich erstaunt über die Überzeugung, den Mut und das Engagement der Ukrainer, sich aus dem Griff Russlands zu lösen. Selenskyj gab den Ton an, als er das amerikanische Angebot, aus der Ukraine zu fliehen und in den Vereinigten Staaten Asyl zu suchen, ablehnte und sich entschloss zu bleiben. Doch damit gab er offenbar der ganzen Nation eine Stimme, denn eine große Zahl von Menschen aus allen Gesellschaftsschichten mobilisierten sich, um Russland mit allen Mitteln zurückzudrängen. Der Mut der Zivilbevölkerung hielt die russische Armee einen Monat lang in Bucha auf, etwa 25 km von Kiew entfernt, also etwa so weit wie die Reichweite der russischen Geschütze. Woher kam dieser Mut?
Diese Frage ist umso wichtiger, als in der öffentlichen Debatte manchmal bezweifelt wird, ob es überhaupt ein ukrainisches Volk gibt. Offenbar denkt nicht nur Putin so. Das sagte er auch Präsident Bush, als dieser 1990 Russland besuchte. Bush reiste daraufhin aus Russland über die Ukraine zurück und forderte das ukrainische Parlament auf, trotzdem in der Russischen Föderation zu bleiben 16. Oft wird über den Konflikt zwischen Russland und dem Westen über die Köpfe der Ukrainer hinweg gesprochen. Ich selbst habe mich in meinem letzten Beitrag für diesen Rundbrief auch dessen schuldig gemacht und versuche nun, dies wiedergutzumachen. Haben die Ukrainer eine eigene Stimme? Gibt es so etwas wie ein Volk, die Ukrainer? Dabei ist die Sprache nicht entscheidend. Viele Menschen sprechen sowohl Russisch als auch Ukrainisch, und Russisch war immer die Amtssprache und die Sprache für offizielle Anlässe und damit die urbane Sprache. Die Bauern sprachen Ukrainisch. Auch die ethnische Zugehörigkeit ist nicht ausschlaggebend, denn Ethnizität ist ein fließender Begriff, der sehr davon abhängt, wie man sich selbst sieht. Aber was ist dann entscheidend? Die eigentliche Antwort darauf ist - ganz im Sinne von Rosenstock-Huessy - das, was die Menschen bewegt. Der Geist baut den Körper. Für Rosenstock-Huessy ist das Volk kein ethnischer Begriff. Volk, das heißt, Menschen in einem noch ungeformten Zustand, wie das griechische „laos“, von dem dann das Wort „Laie“ kommt. „People“ sagen die Engländer, was wiederum von ‚populus‘ abgeleitet ist und das Gleiche bedeutet. Erst wenn Menschen von einem gemeinsamen Geist ergriffen werden, wenn sie unter einem gemeinsamen Imperativ stehen, werden sie zu einem Volk. Dies drückt auch der Titel des Buches über die Geschichte der Ukraine von Jaroslaw Hryzak „The Forging of a nation“ aus: Die Hitze des Kampfes um eine neue Existenz ist es, die ein Volk zu einer nationalen Einheit schmiedet 17.
Vergleich mit der Entstehung der Niederlande
In dieser Hinsicht gibt es eine Parallele zwischen der Entstehung des niederländischen und des ukrainischen Volkes. In der Grundschule musste ich noch lernen, dass es 100 v. Chr. Friesen, Franken und Sachsen gab „in unserem Land“. Seht, wie der Mythos funktioniert! In die Vergangenheit zurückprojiziert, war dieses Land schon lange „unser Land“. Als die Hunnen dort ihre Dolmen bauten, taten sie das auch in „unserem Land“ - wahrscheinlich war das den Hunnen selbst nicht bewusst. In Wirklichkeit gab es selbst zu Beginn des 80-jährigen Krieges in den Niederlanden im Jahr 1568, dem Konflikt mit Spanien, dem die Nation ihre Existenz verdankt, so etwas wie ein nationales Bewusstsein nicht. Die Menschen waren auf verschiedene Regionen, Provinzen, verteilt, und diese waren wie Bauerngemeinden und Städte direkt dem Kaiser unterstellt, und ja, ein paar Grafen dazwischen. Es gab wenig Kontakt zwischen ihnen. Es gab kein Parlament, oder vielleicht doch, seit Philipp der Gute 1464 erstmals alle 17 Provinzen der Niederlande und Flanderns zusammengerufen hatte. Es gab auch einen Bund der Hansestädte. Aber es gab keine gemeinsame Verantwortung für die Vergangenheit und die Zukunft insbesondere des Gebiets, das heute die Niederlande sind. Erst die Utrechter Union von 1579 brachte dies mit sich: Dort vereinbarten die sieben nördlichen Provinzen, dass sie keinen separaten Frieden mit Spanien schließen würden. Ein solches Versprechen war schwer einzuhalten, wenn dann die Spanier vor den Toren der eigenen Stadt standen und wenn man sich mit anderen Städten wenig solidarisch fühlte, weil es noch keine echte niederländische Nationalität gab. Aber in der Hitze des Gefechts hat dieses Versprechen trotzdem gehalten. Und weil sich die Städte damals so verhielten, wurden die Niederlande zu einem Nationalstaat. Gleichzeitig war dies immer noch von großem Misstrauen begleitet, denn die Stadt Amsterdam war im Alleingang so reich und stark wie der Rest der Niederlande zusammen. Daher mussten viele Kompromisse geschlossen werden. Einer dieser Kompromisse war, dass Amsterdam zwar die Hauptstadt sein durfte, die Regierung aber in Den Haag angesiedelt war. Ich glaube, die Niederlande sind das einzige Land auf der Welt mit dieser Regelung. Auch hier baute der Geist den Körper.
Es gibt eine weitere Parallele in der niederländischen Geschichte zu dem, was die Ukrainer durchgemacht haben. Laut dem ukrainischen Historiker Plokhy sind die Ukrainer in Osteuropa das einzige Volk, das es nicht zur Staatlichkeit geschafft hat 18. Erst ab 1990 gelang dies schließlich (hoffentlich). Davor versuchten die ukrainischen Bauern auf alle möglichen Arten zu überleben, indem sie sich unter der Herrschaft der Adligen/Großgrundbesitzer der polnisch-litauischen Gemeinwesen oder unter dem Habsburger Reich hielten, und später bildeten die Kosaken einen Staat. Viele Bauern, die dem polnisch-litauischen Regiment entkommen wollten, suchten Zuflucht bei den Kosaken in der Steppe. Wir stellen sie uns auf Pferden vor, aber die hatten sie damals nicht - sie kämpften zu Fuß, aber sie konnten kämpfen. Sie behaupteten sich als unabhängiger Staat im östlichen Teil der heutigen Ukraine, bis Katharina die Große ihr Gebiet im späten 18. Jahrhundert im Russischen Reich einverleibte. Im 19. Jahrhundert existierte die ukrainische Nation nur noch in den Köpfen und Herzen von Dichtern, Historikern und Philosophen 19. Erst zwischen 1918 und 1920, nach dem Ersten Weltkrieg, konnten die Ukrainer unter Skoropadskyjs Führung einen unabhängigen Staat bilden, doch auch dieser wurde schnell von der diesmaligen Sowjetunion geschluckt. Zunächst ließ die Sowjetunion dem ukrainischen Nationalismus freie Hand, weil man hoffte, dass dies zur Akzeptanz des Kommunismus beitragen würde. Dies war eine Entscheidung für eine endogene Entwicklung, die zur Integration in das neue kommunistische Reich führen sollte.
Das Polnisch-Litauische Gemeinwesen, dann das Habsburgerreich, dann Russland, dann die Sowjetunion - so ging die ukrainische Bauernschaft von Hand zu Hand, immer unter der Kontrolle höherer Mächte. Im Jahr 1990 erklärte die Ukraine als erste der Sowjetrepubliken ihre Unabhängigkeit, die anderen folgten bald. Damit gab die Ukraine zu diesem Zeitpunkt den Ton an, denn mit dem Austritt der Ukraine aus der UdSSR war das Schicksal der Sowjetunion auch für die anderen Republiken besiegelt. Auch hier gibt es eine Parallele zur niederländischen Nation. Bis zum Beginn des Achtzigjährigen Krieges im Jahr 1568 waren auch die Niederländer (ich ziehe es vor, noch nicht von Nation zu sprechen) eher Objekte als Subjekte der Geschichte. Die Niederlande gehörten einfach zum Deutschen Reich. Im Jahr 1533 ernannte Karl V. seinen Sohn Philipp zum Regenten über die Niederlande. Damit gerieten die Niederlande unter die Kontrolle des Spanischen Reiches, über das Philipp als König Philipp II. die Herrschaft ausübte, auch wenn er selbst auf dem spanischen Thron saß. Wenn man als Land an ein anderes Land verschenkt wird, kann man irgendwann auf die Idee kommen, auch das Gegenteil zu tun. Schließlich kann man sich ja auch selbst umsehen, ob man nicht einen anderen Kapitän findet. Im Jahr 1581 verzichteten die Generalstaaten der Niederlande (das Parlament) mit dem „Plakkaat van Verlatinghe“ auf das Spanische Regime. Es ist nicht so, dass sie keine höhere Autorität akzeptierten, sie konnten nicht einmal auf sie verzichten. Man war der Meinung, dass man nicht anders handeln konnte. In der niederländischen Nationalhymne werden die Niederländer immer noch als treue Diener des spanischen Reiches dargestellt, das sie „immer geehrt“ haben. So distanzierten sich die Niederlande bescheiden und entschlossen von Philipp II. Sie wussten, dass es eigentlich nicht möglich war, als eigenständiger Staat zu überleben. Zwei Jahre lang suchten die Niederlande nach anderen Mächten und boten sich zunächst dem französischen König an, der ablehnte, und versuchten es dann zwei Jahre lang mit Leicester als Vertreter der englischen Regierung. In ähnlicher Weise muss nun die Ukraine - das ist die Parallele, auf die ich mich beziehe - Schutz bei einer anderen Macht suchen, um zu überleben, und zu diesem Zweck ist die Europäische Union die Lösung.
Europa und Eurasien
Man kann Timothy Snyder zustimmen, dass die europäischen Staaten etwas hochmütig sind, zumindest die europäischen „Großmächte“ 20. Sie verhalten sich wie weise alte Männer, die wohlüberlegte Kriterien der guten Regierungsführung, der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und der Korruptionsfreiheit anwenden und so andere Staaten beurteilen, ob sie sich ihnen anschließen dürfen. Aber dieselben europäischen Staaten waren einst Imperien. Sie konnten sich dank ihrer Kolonien als Supermächte in der Welt behaupten. Die Einheit Europas, so Snyder, kam erst in den Blick, als die Kolonien wegfielen. Dann mussten sie Zuflucht in dem einen Europa als Ersatz-Supermacht suchen. Gegen Snyders Sichtweise lässt sich freilich etwas einwenden. Denn dieselben europäischen Großmächte, Imperien hin oder her, haben sich zweimal bis aufs Blut bekämpft, und der moralische Imperativ, dies nicht ein drittes Mal zu tun, musste institutionell besiegelt und garantiert werden. Diesem Umstand verdankt die Europäische Union ihre Geburtsstunde. Denn nur die gegenseitige politische und wirtschaftliche Verflechtung konnte dies hinreichend garantieren. Dennoch ist seine Vision eine gute Erinnerung an die Notwendigkeit eines größeren Zusammenhalts, den Europa vor allem den jungen Staaten in Europa bieten muss. Außerdem ist es wahr, dass sich die europäischen Nationalstaaten ihrer gegenseitigen Abhängigkeit nicht ausreichend bewusst sind. Sie können sich ohne einander nicht halten, tun aber gleichzeitig so, als ob man - so Snyder - in die Europäische Union hineingehen und gleich wieder herauskommen kann. Putin kontrastiert diesen inkohärenten Pluralismus mit Eurasien. Die russische Kultur sei noch jung und vielversprechend; der Westen sei nach seiner 2000-jährigen Geschichte alt und dekadent. Russische nationalistische Denker wie Iljin und Dugin geben in diesem hierarchischen und imperialistischen Denken den Ton an. In seiner Idealform, so Iljin, schließt Eurasien Europa ein. Dies sei eine viel bessere Garantie für die Zukunft Europas. Ein klientelistisches System mit Russland im Zentrum hielte dann alles zusammen. Hier steht der kollektivistische Mensch Russlands dem westlichen Einzelgänger gegenüber, der keinen Halt hat.
Es lohnt sich, Snyder etwas länger zuzuhören, wenn es um das Verhältnis Russlands zum Westen geht. Sowohl der Westen als auch Russland haben sich der Politik der Unvermeidlichkeit schuldig gemacht, wie Snyder es nennt. Unvermeidlichkeit bedeutet: Es gibt keine Alternative zur Wirtschaftspolitik, wie sie unter anderem von Europa verfolgt wird. Es ist auch keine größere Erzählung über das Warum und Wozu der Existenz erforderlich. Ein ideologiefreier Pragmatismus kann alle Probleme lösen und alle Bedürfnisse der Menschen befriedigen. Merkel in Deutschland und Rutte in den Niederlanden verkörpern wohl diesen Ansatz. Im Grunde genommen müssen die Menschen dann nur noch dem folgen, was Rosenstock-Huessy den Konjunkturzyklus nennt: Alle politischen und wirtschaftlichen Anstrengungen zielen darauf ab, einen ausreichend hohen Lebensstandard für die Verbraucher zu erhalten. Rutte sagte einmal, dass größere gesellschaftliche Visionen wie Elefanten sind, die nur die Sicht behindern. Das fällt unter das, was Snyder die Politik der Unvermeidlichkeit nennt. Man muss vorankommen und seinen Vorteil suchen und am besten alles so arrangieren, dass die Bedürfnisse aller befriedigt werden. Es besteht keine Notwendigkeit für eine größere Geschichte. Das ist nur ein Elefant. Rosenstock-Huessy erhebt denselben Vorwurf, den Snyder dem Westen und Russland macht, bereits 1942 gegenüber den Amerikanern. Sie sehen den Zweiten Weltkrieg, der sich in Europa abspielt, aus der Ferne und nehmen ihn nicht ernst. Vielmehr bewegen sie sich mit dem Strom, um den Lebensstandard aufrechtzuerhalten, aber damit entziehen sie sich dem historischen Auftrag, dem sie sich stellen müssen. Sie müssen in diesen Konflikt eingreifen, so versucht er sie dazu zu drängen 21.
Snyder macht auch Russland für die Politik der Unvermeidlichkeit verantwortlich. Bis 2012 konnte Putin den westlichen Ansatz, die Politik der Unvermeidlichkeit, die Wohlstand bringt, mittragen. Dann drohte er die Wahlen zu verlieren und ging sehr schnell zu einer feindseligen Darstellung des Westens, des russischen Nationalismus und des Wir-Sie-Denkens über. Denn die Politik der „Ewigkeit“ ersetzte nun die Politik der „Unvermeidlichkeit“. Damit meint Snyder die heroische Größe des russischen Volkes, die Feindschaft gegen die westliche Dekadenz und die Tragödie des Wir-Denkens, das alle Probleme immer den anderen in die Schuhe schiebt. Snyder schreibt sein Buch im Jahr 2018. Er drückt die Befürchtung aus, dass etwas Ähnliches auch im Westen, zum Beispiel in Amerika, passieren könnte. Denn seiner Meinung nach führt ein automatischer Weg von der Politik der Unvermeidlichkeit zur Politik der Ewigkeit. Daher auch der Untertitel seines Buches „Der Weg zur Unfreiheit“. Ich erwähne dies, weil seine Argumentation auch hier Parallelen zu Rosenstock-Huessy aufweist. Letzterer schrieb in den 1920er Jahren über den Aufstieg des Nationalsozialismus in Deutschland. Menschen, die in ihrer Existenz klein gehalten werden - und Rosenstock-Huessy verweist vor allem auf die Mechanisierung der Arbeit in der Industrie und die damit einhergehende Verkürzung der Zeitperspektive auf die alltägliche Existenz - suchen Kompensation in Allmachtsphantasien. Reduziert auf Zahlen in der industriellen Maschinerie, flüchteten sie sich in das Wir-Gefühl der Arbeiterklasse im Sozialismus oder in das Wir-Gefühl nationaler Größe im Nationalsozialismus 22.
Zahl oder Vollzählig
Wie konnte es so weit kommen? Woher kommt dieser Weg von der Unvermeidlichkeit in die Ewigkeit? Das ist das Problem und die Frage, um die herum Rosenstock-Huessy seine Soziologie geschrieben hat. Wenn man nur dem Konjunkturzyklus folgt und keine höhere Mission kennt, wird man automatisch zu einer Nummer in der sozialen Maschinerie. Man hat keine Geschichte mehr, kein Warum und Wozu. Entweder ist man eine Nummer in der gesellschaftlichen Existenz und in der industriellen Produktion, oder man ist als Mensch vollzählig mit einem Ursprung und einer Bestimmung. Deshalb erzählt die Soziologie von Rosenstock-Huessy die Geschichte, die Zuordnung, die erworbenen Eigenschaften aller geologischen Schichten der Menschheitsgeschichte 23.
Seit der Französischen Revolution und dem Aufkommen des Nationalstaates hat sich auch die industrielle Produktion entwickelt. Beide sind miteinander verwoben. An die Stelle des Agrarstaates mit allenfalls häuslicher Produktion, in dem die Arbeit immer vor Ort stattfindet, treten große Genossenschaften, die den Menschen die Einbettung in Familie und Dorf nehmen. Ein Industriestaat erfordert Größenvorteile und gegenseitiges Vertrauen um der gegenseitigen Zusammenarbeit willen, während ein Agrarstaat, in dem die Produktion vor Ort stattfindet, dies weniger erfordert. Auch für Hrytsak, dessen Buch der internationalen Einbettung der ukrainischen Geschichte und ihrer Verflechtung mit der Geschichte des Westens, die bis ins 16. Jahrhundert zurückreicht, mehr Aufmerksamkeit schenkt als die erwähnte von Plokhy, ist ein wichtiges Element der Geschichte der Ukraine 24. Die Ukraine wandelt sich Schritt für Schritt von einem Agrar- zu einem Industriestaat. Die ukrainischen Bauern erlebten die Entwurzelung des Ersten Weltkriegs, den Holodomor von 1932-1934 unter dem Stalinismus, die Erschütterungen des Zweiten Weltkriegs, das heimliche Wachsen der ukrainischen Unabhängigkeit unter dem Sowjetkommunismus 25. Shelest tat als Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Ukraine viel, um die verschiedenen Strömungen zusammenzubringen: Er verband den sozialistischen Weg mit ukrainischem Patriotismus und mit der Aufmerksamkeit für die ukrainische Kultur. 1972 ging er damit für Moskau zu weit und wurde nach Moskau gerufen 26. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg wuchs eine Generation heran, die über ihre lokalen ethnischen Bindungen hinaus denken konnte. Die industrielle Entwicklung braucht eine Zivilgesellschaft, argumentiert Hrytsak. Die Zentralisierung der materiellen Produktion mag gut gehen, aber in der kreativen Wirtschaft ist die Zentralisierung ein Stolperstein 27. Ich habe dasselbe über afrikanische Länder geschrieben: Die ethnischen Unterschiede und das Misstrauen untereinander, kombiniert mit den klientelistischen Netzwerken, die in afrikanischen Ländern oft noch entlang von Stammeslinien verlaufen, stehen der Zusammenarbeit, dem gegenseitigen Vertrauen und damit der wirtschaftlichen Entwicklung im Weg 28. Eine Produktion in großem Maßstab ist ohne Größenvorteile einfach nicht möglich. Insbesondere der Teil der Ukraine, der zum Habsburger Reich und zu Polen gehörte, Galizien, hat mehr Erfahrung mit einer bürgerlichen Gesellschaft. Russland musste seine fähigen Leute immer aus dem Westen beziehen und brauchte daher die Ukraine für seine eigene Entwicklung. Der Staudamm am Dnjepr zum Beispiel wurde mit Unterstützung eines amerikanischen Ingenieurs gebaut. Der Bau dauerte von 1927 bis 1931. Stalin sagte dazu 1924: „Die Verbindung von russischem revolutionärem Schwung mit amerikanischer Effizienz ist das Wesen des Leninismus in der Partei- und Staatstätigkeit“ 29. Gleichzeitig misstrauten die Parteifunktionäre aber auch konsequent den Ukrainern im Staatsapparat 30. Als irgendwann die eigene Kultur der Ukraine anerkannt wurde (z. B. nach 1924), wollte man damit erreichen, dass die kommunistische Ideologie leichter akzeptiert werden konnte. Als sich die ukrainischen Bauern jedoch später weigerten, die Landwirtschaft in Kolchosen zu kollektivieren, wurde diese tolerante Haltung ins Gegenteil verkehrt. Stalin bestrafte diese Weigerung mit der organisierten Hungersnot, dem Holodomor von 1932-1934, der insgesamt 4 Millionen Opfer forderte 31. Diese Hassliebe zwischen Russland und der Ukraine spiegelt sich immer in der ukrainischen Geschichte wider, auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Handelskrieg gegen die Ukraine im Juli 2013 und der Druck Russlands auf Janukowitsch, den Vertrag mit Europa nicht zu ratifizieren, sind Beispiele dafür. Als Janukowitsch die Unterzeichnung eine Woche vor der offiziellen Unterzeichnung absagte, führte dies zu den Maidan-Demonstrationen 2013/2014. Plokhy weist darauf hin, dass Russland ohne die Ukraine zu einer Minderheit inmitten einer muslimischen Bevölkerungsmehrheit in der Russischen Föderation wird. Ohne die Ukraine verlieren diese Länder den Glauben an die Zukunft der Russischen Föderation.
Der Charakter der ukrainischen Nation
Im Laufe der Geschichte gab es in der Ukraine viele gegenseitige Kämpfe, zwischen Ostukrainern, die eher sowjetisch orientiert waren, und Westukrainern, die eher das habsburgische Erbe übernommen hatten, zwischen Polen und Ukrainern, Ungarn und Ukrainern, zwischen Juden und Ukrainern, immer und immer wieder. Oft hatten die Juden eine Stellung als Verwalter für die abwesenden Großgrundbesitzer, und das warf die entsprechenden Probleme auf. In vielerlei Hinsicht wurde immer wieder der Versuch unternommen, die ukrainische Nationalität auch im ukrainischen Staatskontext zu institutionalisieren. Anderen Nationalitäten gelang dies besser und sie konnten dabei oft auch ihre Interessen besser vertreten. Angesichts all der blutigen Konflikte und Auseinandersetzungen auch zwischen den ukrainischen Volksgruppen kann man sich fragen, wie es dennoch möglich war, dass seit 1990, also seit mehr als 30 Jahren, diese verschiedenen Gruppen in einem einheitlichen staatlichen Kontext zusammenarbeiten? Hrytsak weist darauf hin, dass die verschiedenen Gruppen alle in den Gulag-Lagern unter Stalin reichlich vertreten waren 32. Dem gleichen elenden Schicksal unterworfen, wurden Gespräche untereinander geführt, Konfrontationen bereinigt und Wunden benannt und geheilt. Diese Generation legte den Grundstein für eine andere Zukunft und machte es möglich, dass sich später eine neue Generation von Politikern, damals unter der Führung von Krawtschuk, in der Überzeugung zusammenfand, dass diese Geschichte hinter sich gelassen werden musste 33. Außerdem hatte eine neue Generation junger Menschen eine gute Ausbildung erworben und sah nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion Chancen für eine weitere Entwicklung. Hrytsak weist wiederum darauf hin, dass die rein industrielle Produktion in einem engen hierarchischen Rahmen funktionieren kann, während die Kreativwirtschaft auf freie Meinungsäußerung und offenen Austausch von Meinungen und Ideen angewiesen ist. All dies sind Erklärungen für das Engagement der Ukrainer und die Überzeugung, mit der sie im Konflikt mit Russland für sich selbst eintreten. Die Dynamik dieses Engagements wird dadurch jedoch nicht ausreichend erklärt. Für jede der europäischen Revolutionen nennt Rosenstock-Huessy einen spezifischen Druckpunkt, der diese Revolution unausweichlich macht. Für die Russische Revolution nennt er beispielsweise die Freilassung der Leibeigenen im Jahr 1861. Die Leibeigenen wurden zwar freigelassen, erhielten aber kein Land und hatten daher, da sie nun nicht mehr unter der Schirmherrschaft der Bauern standen, keine wirtschaftliche Zukunft. Für die italienische Stadtrevolution nennt er die Zerstörung Mailands durch Barbarossa. Für die Ukraine kann man auf die Schrecken des Zweiten Weltkriegs verweisen, in dem die Ukrainer Spielball und Schlachtfeld waren, vor allem aber auf die große Hungersnot, den Holodomor von 32-34. Die Ukraine war gleichzeitig der am weitesten entwickelte und der am meisten eingeschüchterte Teil der Sowjetunion. Tschernobyl war ein Weckruf für die Ukrainer. Man war das erste Opfer der Kernschmelze in diesem Kernkraftwerk, hatte aber kein Mitspracherecht und war völlig abhängig von Moskaus Handeln oder Nichthandeln.
Rosenstock-Huessy führt in seinem Buch von 1931/1951 sechs große Revolutionen auf, die Europa geprägt haben 34. Er erwähnt den Konflikt zwischen dem Papst und dem deutschen Kaiser, die städtische Bewegung und die Zunftbewegung in Italien und später im übrigen Europa, die deutsche Reformation, die englische parlamentarische Revolution, die französische Revolution und die russische Revolution. Sie alle waren tiefgreifend, weil sie eine neue Rechtsordnung, einen neuen Menschentyp und eine neue Sprache hervorbrachten und ihren Einfluss in ganz Europa spürbar machten. Es hat viele andere Revolutionen gegeben, die nicht alle drei Merkmale aufweisen, entweder weil sie zwischen zwei großen Revolutionen liegen (wie die Niederlande zwischen der deutschen Reformation und dem englischen Parlamentarismus) oder weil sie nicht wirklich originell sind, sondern die revolutionären Errungenschaften anderer Völker übernehmen. Wie ist nun die Ukraine in diesem Spektrum einzuordnen?
Zunächst ist man dazu geneigt, an die Französische Revolution zu denken, weil das ukrainische Volk endlich seinen eigenen Nationalstaat beansprucht. Das ist sicher richtig, aber die Französische Revolution beanspruchte auch, den Menschen wieder eine vernünftige und natürliche Existenz zu geben, und das bedeutete für die Franzosen mit eine gewisse Selbstverständlichkeit: eine Sprache, eine Hauptstadt, um die sich alles dreht, und natürliche Grenzen. Das trifft auf die Ukraine nicht zu, denn die Besonderheit der ukrainischen Nation besteht gerade darin, dass sie viele Bevölkerungsgruppen beherbergt. Außerdem hat die Ukraine, wie Polen, Litauen und Ungarn, etwas mit der englischen Revolution gemeinsam. Wie in England herrschte auch in den polnischen und litauischen Parlamenten und in der ungarischen Gesellschaft der niedere Adel, und in diesen Ländern waren dies die Großgrundbesitzer. Um die Zentralgewalt des Königs unter Kontrolle zu halten, hatten alle polnischen Adligen ein Vetorecht im Parlament. Trotz der Abhängigkeit der einfachen ukrainischen Bauern von den Großgrundbesitzern in der polnisch-litauischen Zeit gab es immer noch eine parlamentarische Vertretung und eine gewisse Form der Gegenseitigkeit. Unter russischer Herrschaft fehlte dies. Als sich die Kosakenrepublik Russland unterwarf, mussten die Bauern dem Zaren einen Treueeid schwören. Nun verlangten sie, dass der Vertreter des Zaren ebenfalls einen Eid im Namen des Zaren ablegte. Er weigerte sich. Der Zar leistet seinen Untertanen keinen Eid 35. Sicherlich trägt auch die Ukraine das Erbe des polnisch-litauischen Gemeinwesens und die Tradition der demokratischen Repräsentation und der gegenseitigen Verantwortung in sich. Rosenstock-Huessy beschreibt in seinem Revolutionsbuch auch das Erbe des Habsburgerreiches Österreich-Ungarn. Wien verstand es, viele Völker, Sprachen und religiöse Überzeugungen in einem staatlichen Kontext zu vereinen und trotz aller Spaltungen die Einheit zu wahren. Diese Einheit und Vielfalt zugleich ist der große Beitrag des Habsburgerreiches für die europäische Staatenwelt. Sicherlich kann man auch die ukrainische Revolution unter diesem Gesichtspunkt betrachten. Sicherlich ist in den letzten 30 Jahren in der unabhängigen Ukraine die Kunst des Zusammenlebens vieler Bevölkerungsgruppen praktiziert worden und das ist an sich schon eine große Leistung. Dabei hat die Ukraine übrigens auch an dem teilgenommen, was Rosenstock-Huessy die eigentliche Revolution der beiden Weltkriege nennt: Mehr noch als durch die Russische Revolution haben die Weltkriege unser heutiges Gesellschaftssystem weltweit beeinflusst. Sie haben dazu geführt, dass es kein Machtzentrum mehr gibt, das die Welt nach ihrem Willen beugen kann. Und das bedeutet, dass in der modernen globalen Gesellschaft im Großen wie im Kleinen nur gegenseitige Verantwortung, so schwierig sie auch sein mag, einen Weg in die Zukunft bietet. In der Tat können nur Gespräche und gegenseitiges Verständnis zu dauerhaften Lösungen führen. Nach dem Zweiten Weltkrieg musste dieses Gespräch auf lokaler und internationaler Ebene intensiviert werden, um Kriege zu vermeiden. Nun hat jede Revolution ihre spezifischen Errungenschaften. Die Errungenschaft, die wir nach den Weltkriegen global durch Versuch und Irrtum praktizieren, ist: miteinander zu reden und zuzuhören, um, verändert durch den anderen, einen Weg nach vorne zu finden, mit Respekt für den Beitrag des anderen. Der gemeinsame Widerstand gegen die harte Hierarchie Russlands treibt die verschiedenen Gruppen, die in der Ukraine zusammenleben, weiter in diese Richtung. Sie müssen zueinander finden, sonst werden sie keinen Erfolg haben. In diesem Sinne geht die Ukraine in Europa voran: miteinander reden und einander zuhören als Mittel zur Überwindung des Interessenkonflikts. Rosenstock-Huessy hat Österreich auch als die Tochterfigur Europas bezeichnet: Sie empfängt und bedankt sich für alle bisherigen Errungenschaften und führt sie in die Zukunft. Vielleicht können wir das auch von der Ukraine sagen. Wenn das Miteinanderreden der Vertreter der verschiedenen Gruppen in der Ukraine im Gulag unter Stalin den Grundstein dafür gelegt hat, so ist der Nationalstaat der Ukraine seine Frucht.
Otto Kroesen
6. Peter Sloterdijk: Der Kontinent ohne Eigenschaften
Nachdem Peter Sloterdijk Eugen Rosenstock-Huessy schon verschiedentlich als den „bedeutendsten Sprachphilosophen des 20. Jahrhunderts“ gelobt hatte (den Jürgen Habermas in einer Fußnote seiner „Theorie des kommunikativen Handelns“ versteckte) oder als „geistreichen, christlichen Revolutionstheoretiker“, hat er ihm in seinem neuesten Werk ein ganzes Kapitel eingeräumt.36 Hatte der Meisterarrangeur aus dem Hause Suhrkamp bereits mehrere Interventionen zu Europas Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft vorgelegt, so eröffnet er „Der Kontinent ohne Eigenschaften. Lesezeichen im Buch Europa“ mit seiner Antrittsvorlesung am Collège de France vom 4. April 2024: „Ausreden, Nekrologe, Aprèsludes“. Im Zentrum der Lektion Zwei steht Eugen Rosenstock-Huessy und sein Werk über die europäischen Revolutionen, vor allem in der Fassung, die 1938 auf ein angelsächsisches Publikum umformuliert worden war. Peter Sloterdijk geht zwar auf die Erstausgabe von 1931 ein und erwähnt den ersten „Wurf“ von 1920 als „Die Hochzeit des Kriegs und der Revolution“, aber im Mittelpunkt steht „Out of Revolution“. Damit dürfte er der erste Denker von Rang sein, der sich in dieser Ausführlichkeit und vertiefter Kenntnis mit dieser Version beschäftigt. Eugen Rosenstock-Huessy selbst hatte immer wieder beklagt, daß diese Fassung seines Werkes nicht einmal in den Universitätsbibliotheken vorhanden sei.37
Lektion drei widmet sich der legendären Untergangsprognose Oswald Spenglers, bei der Sloterdijk die Pointe entgeht, daß sich Spengler und Rosenstock auf Vermittlung des Hochland Herausgebers Carl Muth im April 1919 zum Gespräch in München getroffen hatten, in jenem Schwabing, in dem auch Lenin über seine Revolutionspläne brütete.38 Auf das ausdrücklich Spengler umkreisende Kapitel vom „Selbstmord Europas“ aus der „Hochzeit des Kriegs und der Revolution“ geht er nicht ein, auch wenn er ausführt:
„In der Konfrontation Rosenstocks mit Spengler treffen ein Verfechter der negentropischen Prozeßlogik und ein Fürsprecher der zivilisatorischen Entropie hart aufeinander. In anderer Terminologie könnte man von der Kollision von Utopismus und Pragmatismus sprechen – oder, um an die klassisch gewordene Musilsche Unterscheidung zu erinnern von dem unauslotbaren Gegensatz zwischen den Möglichkeitssinn und dem Wirklichkeitssinn.“39
Im Text bemüht Sloterdijk für „Our of Revolution“ die Parallele zum Afrikaner Aurelius Augustinus, der sein Werk über den Gottesstaat „Civitas Dei“ in dem Jahr 410 aufschrieb, als der Barbar Alarich die ewige Stadt Rom eroberte und brandschatzte. Ähnlich einschneidend sei für Eugen Rosenstock-Huessy und einige seiner wacheren Zeitgenossen das Weltkriegserlebnis von 1914-1918 gewesen, in der unumkehrbar eine alte Welt zusammenbrach. In diesem Zusammenhang erwähnt der Autor Karl Barth, Ernst Bloch, Martin Heidegger, Paul Valery, Hermann Broch und dann vor allem auch Rosenstocks vielleicht engsten Freund Franz Rosenzweig:
Er teilt es besonders mit Franz Rosenzweig, der in seinem Werk *„Der Stern der Erlösung“, 1922, eine Abkehr von aller Überlieferung theoretischen Philosophierens vollzog, um nur noch ein „neues“, ein vom wirklichen Dasein „verunreinigtes“ Denken gelten zu lassen: eine durchaus ent-ewigte, ganz in dir Zeitlichkeit ausgesetzte Bestimmung auf die Prämissen des unerlösten Lebens.*40
Er habe sich als Kämpfer begriffen, der „nackt vor dem Tod gestanden hatte“ und „gewandelt“ aus der Prüfung hervorgegangen sei.41 Mit leicht spöttischem Unterton formuliert Sloterdijk:
Von Verdun zurückkehrend wie Jesus nach vierzig Tagen in der Wüste, wandte sich der Autor im Jahr 1931 an seine Zeitgenossen innerhalb und außerhalb der deutschen Sprachgrenzen, dann erneut im Jahre 1938, als Europa vorübergehend verloren war, an die anglophone Öffentlichkeit, um sie in seine verbindliche Vision von der Kohärenz der revolutionären Aufbrüche in weitere, freiere, reichere Weltentwürfe einzubeziehen.42
Mithin müsse „Rosenstock-Huessys Autobiographie des westlichen Menschen als ein Dokument der verzögerten Rückkehr aus dem Weltkrieg“ begriffen werden, als eine Art Feldpostbrief, der erst auf amerikanischem Boden zugestellt worden sei. Seitdem sei kein authentisches Leben mehr möglich, das nicht im Zeichen der Revolution stehe.
In seiner sprudelnd geläufigen Sprachakrobatik gibt Sloterdijk zu erkennen, daß er den tieflotenden Ansatz von Eugen Rosenstock-Huesy durchaus zu schätzen weiß. Mit „Out of Revolution“ und weiteren Hinweisen habe „der Autor das Recht erworben, sich nicht allein an die amerikanischen Leser von 1938, sondern auch an die Bürger des heutigen Europa zu wenden.”43 Neben glänzenden Einsichten stellt er ihm aber fatale historische Fehlurteile in Rechnung. Zum Teil habe er die brutale Entschlossenheit Adolf Hitlers zur Revolte gegen die Revolution unterschätzt und vor allem habe er die Russische Revolution zu lange aus Sicht seiner Revolutionstheorie wohlwollend begleitet, obwohl die Revolutionäre von Anfang an entschlossen gewesen seien, im „selbstlosen Kampf gegen das Bestehende“ „über Leichen“ zu gehen: „Der Verzicht auf privates Glück übersetzte sich bei Ihnen in beispiellose Begabungen zu politischer Grausamkeit.“44 Von den Sklavenlagern Trotzkis und dem nach 1930 gegründeten Gulag habe Rosenstock nichts gehört oder nichts hören wollen, obwohl er kein Apologet gewesen sei.
Rußland wird als die radikalste Revolution geschildert, die sich einerseits ihres Vorgängers in der Französischen Revolution bewußt war, die andererseits aber auch auf extrem disparate Voraussetzungen in einem Land traf mit „subtil demoralisierten Eliten“ und „grob demoralisierenden Lebenswirklichkeiten der Dörfer und Kleinstädte“.45 Dabei unterstellt Sloterdijk dem Autor, den Idealismus der russischen Revolutionäre überschätzt zu haben, ohne zu bedenken, daß er einige der Protagonisten persönlich aus Heidelberg oder Zürich kannte, wie etwa den in München hingerichteten Eugen Leviné.
Seinen Zuhörern deutete Peter Sloterdijk in Paris unverhohlen weitere Etappen der zugrundeliegenden historischen Konstellationen an: „Die herkömmliche Pflege der franco-russischen Freundschaft, ohne welche die französische Linke sich vormals kaum denken ließ, ist – seit Putins Willen zur Zerstörung der Ukraine sich offen gezeigt hat – zu einer Peinlichkeit geworden, für die sich nur noch wenige Akteure hergeben.“ Dabei erwähnt er Pierre de Gaulle, den Enkel des Generals sowie Emmanuel Todd, den Soziologen, der schon seit vielen Jahren den „Untergang der Neuen Welt“ gekommen sieht.46
Steht Lenin am Ende der Protagonisten der europäischen Revolutionen, so steht Gregor der VII. an ihrer Wiege. Gegen die Korruption der Stämme, Geschlechter und Sippschaften erhob er sein Forderung an den Kaiser „herabzusteigen“ und eine höhere Autorität als Herkunft und Blutsbande anzuerkennen. Für den von Eugen Rosenstock-Huessy geprägten Begriff der „Papstrevolution“ verweist Sloterdijk zurecht auf den Juristen Harold Joseph Berman und seine Forschungen zu „Recht und Revolution“, ohne zu erwähnen, daß dieser, bis zu seinem Tod 2007 in Harvard lehrende Professor in den 30er Jahren am Dartmouth College ein Schüler Rosenstocks war, der ihm auch bei seinen Studien des russischen Rechts in der UdSSR lebhaft unterstützte. Er galt als einer der „Polymaths of American Education“.47
Nach dem Startpunkt der Papstrevolution, die sich gegen die Korruption der Clans und Familienverbände auflehnte, bildeten den Mittelblock die drei Ereignisse, „durch welche sich Deutschland im 16. Jahrhundert, England im 17. Jahrhundert und Frankreich im 18. Jahrhundert in das revolutionäre Weltkulturerbe einbrachten.“48 Dabei seien es immer kleine avantgardistische Gruppen gewesen, die das Risiko auf sich nahmen, „den Umbruch“ zu wagen.49 Die kurze Liste der Revolutionäre führt von Gregor VII. zu Luther und geht weiter über Cromwell und Robespierre bis zu Lenin.
Die „radikale Promotion des Menschenwesens“, die mit den neuzeitlichen Revolutionen in die Welt gekommen sei, sei „bis heute weder in Asien noch in der arabo-muslimischen Welt und in den Nationen des Globalen Südens nachvollzogen, weswegen man man dort gern – um altehrwürdige Repressionen auf der Linie patriarchalischer Strukturen zu legitimieren – gern“ betone, „es gebe doch eine Mehrzahl von eigenständigen „Zivilisationen“. Daher sei das Pathos allgemeiner Menschenwürde und weiblicher Gleichberechtigung nicht mehr als ein eurozentrischer Spleen, dem Kredit zu geben man sich hüten werde.“50
Dabei wird das Christentum als Fundament der europäischen Revolutionen deutlich hervorgehoben, auch wenn Sloterdijk Einspruch gegen allzu geradlinige Kausalitäten erhebt. Das Christentum habe, angefangen bei der Übersetzung des Namen Jesu, über das Pfingstwunder, bis hin zum griechisch überlieferten Neuen Testament oder aramäischen Texten, besonders von ungenauen „Übersetzungen“ profitiert.
Es sei das große Verdienst von Eugen Rosenstock und seinen Freunden nach den Erschütterungen des Weltkriegs mit der jenseitigen Ausrichtung des Christentums, sei es in theologischer, metaphysischer oder ideologischer Maske gebrochen zu haben. In diesem Zusammenhang habe sich der Sieg des Imperiums über die Ecclesia als ein „religionsgeschichtliches Desaster“ erwiesen und zwar für alle die, denen es mit ihrem Glauben ernst war.51 Und fast überall hätten sich die Kirchen als Conciergerien der Machtstaaten erwiesen.52
Bei Rosenstock-Huessy klärte sich während der Nachkriegsjahre die Überzeugung, daß die Wahrheit, auf die es ankommt, nicht auf eine „andere Welt“ angewiesen ist. Sie speist sich aus Zukunft in unserer Welt. Die Vornehmen der kommenden Zeiten sollen sich nicht auf ihre Herkunft berufen; sie legitimieren sich durch ihre Zukunftsbereitschaft, getragen von der Hingabe an das Neue, das nottut.53
Mit dem Hinweis auf die Idee der notwendig gewordenen Pseudonymität christlicher Impulse rühren wir an das logische Zentrum von Rosenstock-Huessys damaligem und späterem Denken, bei dem „die Sprache des Menschengeschlechts“ und das Zusammenleben von Menschen unter dem antwortfordernden Druck einer mehrdimensionalen Wirklichkeit ins Zentrum rückte. Seine bedeutendste Intuition drückte sich in der Behauptung aus, wonach es künftig darauf ankomme, die Wahrheit unter den Bedingungen der Mehrsprachigkeit zu denken – einer Herausforderung, die mehr bedeutete als das friedlich-unfriedliche Nebeneinander nationaler und ethnischer Idiome.54
Der Begriff der „Vollzahl der Zeiten“, der auch eine Wiederkunft der Stämme, wenn auch in verwandelter Form bedeutet, hat Sloterdijk nicht rezipiert. Daher unterstellt er Rosenstock-Huessy „schweigende Skepsis“ zu dem „Kult um indigene Kulturen“, obwohl er bereit sei, ihnen zuzuhören.55
Obwohl Sloterdijk in seinem Fazit den eingetretenen Perspektivwechsel hervorhebt, daß Europa sich nicht mehr selbstsüchtig oder beschränkt selbst beschreibt, sondern zunehmend von außen beurteilt wird und daß dabei gerade die Schattenseiten der globalen Eroberungen des Planeten in Rechnung gestellt werden, entgeht ihm, dass schon Eugen Rosenstock-Huessy genau diesen Perspektivwechsel beschrieben hat, zuerst in der kleinen Broschüre Europa und die Christenheit, dann in seiner Hochzeit des Kriegs und der Revolution und schließlich in Out of Revolution. In jeder dieser Schriften wurde die Chronologie der Ereignisse um 180 Grad gedreht. Die jüngsten Ereignisse gehen voraus und das ursprünglichere Geschehen rückt nach hinten. Jeder „mittelalte“ Leser wird diesen Perspektivwechsel in seiner eigenen Biographie nachvollziehen können. Noch in den 80er Jahren waren die Lebensläufe traditionell bestimmt und begannen mit dem Elternhaus. Seit das „Business“ in alle Lebensbereiche eingesickert ist, bewirbt man sich vor allem und zuvorderst mit seinen letzten Erfolgen und neuesten Kompetenzen. Dabei hat sich Europa von Amerika überholen lassen, genau wie Eugen Rosenstock dies schon 1919 gesehen hat: Amerika holt über, mit dem „Kreuzzug des Sternenbanners“. Europa hat seinen Monopolanspruch schon längst beerdigen müssen. In seinem Fazit empfiehlt Peter Sloterdijk „Out of Revolution“ gerade auch in der Gegenwart steckengebliebenen Europäern als Medizin gegen „die besseren Engel“ in Brüssel, an die sich Zukunftsverantwortung so herrlich bequem delegieren läßt.56
Peter Sloterdijk, Der Kontinent ohne Eigenschaften. Leseteichen im Buch Europa, Berlin: Suhrkamp 2024.
Sven Bergmann
7. Wir brechen noch einmal auf: Das Vergangene wird erzählt - Zukünftiges verheißen - Die Gegenwart erstritten
Liebe Freunde, Liebe Freundinnen,
ich weiß, schon in Deutschland oder Europa verbindet uns ein Gefühl oder eine Ahnung davon, dass irgendetwas aus den Fugen geraten ist. Wir müssen nicht mehr in die Ferne schweifen. Wer allerdings in Brasilien an der Seite der indianischen Freunde steht, hat dergleichen Gefühle und Ahnungen nicht, weil mit der Tatsache konfrontiert, dass die Kultur der indigenen Völker vor dem Abgrund steht, und nur noch durch ein Wunder gerettet werden kann.
Der deutsche Reformator des 15./16. Jahrhunderts, der angesichts einer auseinanderbrechenden Welt von einem „Apfelbäumchen“ sprach, welches er selbst vor einem Untergang noch pflanzen würde, galt als überzeugt, dass wir dem Wunder, nicht dem Abgrund verpflichtet sind.
Am 31.10.2024 habe ich mit Lukas (s.u.) und Enoque Suruí noch einmal den Versuch gemacht, ein wenn auch nur kleines Projekt erneut als eine „Pflanzstätte der Hoffnung“ auf dem PAWENTIGA gegen die Untergangsstimmungen zu setzen. Wenn Euch dieses „Apfelbäumchen“ (Fachjargon: MICRO-PROJEKT) interessiert, dann bitte oben das Fenster, den Anhang öffnen!
Es ist alles bereit. Es fehlen nur noch „Regen und Segen“, wozu auch natürlich wieder ein Freundeskreis mit Spendern gehört. Wir schreiben Euch bereits in großer Eile. Schaut oben!
SUMMA: wegen etlicher Anfragen, „ob es weitergehe mit den Projekten auf dem Pawentiga“ 1. heute diese Nachricht von uns: es geht noch einmal einen Schritt weiter. Und hoffentlich noch einmal mit einer Anzahl hochmotivierter Spender/innen 2. Die zweite gute Nachricht: ich habe mit einem 23 Jahre jungen Deutsch-Brasilianer, in Lukas Bock Leão, einen Nachfolger gefunden: die nächste Generation ist an der Reihe! Wie das alles funktioniert, auch mit zukünftigen Spendeneinzahlungen, wird oben alles erklärt!
VAMOS – WIR WERDEN SEHEN!
Herzliche Grüße von Deutschland aus,
Euer/Ihr CLAUS Friese
8. Verrückte Ökonomie oder vielsprachiger Frieden
1940 veröffentlichte Eugen Rosenstock-Huessy ein „Common Vocabulary for teachers and students:
„Frieden: tägliches Erschaffen, tägliches Tun dessen, womit wir den Tod überwinden.
Leben: heutzutage gemeinhin behandelt, als gäb es den Tod nicht. Was nicht mehr und nicht weniger bedeutet als die Abschaffung des Gesetzes von Ursache und Wirkung, soweit es gesellschaftliche Vorgänge betrifft.
Krieg: das Ringen um Leben oder Tod zwischen mehr und weniger umfassend durchpulsendem Leben geht unaufhörlich weiter. Natur befindet sich im Zustand des Krieges. Kriege geschehen, wenn Menschen in den Naturzustand zurückfallen, weil sie nicht täglich den Frieden erschaffen. Dies sind meine „Friedensbedingungen“.
Niemand kann Hoffnung hegen, das erhellt daraus, unterhalb dieser Bedingungen den Rückfall in Kriegszustand auszumerzen, solange Menschen Menschen sind.“
… Da das Christentum die Taufe an den Anfang setzt und die Taufe in den Tod geschieht, und wie das vergessen ist - das ist ein Gradmesser für ihre friedenstiftende Kraft.“
Wieder sehnen wir uns nach Frieden und suchen Orientierung in unserer Zeit. Russland, Ukraine, Syrien, Gaza, Libanon, Israel, Sudan, … 55 Kriege derzeit. Einige Analysten sprechen vom Anfang des Dritten Weltkriegs. Andere reden von den Kämpfen am Ende eines Weltreiches unipolarer Ordnung zu einer multipolaren Ordnung.
Ich frage/höre Eugen Rosenstock-Huessy: Wie geht das: Täglich Frieden schaffen?\ 1940 – 1944 – 1948 sprach er als Amerikaner zu Amerikanern - und wurde nicht wirklich gehört. In drei Texten erkenne ich Eugen Rosenstock-Huessys Wahrnehmung 1) der Atlantischen Revolution und deren Herausforderung für die neue Führungsmacht Amerika; 2) die Bedingungen für einen Frieden zur Beendigung des Weltkrieges 3) das Scheitern Amerikas.
1)The Atlantic Revolution
1940 in dem Text The Atlantic Revolution analysiert er die Möglichkeiten auf einen amerikanischen Frieden. Den Hintergrund dieses Textes bildet sein epochales Werk Out of Revolution – Autobiography of Western Man. (1938) Ich halte diesen Text für prophetisch und referiere die m.E. wichtigsten Inhalte.
- ERH erkennt Amerikas Glauben darin, dass alle Menschen wandernde und sich bewegende sind und nicht in einen Teil des Raumes eingesperrt werden dürfen.
- Gleichzeitig packte aber Präsident Wilson mit seiner Vision für Europa die Europäer in die staatlichen „Kleider der vorindustriellen Ära“. Diese Vision habe das Schema der League of Nations bestimmt ,obwohl die US-Amerikaner es für sich nicht akzeptiert haben. Diese Vision zwang die Europäer in Bunker [Pill Boxes] gegeneinander. Ich nehme Wahr: Sie tut es bis heute weltweit. Sie spaltet die Völker: Divide et impera!
- Er fragt: Warum haben wir den Rest der Welt gefragt mit einem anderen Glauben zu leben als wir? ERH folgert: Die US-Eliten müssen anerkennen, dass sie nicht verschiedene Maßstäbe haben dürfen, einen großen für USA und einen kleinen für Europa. Ich ergänze heute: für die restliche Welt. ERH schließt sich William Blakes Urteil an: „Spaltung ist die Sünde der Menschen“ und fragt: Was können wir tun die Spaltung zu überwinden?
- Er benennt die große Häresie der Neuen Welt, dass sie ihren eigen Aufbruch in unendlichen Raum vergessen habe. Die Seele der Menschen aber komme vom Unendlichen ins endliche. Die Amerikaner haben also vergessen, dass sie auf der Suche nach ihrer Seele sind. Dies habe die mittelalte Generation anzuerkennen.
- Die Neuverteilung der neuen Kräfte der Natur und der Ressourcen sei die Linie der Weltrevolution. Eine hemisphärische Ökonomie wie Japan und Deutschland sie errichten könne es für USA nicht geben. Aber die Fruchtbarkeit wurde von der Ausbeutung verdrängt. Seit wir die Grenzen und die Maschinen haben, so stellt Rosenstock-Huessy fest, muß die Neuverteilung der Macht in Deiner und meiner Seele stattfinden. Das ICH muß Platz machen für das WIR und das DU planetenweit.
- Die vorhandenen US-Eliten sähen ihre Mission anders. Sie wollten die Werte der christlichen Zivilisation retten und meinten doch nur ihre nationale Ökonomie. Dagegen argumentiert ERH, dass Wir die Essenz der Offenbarung retten müssen für das ganze Menschengeschlecht. Der zentrale Glaube der Christenheit sei ihr Glauben an Tod und Auferstehung. Eine Bewahrung der Christenheit sei unmöglich, sei anti-christlich. Von freiwilliger mentaler Konversion und Auferstehung der Mittelklasse in USA hänge die Bewahrung der Christenheit dort ab.
- Die Atlantische Revolution kann noch -so glaubt ERH 1940 - als eine mentale Revolution in USA angenommen werden.
- Als Bedingung dafür sieht er die Notwendigkeit, dass die gebildeten Klassen des Westens glaubwürdig diese Werte gemeinsamen Lebens leben. Das bringe aber Leiden mit sich oder Zerstörung. Rosenstock-Huessy sieht dieses Leiden 1940 als not-wendende Reue für die letzten 30 Jahre Dekadenz, Zynismus, Entwurzelung, Friedenskampagnen und Alkoholverbot. Die Macht, so Rosenstock-Huessy, werde neuverteilt aus einem einfachen Grund, weil Macht die Pflicht zur langen Sicht ist.
- Dabei entdeckt er uns einen sehr aktuellen Grundsatz: „Der einzige Weg unsere Demokratie zu retten bestehe in der Anerkennung, daß Demokratie nicht religiös ist, sondern der säkulare Ausdruck, das endliche Mittel etwas unendlich Größeres auszudrücken.- „Wir müssen in der Politik den Unterschied zwischen unendlichem und Endlichem wiederherstellen. So lange wie Demokratie als Ersatz für die Christenheit behandelt wird, als Religion, sind ihre Mißbräuche garantiert.“ (15) Anmerkung: Die totale Kirchenkritik heute lenkt ab von dem Staat, der sich zur Religion macht und damit die Gewissensfreiheit zerstört und das Gespräch unter den Bürgern.
-
ERH nennt Immigration als spirituale Macht, die die reale Welt neuentdeckt, den gemeinsamen Nenner, der Amerika immun machen mag gegen Hitlers Plan einer Revolution die Rasse gegen Rasse, Klasse gegen Klasse und Sektion gegen Sektion setzt. Wie prophetisch für USA und für uns heute! Ich höre Freya von Moltke Wir müssen miteinander leben lernen!
- Er beschreibt den ersten Schritt dieser Immigration als Dienst an der Erde. Dies wäre unsere erste Anerkennung der Weltrevolution und ihrer Forderung nach Neuverteilung. Das Camp William James, dass er initiierte mit präsidialer Unterstützung, war eine Realisierung solchen Dienstes. Dabei gilt, dass ein Mensch jeden Tag in den großen Menschen immigriert, den wir durch wahre Rede formen. Dabei gilt auch, dass die Beziehungen zwischen Menschen ohne gleichzeitige Beziehungen zu den kleineren und den größeren Kräften, steril bleiben. Ich übersetze: Ohne gemeinsamen Glauben an gemeinsame Zukunft im wirklichen Leben bleiben wir unfruchtbar.
- ERH sieht am Ende dieses Textes, dass es nicht reicht zu sagen: „Ich bin nur ein Mensch!“ Er argumentiert, dass der Mensch, der nicht verantwortlich ist für etwas, oder verantwortlich jemand Größerem, verrückt oder töricht wird.
- Solange aber mutige re-immigration Amerika wiederentdecke, werde diese Hemisphäre sich sicher fühlen können. Dagegen bleiben Rassisten und Nationalisten, natürliche Menschen, die bei ihrer Erstgeburt ruhen und ihre Immigration zum Schweigen bringen, gefangen in gelegentlicher Beschäftigung und einer Nationalität.
- Er nennt Amerikas Glauben am Ende dieses Textes: „Wir sind keine Deserteure dieser Welt. Die grenzenlose Hoffnung, dass ein Mensch weder ein Klassenprodukt noch ein Rassenprodukt ist, das er nicht der Sklave seiner Unternehmungen ist, sondern jeden Tag etwas Neues kreiert, hat Millionen von Immigranten an diese Küsten geführt. Die ist ein unverzichtbarer Grundsatz im Glauben aller Menschheit.“
- Er zitiert die Worte eines jungen College Absolventen aus 1776: „Das schlechteste, was passieren kann ist auf dem letzten kalten ungeschützten Berg Amerikas zu fallen, und der der dort stirbt, in Verteidigung der Rechte der Menschheit, ist glücklicher als sein Eroberer. Es war und muss immer das Privileg von Lehrern und Studenten sein diesen amerikanischen Weg zum Leben zu beseelen als mutigen Akt durch den jeder junge Mann initiiert wird in die große amerikanische Gesellschaft der Zukunft.“
These: Eugen Rosenstock-Huessy schaut, dass Amerika die Führung übernimmt von den alten europäischen Mächten. Er sieht, dass die derzeitigen Eliten dazu nicht in der Lage sind. Er beschreibt was not-wendig ist in Amerika, um der Aufgabe gewachsen zu sein. Die Wahrheit des erdweiten Lebens muß von jedem Menschen verkörpert werden. Deshalb verlangt er von den Eliten, dass sie ihre Kinder zum Dienst an der Erde senden. Bevor nicht eine gewisse Zahl neuer Menschen da sei, hätte jeder Versuch keinen Sinn.
2) Mad economics or polyglot peace (1944)
4 Jahre nach dem Text The Atlantic Revolution, im Jahre 1944, fertigt Eugen Rosenstock-Huessy das Memorandum: Mad economic or polyglot peace. Er analysiert darin die Bedingungen eines Friedens. Es sei keine Pax Americana in Sicht aber er schlägt eine Lösung vor die die verschiedenen Interessen: militärisch geographisch, politisch-moralisch und ökonomisch-sozial der drei großen Mächte berücksichtigt. Ihre vitalen Interessen konkurrieren nicht.
- Rußland will nicht militärisch bedroht werden.
- England brauche die deutsche und europäische Ökonomie
- Amerika brauche die freien Institutionen.
Als Lösung schägt ERH vor, was er schon in der Hochzeit des Krieges und der Revolution 1920 vorbedacht hat: ‚Deutschland sei als Puffer-Ökonomie zu verfassen und solle zum Schutz der kleineren Nationen durch einen globalen Produktionsrat verwaltet werden. In einer pluralistischen Ökonomie der Ökonomien müsse es eine spezifische Behandlung erfahren. Nicht als Weltmacht, sondern als Weltorgan müsse es anerkannt werden.‘
Damit wäre ein anderer Weg als der in der Vision Wilsons vorgesehene zu beschreiten. Nicht die nationale Souveränität des 19.Jahrhunderts – jeder gegen jeden-, sondern Teil der planetarischen Ökonomie, aber ein besonderer Teil wie die anderen auch besondere Teile sind. Dieser Weg ist eine Absage an eine uniforme Ökonomie und auch eine Absage an einen Weltstaat, eine unipolare Ordnung. Das heisst: Militärische und ökonomische Macht müssen getrennt werden und bleiben. „Wirtschaft ist nicht Sache des Dogmas und erfordert eine multiforme, aus Experiment gewonnene Lösung. Deshalb die Forderung. Nach polyglottem [vielsprachigem] Frieden.“
Leider hat auch dieser Text nicht die breite Öffentlichkeit erreicht. Und leider ist Präsident Roosevelt im April 1945 gestorben. Sein Nachfolger Truman hat kein Verstehen und keine Kraft für diese gesellschaftliche Herausforderung gehabt. Er folgte als Erbe des englischen Imperiums dessen nationalimperialistischer Politik wie sie Mackinder schon Anfang des Jahrhunderts formulierte. Churchill hat schon 1945 gesagt, dass sie den Falschen besiegt haben. Hier schon zeigte er, dass mit dem Sieg über Hitlerdeutschland die Koalition zerfallen würde in die harte Konkurrenz und harten Antikommunismus. Mit der Atombombe auf Hiroshima hat Truman den nationalimperialistischen US Anspruch auf Weltherrschaft ausgedrückt.
3) Without the Cross there is no soul
Ein Gedicht ERHs(1948)
Without the Cross there is no soul
and Saul is not enough,
for, men are deaf. Deaf are they born
their talk remains a bluff.
When does the soul acquire her ear,
shake off her deafness hard?
When circumcised a heart can hear
its victim’s pains and smart.
…
The nameless world will never grow
nor can it growth allow.
In nameless urges, fears and wits
all words become a row.
The nameless world in which we move
makes upside down alike,
with no direction to approve,
no enemy to strike.
VIII
In 1948
the spirit once more died.
It is too late, too late, too late.
U.S. prefers the night.
Beachhead 1914-1948
Ich höre dieses Gedicht als Eugen Rosenstock-Huessys Fazit zu dem Weltkrieg 1914-1948 und der Atlantischen Revolution, das heisst zur Machtübernahme der USA. Dass er seinen Schüler Page Smith und andere aus dem Camp William James anspricht in den Versen, die ich Ihnen hier nicht zitiere, ändert m.E. nichts daran, daß der Verwandlungsprozeß nicht in Gang gebracht werden konnte, den Eugen Rosenstock-Huessy als notwendig erkannte für die Führung in der Welt in den mad economics. Polyglott Peace bedeutet, dass neben der Vielfalt in der Ökonomie, die Vielfalt der Reproduktion, also die Völker und Stämme befriedet werden müssen. Sie aber haben ein anderes Tempo als die industrielle Wirtschaft. Jeder Frieden muß ausdrücklich geschlossen werden. Es muß gemeinsame Sprache gefunden werden.
II.
1989 schien das Ende des kalten Krieges erreicht. Die Abrüstungsabkommen, die OECD, die Charta von Paris haben die Vereinigung Deutschlands ermöglicht.
Der Zusammenbruch der UDSSR 1991 wurde ganz verschieden erfahren und gedeutet. In den Ländern der ehemaligen UDSSR und des Warschauer Paktes erfuhren einerseits viele eine große Verarmung, Entrechtung, und das Aufkommen – vom Westen unterstützt – von Oligarchen, andererseits teilten wieder viele den vom Westen stammenden Traum der großen individuellen Freiheit.
In USA wurde der Zusammenbruch der UDSSR politisch verstanden als Befreiung von den Versprechen, die man Gorbatschow gegeben hatte und als Möglichkeit Rußland kleinzuhalten und seine Rohstoffe auszubeuten. Ihr könnt das nachlesen bei Brezinski, dem außenpolitischen Berater in dieser Zeit. [ Titel The Grand Chessboard ] Damals begann erneut die Realisierung der Einkreisung Rußlands und der Dämonisierung in den Medien. George Kennan, Jack Matlock, der letzte US Diplomat im sowjetischen Moskau, haben deutlich gewarnt wohin das führt:
George Kennan - Dean of US Sovietologists: 1981
„I find the view of the Soviet Union that prevails today in large portions of our governmental and journalistic establishments so extreme, so subjective, so far removed from what any sober scrutiny of external reality would reveal, that is not only ineffective but dangerous as a guide to political action.
“This endless series of distortions and oversimplifications; this systematic dehumanization of the leadership of another great country; this routine exaggeration of Moscow’s military capabilities and of the supposed iniquity of Soviet intentions; this monotonous misrepresentation of the nature and the attitudes of another great people…; this ignoring of their pride, their hopes – yes, even their illusions ( for they have their illusions, just as we have ours; and illusions, too, deserve respect); this reckless application of the double standard to the judgement of Soviet conduct and our own; this failure to recognize, finally, the communality of many of their problems and ours as we both move inexorably into the modern technological age; and this corresponding tendency to view all aspects of the relationship in terms of a supposed total and irreconcilable conflict of concerns and of aims: these, believe me, are not the marks of the maturity and discrimination one expects of the diplomacy of a great power; they are the marks of an intellectual primitivism und naivety unpardonable in a great government. I use the word naivety, because there is a naivety of cynicism and suspicion just as there is a naivety of innocence…
“If we insist the innocence on demonizing these Soviet leaders – on viewing them as total and incorrigible enemies, consumed only with their fear or hatred of us and dedicated to nothing other than our destruction – that, in the end, is the way we shall assuredly have them, if for no other reason than that our view of them allows for nothing else, either for them or for us.”
“For all their historical and ideological differences, these two peoples – the Russians and the Americans – complement each other; they need each other; they can enrich each other; together, granted the requisite insight and restraint, they can do more than any other two powers to assure world peace.” – 1983
Unser Mitglied Clinton Gardner hat das von ihm herausgegebene Buch: Building Bridges US : USSR -A Handbook for Citizen Diplomacy (1989 Argo Books) George Kennan gewidmet. Daraus sind die Zitate von Kennan.
In Washington haben Leute wie Herr Wolfowitz und Herr Brezinski, den Kennan 1997 noch einmal hart kritisierte, der von Kennan oben kritisierten Politik wieder zum Durchbruch bis heute verholfen. In der aktuellen Situation findet man sie als strategischer Plan in der 2019 veröffentlichten Studie der RAND Corporation wieder [RAND_RR3063 zu finden auf der website]. Sie hat den Titel „EXTENDING RUSSIA Competing from Advantageous Ground.” Ich übersetze: Rußland überdehnen/schwächen – Konkurrieren von überlegenem Grund.
Auf 354 Seiten wird in aller Ausführlichkeit beschrieben wie USA nach Ansicht der Autoren und Autorinnen Rußland sich unterwerfen kann und soll. Dazu gehören sowohl Spaltungen der russischen Gesellschaft, Einkreisung durch militärische Standorte, Regime Change Projekte in Ukraine, Syrien, Belarus, Moldavien, Georgien, Süd Kaukasus und Verringerung des russischen Einflusses in Zentral Asien. Gerne sende ich Ihnen das Inhaltsverzeichnis dieser Studie, dieses Reports.
All diese Maßnahmen in dem Report dienen ausdrücklich der Provokation Rußlands, dem der Report bescheinigt, dass es keine imperialen Absichten habe. Letzteres hat auch die Bundesregierung in einer Bundespressekonferenz 2024 im September ausgesagt. Das ausgewählte Feld für eine militärische Auseinandersetzung ist die erste empfohlene Maßnahme: Provide Lethal Aide to Ukraine (s.96) deutsch: Versorge die Ukraine mit tödlicher Hilfe.
Wer diesen Report liest, erkennt dass die US Regierung und ihre Verbündeten ihm gefolgt sind in ihren Entscheidungen, in ihren Taten. Das gilt sowohl für den Stellvertreterkrieg in der Ukraine, für Syrien (schon seit 2011 Timber sycamore)), Moldawien, als auch für Georgien – ganz aktuell - , jetzt auch Rumänien.
Ich empfehle die Lektüre dieses Reports und der weiteren Reports der RAND Corporation während des Kriegs in der Ukraine. Ich denke dabei an Eugen Rosenstock-Huessys Votum: “Relations between human beings without simultaneous relations to the inferior and the superior forces remain sterile!” (The Atlantic Revolution)
Freya von Moltke hat in ausdrücklicher Erinnerung an Eugen testiert: „Die Epochenaufgabe sei, miteinander leben zu lernen auf dem Planeten!“ Dringlicher denn je erscheint mir die Erfüllung dieser Aufgabe, indem bewußt Schüler aus verschiedenen Schulformen und verschiedener Herkünfte einen gemeinsamen Dienst an der Erde während ihrer Schulzeit absolvieren. Gerade haben wir Bobbies – Männer zwischen Mitte 50 und 80 Jahren - eine mobile Klinik für Madagaskar in Zusammenarbeit mit der Deichmann Stiftung gebaut. Zwei von uns haben sie in Madagaskar mit den Empfängern und Nutzern betriebsfähig gemacht. Das macht Sinn! Das ist ein Lebenshöhepunkt und stiftet neue Gemeinschaft, neues Vertrauen. Dann wurde erfahrbar, daß wir Resourcen teilen müssen und teilen können.
Ermutigend im Sinne der Perspektive Eugen Rosenstock Huessys finde ich die BRICS + Initiative, in der sich schon fast die Hälfte der weltwirtschaftlichen Produktion und mehr als die Hälfte der Bevölkerung der Erde sammelt. Sie sammeln sich ausdrücklich nicht gegen den Westen, aber betonen das es auch ohne den Westen geht. Ich empfehle dazu die Lektüre des Joint Statement von Putin und Xi Ping vom Februar 2022.
Zum Abschluß gebe ich Ihnen an ein musikalisches Bild, das Jakob J. Petuchowski, weltweit der erste Lehrstuhlinhaber für christlich-jüdische Studien an einem jüdischen Rabbinerseminar, einmal im Blick auf die verschiedenen Glaubenslehren und religiösen Formen gebraucht hat. Es gilt auch für die verschiedenen Völker: „Gott hat uns nicht dazu angehalten, irgendein Instrument des ihm ein “Hallelujah” spielenden Symphonie-Orchesters der Weltreligionen auszuschalten oder zwei verschiedene Instrumente identische Töne hervorbringen zu lassen. Dennoch aber wäre es wünschenswert, daß sich die Instrumentalisten bewußt werden, daß sie, trotz aller Verschiedenheit der Töne, immerhin im selben Orchester die gleiche Symphonie spielen.“ (ders Hg.: Offenbarung im jüdischen und christlichen Glaubensverständnis, 1981,s.185)
Ich wünsche Ihnen eine gute Adventszeit
Thomas Dreessen
9. Vormerken der Jahrestagung 17.10. - 19.10.2025
Liebe Mitglieder, Freunde und Interessierte, bitte merken Sie sich den Termin der Jahrestagung 2025 vom 17.10 - 19.10 im Haus am Turm, Essen vor. Das Thema werden wir Ihnen in einem der nächsten Mitteilungen bekanntgeben.
Jürgen Müller
10. Adressenänderungen
Bitte senden sie eine eventuelle Adressenänderung schriftlich oder per E-mail an Thomas Dreessen (s. u.), er führt die Adressenliste. Alle Mitglieder und Korrespondenten, die diesen Brief mit gewöhnlicher Post bekommen, möchten wir bitten, uns soweit vorhanden, ihre Email-Adresse mitzuteilen.
Thomas Dreessen
11. Hinweis zum Postversand
Der Rundbrief der Eugen Rosenstock-Huessy Gesellschaft wird als Postsendung nur an Mitglieder verschickt. Nicht-Mitglieder erhalten den Rundbrief gegen Erstattung der Druck- und Versandkosten in Höhe von € 20 p.a. Der Versand per e-Mail bleibt unberührt.
Thomas Dreessen
-
Markus 1,11 ↩
-
1 Mose 37,10 ↩
-
Matthäus 2,3 ↩
-
Apostelgeschichte 8:1. ↩
-
Matthäus 5,18 ↩
-
Daniel 10:15 ↩
-
Apostelgeschichte 15 ↩
-
Apostelgeschichte 23:6; 24:21 ↩
-
Apostelgeschichte 15:21 ↩
-
Matthäus 24:15 ↩
-
Lukas 21:20 ↩
-
Die Frucht der Lippen, in Rosenstock-Huessy, E 1963. Die Sprache des Menschengeschlechts, Bd. I en II, Verlag Lambert Schneider, Heidelberg, pp. 796-904. Raymond Huessy hat auch eine Ausgabe mit einer ausführlichen Einführung und mit den verschiedenen Versionen dieses Textes herausgegeben, in The Fruit of Our Lips – The Transformation of God’s Word into the Speech of Mankind, Eugen Rosenstock-Huessy, Wipf & Stock, Eugene, Oregon, 2021. ↩
-
Robinson, John A.T., 2000. Redating the New Testament, Wipf & Stock, Eugene, Oregon, Original SCM Press, 1976. ↩
-
Farmer, William R., 1964. The Synoptic Problem – a critical review of the problem of the literary relationships between Matthew, Mark, and Luke”, McMillan, New York. ↩
-
Bauckham, Richard, 2006 Jesus and the Eyewitnesses – The Gospels as Eyewitness Testimony, Eerdmans, Grand Rapids, Michigan. ↩
-
Plokhy, S., 2015. The Gates of Europe; a History of Ukraine, Basic Books, New York, 318. Amerikanische Kommentatoren nannten dies seine „Chicken Kyjiv speech“. ↩
-
Hryzak, Y., 2023. Ukraine - The Forging of a Nation, Sphere, London. ↩
-
Plokhy 247. ↩
-
Androechoveych, J., 2022., Die ukrainische Kultur und Literatur, in Ukraine - Geschiedenissen en Verhalen, ISVW Publishers, Leusden, 57 - 81. ↩
-
Snyder, T., 1918. The road to unfreedom, Russia, Europe, America, Crown, Tim Duggan Books. ↩
-
Rosenstock-Huessy, E., 1940. Die Atlantische Revolution, unveröffentlichtes Papier, https://www.erhfund.org/ ↩
-
Rosenstock-Huessy, E. 1924. Vom Industrierecht, Rechtssystematische Fragen, Sack, Berlin, Breslau, 38. ↩
-
Rosenstock-Huessy, E., 1956, 1958. Soziologie I, II, Stuttgart, Kohlhammer. ↩
-
Hrytsak weist auch auf den Zusammenhang zwischen der Entdeckung Amerikas und der Entwicklung der Ukraine hin. Nach der Entdeckung Amerikas durch Kolumbus im Jahr 1492 und der anschließenden Eroberung des Kontinents durch die Spanier sank der Silberpreis in Europa drastisch. Dadurch wurde es für die ukrainischen Bauern lukrativ, Getreide für den europäischen Markt anzubauen, Hrytsak 92ff. ↩
-
Chruschtschow und Breschnew gingen beide aus dem ukrainischen Parteiapparat hervor und brachten ihr Patronagenetz aus der Ukraine in den Kreml, aber dasselbe Patronagenetz half immer auch im Stillen der ukrainischen Sache - so Plokhy 297. ↩
-
Plokhy 304. ↩
-
Hrytsak, 323. ↩
-
Kroesen, J. Otto, Darson, R., Ndegwah J. David, 2020. Cross-cultural Entrepreneurship and Social Transformation: Innovative Capacity in the Global South, Lambert, Saarbrücken. ↩
-
Plokhy 247. ↩
-
Zum Vergleich: Der niederländische Schriftsteller Louis Couperus schrieb 1901 ein Buch mit dem Titel „De Stille Kracht“. Damit meinte er, dass die niederländischen Machthaber schon damals spüren konnten, dass die Indonesier genug von ihnen hatten. Die Machtverhältnisse waren immer vorhanden, und sie wurden auch von den Indonesiern respektiert, aber die Menschen spürten diese stille Gewalt. In ähnlicher Weise hebt Plokhy die Unterströmung hervor, die in der Ukraine immer vorhanden war, die Unterströmung eines Volkes, das die Fremdherrschaft abschütteln wollte. Die Geschichte der ukrainischen Bauern ist die Geschichte einer Bürgerschaft zweiter Klasse, aus der sie sich zu befreien versuchen. ↩
-
Hrytsak 230. ↩
-
Hrytsak 329, siehe auch Hrytsak, Y., 2024, The third Ukraine: A case of civic nationalism, in Philosophy and Social Criticism, Vol. 50(4) 674-687. ↩
-
Kravtschuk war 1990 der populärste Führer in der Ukraine - es gelang ihm, die Oppositionsbewegung und die national orientierten Kommunisten im Parlament zu vereinen, Plokhy 316. ↩
-
Rosenstock-Huessy, E., 1989. Die Europäischen Revolutionen und der Charakter der Nationen, Moers, Brendow (Orig. 1931, bearbeitet 1951). ↩
-
Hrytsak, 115. ↩
-
Immerhin dieses Manko ist nun schon seit vielen Jahren behoben. ↩
-
Man wird kaum fehl gehen, wenn man die Verbreitung von Spenglers Zeitansage in Parallele mit der Einschätzung vom „Ende der Geschichte“ nach 1989 sieht. ↩
-
Peter Sloterdijk, Der Kontinent ohne Eigenschaften. Leseteichen im Buch Europa, Berlin: Suhrkamp 2024, S.151. ↩
-
ebd. S.106. ↩
-
ebd. S.118. ↩
-
ebd. S.119. ↩
-
ebd. S.139. ↩
-
ebd. S.125. ↩
-
ebd. S.123. ↩
-
Emmanuel Todd, Der Westen im Niedergang. Ökonomie, Kultur und Religion im freien Fall, Neu-Isenburg: Westend Verlag 2024. ↩
-
Zitat nach Wikipedia. ↩
-
Peter Sloterdijk, Der Kontinent ohne Eigenschaften. Leseteichen im Buch Europa, Berlin: Suhrkamp 2024, S.131. ↩
-
Hier verweist Sloterdijk auf die aktuellen Forschungen von Bruno Karsenti über „pivot elites“ aus Gesprächen mit Bruno Latour, denen Rosenstock-Huessy schon vor Jahrzehnten vorausgegangen war. ↩
-
Peter Sloterdijk, Der Kontinent ohne Eigenschaften. Leseteichen im Buch Europa, Berlin: Suhrkamp 2024, S.137. ↩
-
ebd. S.111. ↩
-
ebd. S.112. ↩
-
ebd. S.118f. ↩
-
ebd. S.114. ↩
-
ebd. S.138. ↩
-
ebd. S.139. ↩