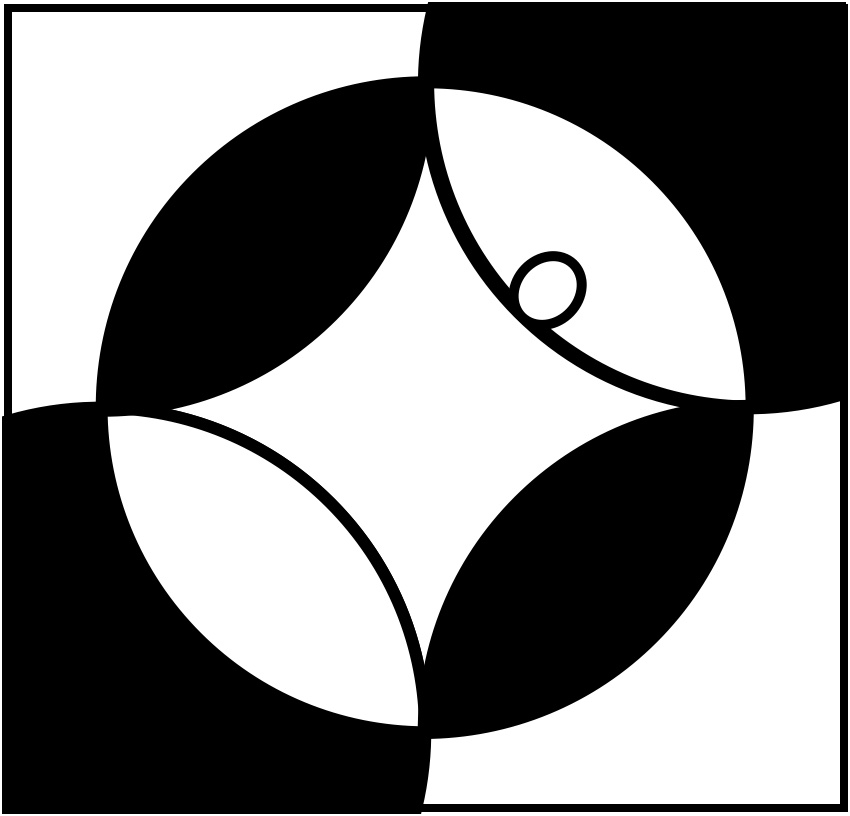Wolfgang Ullmann: Die Entdeckung des Neuen Denkens
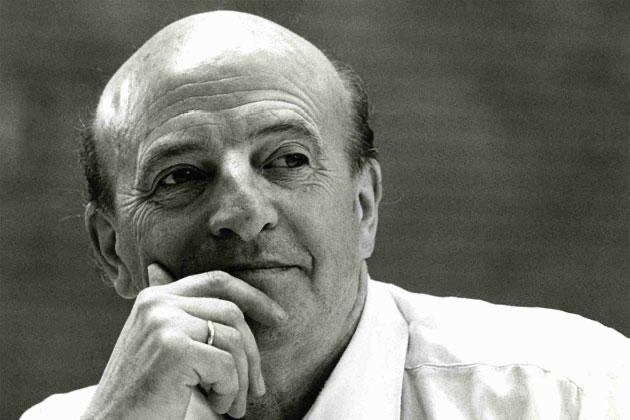
Das Leipziger Religionsgespräch und der Briefwechsel über Judentum und Christentum zwischen Eugen Rosenstock und Franz Rosenzweig
Vorbemerkung: Seitenangaben beziehen sich auf die Schockenausgabe der Briefe Rosenzweigs, Berlin 1935 und die seiner Kleinen Schriften, Berlin 1937.
Unter dem Titel »Das neue Denken«« hat Rosenzweig in seinem 1925 geschriebenen Nachwort zum »Stern der Erlösung«« eigentlich alles mitgeteilt, was man zum Verständnis der Anfänge des neuen Denkens wissen muß. Trotzdem erscheint es nach wie vor nicht als eine Übertreibung, wenn man feststellt, daß für die Einordnung dieses Neuansatzes in die Philosophie- und Theologiegeschichte unseres Jahrhunderts das meiste noch getan werden muß.
Mir scheint, daß diese Situation zwei Ursachen hat: die Unklarheit über das Verhältnis von Rosenzweig zu Rosenstock während dieser Anfänge und den ebenso offenkundigen Mangel einer klaren Inhaltsbestimmung dessen, was wir mit Rosenzweig das neue Denken nennen wollen. Leider ist dieser selbst bei seinem Versuch, am Ende des obengenannten Nachwortes diesen Inhalt terminologisch zu fassen, nicht sehr glücklich gewesen, wie unten gezeigt werden soll.
Unser Beitrag unternimmt jetzt den Versuch, eine Klärung dadurch zu fördern, daß der Ablauf des für den Durchbruch des neuen Denkens so wichtigen Leipziger Religionsgespräches vom 7. 7. 1913 zwischen Rosenstock, Rosenzweig und Rudolf Ehrenberg rekonstruiert und danach gefragt wird, in welchem Verhältnis der Kriegsbriefwechsel zwischen Rosenstock und Rosenzweig zu jenem steht. Abschließend wollen wir andeuten, welches Licht von unseren Ergebnissen auf die weitere Entwicklung der beiden Autoren fällt. Und um mögliche falsche Erwartungen von vornherein auszuschließen: Die leitende Frage wird für uns nicht die nach der Priorität oder Originalität der Partner, also die biographische, sondern die der sachlichen Inhalte und ihrer historischen Relevanz sein. Natürlich kann das keineswegs heißen, vom Biographischen zu abstrahieren. Schon deswegen nicht, weil es eines der Charakteristika des neuen Denkens ist, eine solche Abstraktion als Mangel wissenschaftlicher Präzision zu bewerten.
Dieser Aufgabenstellung folgend, beginnen wir damit, das Faktum zu würdigen, daß das neue Denken im Dialog entstanden ist und für diesen Dialog darum eine entsprechende Position in der Religions- und Philosophiegeschichte unserer Zeit beansprucht werden muß.
1. Das Leipziger Gespräch
Das Leipziger Gespräch als Datum der neuzeitlichen Religionsgeschichte
Unter den wenigen philosophischen Gesprächen, deren religionsgeschichtliche Bedeutung dem Dialog Diotima — Sokrates in Platons Symposion an die Seite gesetzt werden kann, steht das zwischen Jacobi und Lessing im Sommer 1780 geführte gewiß an erster Stelle. Denn hier fallen die Worte Lessings, die eine ganze Epoche bürgerlicher Religionsgeschichte in Europa charakterisieren: »Die orthodoxen Begriffe von der Gottheit sind nicht mehr für mich, ich kann sie nicht genießen. Hen kai pan — Ich weiß nichts anderes.« (Die Hauptschriften zum Pantheismusstreit, hgg. von H. Scholz, Berlin 1916, 77).
Goethe hat an bedeutsamer Stelle in Dichtung und Wahrheit (Teil 3, Buch 15) das Ereignis des Bekanntwerdens dieser Worte festgehalten, und durch das Religionsgespräch Gretchen- Faust wurden sie Allgemeingut der gebildeten Welt in eben jener Epoche, die wir mit Rosenstocks Ausdruck (Briefe 639) als die der Philosophiegläubigkeit charakterisieren wollen. Philosophiegläubigkeit als Ausdruck der Überzeugung, daß Religion lediglich eine historisch bedingte Durchgangsstufe zum Welt- und Wirklichkeitsbewußtsein der Philosophie sei. Am konsequentesten kam dies in Hegels Systematik dadurch zum Ausdruck, daß Religion freilich die zweithöchste, aber eben doch nur die vorletzte Stufe auf dem Weg des objektiven zum absoluten Geiste innehaben konnte.
Aber auch die Theologie trug dem Rechnung, indem sie sich grundsätzlich als eine Wissenschaft der Vermittlung empfahl. So etwa, wenn Schleiermacher sich darum bemühte, eine Art Zweireichelehre im Denken zu etablieren. In ihr umfaßt die Fundamentaldisziplin der Dialektik auch die Gotteslehre. Die Theologie hingegen ist kein Bestandteil der Systematik der Erkenntnis im strengen Sinne des Wortes, sondern nur noch methodische Organisation einer kirchlichen Praxis, welche die Eigenständigkeit der Religion auch gegenüber den Ansprüchen der spekulativen Philosophie zu verteidigen hat.
Wir sehen die Bedeutung des Leipziger Religionsgespräches zwischen Rosenstock, Rosenzweig und Rudolf Ehrenberg darin, daß es erstmalig in die Zukunft einer Epoche vorausweist, in der die Gleichung von Gott und Natur, wie sie seit dem 18. Jahrhundert die Religiosität der führenden Gesellschaftsschichten bestimmt hatte, in den Hintergrund trat gegenüber einem Wirklichkeitsbewußtsein, dem die Differenz von Gott, Mensch und Welt in einer ganz neuen Weise evident geworden war. Für Philosophie und Theologie hieß das, daß auch sie in ein ganz neues Verhältnis zueinander zu treten hatten, nämlich das einer Koordination und Kooperation, welche Beziehungslosigkeit ebenso wie Konkurrenz um die Führung der Gesellschaft, den Streit um die Überordnung der einen über die andere, nicht nur hinfällig werden läßt, sondern schlechterdings ausschließt.
Derjenige, der dieses Gespräch und seinen Inhalt zu rekonstruieren versucht, sieht sich freilich in einer sehr viel ungünstigeren Lage als im Falle des Jacobi-Lessinggespräches, wo wir ein Protokoll von einem der Teilnehmer besitzen. Über Leipzig dagegen sind uns lediglich nachträgliche Reflexionen zweier Teilnehmer in Briefen, Tagebüchern und späteren Publikationen überliefert. Freilich hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten die Quellenlage in verschiedener Hinsicht verbessert. In den Jahren 1968 und 1969 erschienen autobiographische Fragmente von Rosenstock unter den Titeln »Ja und Nein« und »Judaism Despite Christianity«. Und trotz ihrer teilweise wenig überzeugenden Editionsprinzipien hat die neue holländische Ausgabe der Briefe und Tagebücher Rosenzweigs (Den Haag 1979) unsere Quellenbasis wesentlich verbreitert.
Wir erwähnen hier dankbar zwei Autoren, die, aufbauend auf der neuen Quellengrundlage, eine ganze Reihe wichtiger Informationen über das Leipziger Religionsgespräch beigebracht haben. Ich spreche von den Artikeln von H.-G. Bloth, Was geschah im Leipziger Nachtgespräch am 7. 7. 1913? (Mitteilungsblätter der Rosenstockgesellschaft 1982, 2—14) und von Harold M. Stahmer, Speech letters and Speech thinking (Modern Judaism, 4/1, 1974, 57—82, deutsch BThZ 3/2, 1986, 307—329).
Fast noch wichtiger als die erwähnten Neuinformationen aber ist es, daß beide Abhandlungen bestätigen: Hauptquelle für unser Wissen um das Leipziger Gespräch sind nach wie vor die schon 1935 und 1937 publizierten Briefe Rosenzweigs. Unter ihnen wiederum sind es zwei Briefe, die an Bedeutung alle anderen überragen, der an die Mutter von 23. 10. 1913 und der an Rudolf Ehrenberg vom 31. Oktober 1913.
Überblickt man diese Quellenlage samt dem skizzierten Forschungsstand, so springen zwei Desiderate in die Augen. Ganz und gar im Dunkeln liegt bisher der Anteil des dritten Gesprächpartners, des Mediziners und Biologen Rudolf Ehrenberg. Und wie wir bald sehen werden, hat gerade er, der Naturwissenschaftler, für die theologische Konstellation des Gespräches Erhebliches bedeutet. Wir aber wollen uns der eingangs geäußerten Zielsetzung entsprechend dem anderen Desiderat zuwenden und nach den philosophischen Voraussetzungen und dem philosophischen Inhalt des Leipziger Gespräches fragen.
Mit dem Hinweis auf die Spinozismusdiskussion zwischen Jacobi und Lessing beabsichtigen wir nicht nur einen Maßstab aufzurichten, an dem die Größenordnung und Bedeutung des Leipziger Gespräches abzulesen sei. Es geht auch darum, in Leipzig ein Gegenstück zu jener Epoche zu sehen, in welcher Philosophie eine ihrer Hauptaufgaben im Beerben von Theologie und Religion sah, so, wenn sie mit Hegel beides integrierte in die Bewußtseinsstufe des absoluten Geistes, mit David Friedrich Strauß von dieser Bewußtseinshöhe aus es unternahm, Mythos und Geschichte ein für allemal zu scheiden, um dann mit Feuerbach Theologie auf Anthropologie und Religion auf die Selbstversöhnung des Menschen mit der Natur zu reduzieren.
Die drei Freunde sehen sich, jeder von den Voraussetzungen seiner eigenen wissenschaftlichen Arbeit aus, mit der Frage konfrontiert: Wohin ist menschliches Erkennen mit dieser Beerbung gelangt? Aber damit haben wir bereits den nächsten Arbeitsgang eröffnet.
Positionen der Teilnehmer, Verlauf und Inhalt des Gespräches
Stattgefunden hat das Gespräch nachmittags, abends und nachts am 7. Juli 1913 im Haus von Victor Ehrenberg, des Historikers und Autors vielzitierter Monographien zur Geschichte des Hellenismus, des Vaters von Rudolf Ehrenberg, dessen Anteil am Gespräch am wenigstens bekannt, aber offenbar viel wichtiger ist, als die bisherige Literatur voraussetzt.
Rosenzweig trat in dieses Gespräch ein mitten in einer Zeit biographischen und philosophischen Umbruches. Er beschäftigte sich mit einer Dissertation über Hegel, deren Zweck es war, die von Rosenzweigs Lehrer Meinecke im 11. Kapitel seines Buches «Weltbürgertum und Nationalstaat« 1907 aufgeworfenen Fragen nach der Rolle Hegels in der Geschichte der deutschen Nationalstaatsidee zu beantworten.
Was das Philosophische anlangt, so handelte es sich um mehr als persönliche Vorgänge. Es ist hier zu sprechen von einer Krise in der südwestdeutschen Schule des Neukantianismus. Ausgelöst worden war sie von Hans Ehrenberg und Rosenzweig gemeinsam durch das von ihnen aufgestellte sogenannte Baden-Badener-Programm. Der Plan einer Philosophischen Vereinigung, die eine dem 20. Jahrhundert und seinen Inhalten zugewandte Philosophie auf die Bahn bringen und befördern sollte. Von Rosenzweig selber hören wir, daß soziale Idee, historische Weltansicht, Nationalismus, Realismus der Arbeit den Inhalt dieses Programms bilden sollte (Briefe 51). Einen anderen Aspekt der geplanten philosophischen Neuorientierung repräsentiert der 1911 erschienene merkwürdige Text von Hans Ehrenberg »Die Geschichte des Menschen unserer Zeit«, ein Stück änigmatischer philosophischer Prosa, das man wohl am ehesten als den Entwurf einer Anthropologie nach Nietzsche und als eine Kampfansage gegen den damals herrschenden Jugendstil der Lebensphilosophie auffassen kann.
Überhaupt läßt sich das Baden-Badener-Programm als Manifest im Interesse einer neuen Sachlichkeit im Bereich der Philosophie verstehen. Aber eben dieser Ton einer neuen Sachlichkeit wohl war es, der nach einem programmatisch gemeinten Vortrag von Rosenzweig über das 18., 19. und 20. Jahrhundert die Opposition der anderen Meineckeschüler auf den Plan rief, an der das Baden-Badener-Programm schließlich scheitern sollte. So jedenfalls berichtet Viktor von Weizsäcker in seiner Autobiographie (Natur und Geist, Göttingen 1955, 26).
Nicht zuletzt die hier zutage getretene Entfremdung und Isolation unter den Meinecke- und Rickertschülern ist es gewesen, die Rosenzweig enger mit dem Juristen Eugen Rosenstock zusammengeführt hat. Er trat damit in jenen Kreis, den Rosenstock im Vorwort zu seiner großen verfassungsgeschichtlichen Monographie »Königshaus und Stämme«, Leipzig 1914, als «Leipziger Eranos« apostrophiert hat. Man vergißt es angesichts dieser Konstellation immer wieder: Rosenstock war der jüngere der beiden Freunde, in der akademischen Karriere freilich der erfolgreichere. Er lehrte damals bereits als Privatdozent in Leipzig und galt im Bereich des mittelalterlichen Verfassungsrechtes als ein so hervorragender Sachkenner, daß eine Autorität wie Rudolf Sohm sich in seinem Spätwerk über das Decretum Gratiani auf den jungen Rosenstock berufen konnte.
Rosenstocks vom akademischen Durchschnitt weit entfernte Position war schon recht deutlich offenbar geworden in seiner Studie über das mittelalterliche Magdeburger Recht unter dem Titel »Ostfalens Rechtsliteratur unter Friedrich II«, Weimar 1912. Stand das Baden-Badener- Programm durch seinen Realismus in deutlicher Opposition gegen den Historismus der Meinecke und Rickert, so in weitaus stärkerem Maße Rosenstocks Grundauffassungen über Sprache und Recht. Hatte er doch schon 1912 Savignys Gedanken einer Grammatik des Rechts verallgemeinert zur Erkenntnis der bewußtseinsbestimmenden Kraft von Recht und Sprache. Und dies wiederum ermöglichte ihm eine Analyse von mittelalterlichen Rechtsquellen als Zeugnissen einer zeitangemessenen Wissenschaftssprache, die mit ihrer Umwertung der Renaissance zu einer typisch mittelalterlichen Denkform, basierend auf dem statischen Offenbarungsverständnis jener Epoche wie ein erratischer Block in der damaligen mediävistischen Literatur dasteht (Ostfalens Rechtsliteratur, 136 f.).
So also die Arbeitssituation, aus der heraus die beiden Freunde in das sie so tief verändernde Gespräch jenes Julinachmittags eintraten. Aber die beiden geschilderten Positionen reichen noch nicht aus, um das zu erklären, was in jener Leipziger Diskussion geschah. Stellen sie doch nur zwei Stadien von Impulsen vor uns hin, aus dem Bannkreis des Historismus auszubrechen, durch einen neuen historisch konkretisierten Realismus (Rosenzweig) und durch einen verallgemeinerten Begriff von Sprachgeschichte (Rosenstock). Es mußte noch eine Tendenz hinzukommen, ein Gesprächsanstoß über Philosophie und Historie hinaus aus dem Bereich des Religiösen: Die Erfahrung des Tragischen in der Geschichte. Unter dem 28. 9. 1912 teilt Rosenzweig Gertrud Oppenheim mit, er arbeite intensiv am Konzept einer Monographie »Der Held. Eine Geschichte der tragischen Individualität in Deutschland seit Lessing« (Briefe 70). In welcher Weise sich hier ein Zusammenhang mit Rosenzweigs Geschichtsverständnis ergibt, zeigen Tagebuchaufzeichnungen. In ihnen versucht Franz Rosenzweig, die Religiosität des 20. Jahrhunderts von der des 19. Jahrhunderts abzuheben. «Wir betonen das Praktische, den Sündenfall, die Geschichte« (Briefe 55). Die Lehre von der Offenbarung nimmt dabei eine konsequent dualistische Gestalt an. «Wir sehen Gott in jedem ethischen Geschehen, aber nicht in dem fertigen Ganzen, in der Geschichte . . . Nein, jede Tat wird sündig, wenn sie in die Geschichte tritt . . . und deshalb muß Gott den Menschen erlösen, nicht durch die Geschichte, sondern wirklich … als Gott in der Religion« (a. a. 0. 55).
Den Anlaß zur Erörterung solcher Gedanken im Leipziger Gespräch gab Selma I.agerlöfs Roman «Die Wunder des Antichrist«. Besonders sein Schluß hatte die Freunde gefesselt, wo der alte Papst im Gespräch mit Gott sagt: «Niemand kann die Menschen von ihren Leiden befreien, aber denen wird viel vergeben werden, der ihnen wieder neuen Mut macht, ihre Leiden zu tragen.« Nach Rosenstocks späterem Bericht hat sich das Gespräch besonders an dem Miteinander von Glauben und Zweifel in diesem Satz entzündet. Wird doch in ihm einerseits die Notwendigkeit des Leidens betont, andererseits aber von Möglichkeiten der Erleichterung gesprochen (Rosenstock, Judaism . . . 73). Erinnern wir uns, was das Baden- Badener-Programm über soziale Ideen, historische Weitsicht, Nationalismus und Realismus der Arbeit enthalten hatte, so konnte dies nur als Bestätigung jenes Miteinanders von Glauben und Zweifel, aber niemals als Gegeninstanz wirksam werden.
Die erste Peripetie des Gesprächs war erreicht, als die im Baden-Badener-Programm fehlende Religion thematisiert wurde. Was tut sie gegenüber dem Leiden der Menschen? Rosenzweigs Antwort steht im zweiten Band seiner Hegelmonograhie, wo dargelegt wird, wie die Religion den «großen Gedanken der Immanenz« (Treitschke) durchbricht und darum so etwas wie Karl Marx‘ weltbürgerliche Gesellschaft als bloßes Nachbild der Kirche erscheinen läßt, die nicht von dieser Welt ist (Hegel und der Staat, Bd. 2, München-Berlin 1920, 104, mit ausdrücklicher Bezugnahme auf Selma Lagerlöfs «Wunder des Antichrist«).
Was also bewirkt die Religion in der Geschichte? Nach dem von Rosenzweig damals vertretenen Dualismus verschärft sie das Leiden zur Tragik, und das hat Konsequenzen für alle Tendenzen des 20. Jahrhunderts, Konsequenzen, denen gerade eine dem geschichtlichen Realismus verpflichtete Philosophie nicht wird ausweichen dürfen. Das heißt dann aber, daß die soziale Idee in das Dilemma zwischen Großinquisitorentum oder den nur noch blinzelnden Erdflohmenschen aus Nietzsches Zarathustravorrede gerät. Die historische Weitsicht findet sieh eingeklemmt zwischen zwei für sie gleich unakzeptablen Möglichkeiten, die der ewigen Wiederkehr des Gleichen oder den Manichäismus eines Kampfes zwischen dem Reich des Lichtes und dem der Finsternis. Die Idee des Nationalismus muß es sieh gefallen lassen, wenn sie sich nicht in Internationalismus transformieren lassen will, zum Rassismus zu entarten. Und aus dem Realismus der Arbeit wird unter den Bedingungen der allesverschlingenden Weltgesellschaft entweder der bloße Mechanismus oder der Irrationalismus der absurden Verweigerung.
Was Rosenstock hierauf zu entgegnen hatte, konnte man schon in der Einleitung zu «Ostfalens Rechtsliteratur« lesen, wo gegen alle Dualismen die unzerreißbare Einheit von Recht und Sprache festgehalten wird: «Das Recht war vor den einzelnen Menschen und ihren Vorträgen, seine Geschichte gewann zum Rahmen die Welthistorie, die Geschichte des Menschengeschlechts« (a. a. 0. 1). Und die Konfrontation dieser Gewißheit mit Rosenzweigs tragischem Dualismus ist der durch des letzteren Rückblick am besten bezeugte Moment des Leipziger Gesprächs. Hören wir Rosenzweig selbst: «Hätte ich ihm damals meinen Dualismus Offenbarung und Welt mit einem metaphysischen Dualismus Gott und Teufel unterbauen können, so wäre ich unangreifbar gewesen. Aber daran hinderte mich der erste Satz der Bibel. Dieses Stück gemeinsamen Bodens zwang mich, ihm standzuhalten. Es ist auch weiter in den folgenden Wochen der unverrückbare Ausgangspunkt geblieben. Jeder Relativismus der Weltanschauung ist mir nun verboten.« (Briefe 71 f.).
Es verdient als besonders würdigenswert festgehalten zu werden, wie hier die rein theologische Absage an den Dualismus unmittelbare Relevanz für das wissenschaftliche Verstehen von Geschichte gewinnt. Denn man beachte: Rosenzweig spricht hier nicht von der im akademischen Schulbetrieb nur zu wohlfeilen Verabscheuung gnostisch-theosophischer Spekulationen, sondern vom Dualismus Gott-Teufel. So wird mit einzigartiger Schärfe offenbar, wie dem scheinbar unbegrenzt flexiblen Historismus und Relativismus ein latenter Dualismus zugrundeliegt, der sich in der Konfrontation mit der für ihn nicht integrierbaren geschichtlichen Wirklichkeit in einen manifesten Dualismus verwandelt, wenn er nicht wie Rosenzweig bereit ist, sein historisch-relativistisches Umgehen mit Geschichte fahren zu lassen. Aber das fällt ihm schwer, weil der Historismus ja gar nicht anders existieren kann als dadurch, daß er seine Subjektivität abgrenzt von einer entsprechenden Objektivität, werde sie als Geist oder Geschichte oder Kultur der Natur, als Kreativität der Kausalität, als Verstehen dem Erklären gegenübergestellt. Und der von Rosenzweig in so klaren Worten festgehaltene Moment des Leipziger Gespräches bezeichnet dann genau jenen Augenblick, in welchem der Historismus, mit der Einheit der Wirklichkeit — auch als Einheit von Vergangenheit und Gegenwart — konfrontiert, entweder mit Nietzsche die ewige Wiederkehr des Gleichen proklamieren oder zum ontologischen Dualismus einander feindlicher Mächte bzw. Welten übergehen muß, wenn er auf seiner Subjektivität beharren will. Aber um diesem Beharrungszwang zu entgehen, bedarf es einer theologischen Entscheidung, der des Bekenntnisses zum ersten Satz der Bibel. Und wie wir inzwischen haben lernen müssen, schließt dieses Bekenntnis den Einbruch des dualistischen Mythos in einer sehr viel effektiveren Weise aus als es die sattsam bekannten Lippenbekenntnisse zur wissenschaftlichen Redlichkeit der historisch-kritischen Methode je haben unter Beweis stellen können. Wir wissen, wie es aussah, wenn anders als von Rosenzweig entschieden wurde. Dann mußte man mit Carl Schmitt Freund und Feind zu Grundkategorien der Politik erklären, mit dem Neuprotestantismus die Bedeutungslosigkeit des Alten Testamentes für die Kirche und mit der liberalen Historiographie die Kriminalisierung der russischen Oktoberrevolution auf die Tagesordnung setzen.
Woher aber gewann Rosenstock jene Unüberwindlichkeit, die Rosenzweig zur Bejahung des christlich-jüdischen Schöpfungsglaubens zwang? Der in der Literatur mehrfach zitierte Satz, Rosenstock habe damals im Gespräch erklärt, wenn sein Dialogpartner auf seiner Position beharre, dann werde er eben in die Kirche gehen und zum Gebet niederfallen, kann nicht als zureichende Erklärung akzeptiert werden. Hätte doch eine solche Handlung jederzeit im Sinne jener tragischen Religiosität interpretiert werden können, wie sie für Rosenzweig selbst im Vorfeld des Leipziger Gespräches charakteristisch war.
Aber Rosenzweig sagt uns auch, daß nicht Rosenstocks Position, sondern er selbst ihn zwang, die Pfade des Historismus zu verlassen. »Deshalb war ich damals schon durch Rosenstocks mehrfaches Bekenntnis, mit dem doch sein Angriff nur begann, mit einem Schlage entwaffnet. Daß ein Mensch wie Rosenstock mit Bewußtsein Christ war . . . dies warf mir meine ganze Vorstellung vom Christentum, damit aber von Religion überhaupt und damit von meiner Religion über den Haufen.» (Briefe 72).
Freilich läßt Rosenzweig das, was damals geschah, nicht im Bereich zwischenmenschlicher Beeinflussung. Gegenüber Rudolf Ehrenberg faßt er den Vorgang theologisch, indem er feststellt, er habe den Hebräerbrief nachdatiert, nicht gerade um 18 Jahrhunderte, aber jedenfalls um »die« Jahrhunderte und so den Hebräerbrief auf den lebendigen Ast des Judentums im 20. Jahrhundert aufgepropft (Briefe 73).
Damit aber hat Rosenzweig zugleich die Position erläutert, in welcher Rosenstock ihm gegenüberstand und ihm die Fortführung seines bisherigen Weges unmöglich machte. Er trat ihm gegenüber als Judenchrist, d. h. als Christ, dessen vorchristliches Stadium nicht mehr die gräko-romanische Kultur Europas, sondern die bisher nur in Gestalt Israels wirkliche Einheit der Menschheitsgeschichte war. In Rosenstock hatte sieh ein Wechsel der Antiken vollzogen. An die Stelle der klassizistischen Antike war die Antike Israels getreten, und so hatte er die Autorität und Vollmacht gewonnen, wieder wie Tertullianus zu fragen: Quid ergo Athenis et Hierosolymis, quid academiae et ecclesiae? (De praescr. haer. 7, 9). Hier trat plötzlich wieder Glaube im Sinne von 1. Korinther 1 in Erscheinung, nicht mehr bemüht, seine Übereinstimmung mit hellenischer Weisheit nachzuweisen und zu verteidigen. Vielmehr ein Glaube, der genau an jener Stelle stand, wo das Evangelium immer zugleich Torheit und Skandalon ist, nämlich kulturell Torheit, religiös Skandalon.
Durch seine wissenschaftliche Arbeit aber gab Rosenstock die Gewähr dafür, daß seine Position auch nicht die eines Offenbarung nur positivistisch behauptenden autoritären Fundamentalismus war. Denn derartiges wäre kaum geeignet gewesen, die Vorstellung von Religion auf dem wissenschaftlichen Niveau eines Rosenzweig zu revolutionieren.
Wie haben wir in unserer heutigen Perspektive die Rosenstocksche Position von 1913 theologisch zu beurteilen? Angesichts der ausschlaggebenden Rolle des Hebräerbriefes im Zusammenhang des Leipziger Gespräches wäre es besonders wichtig, die Gesprächsbeiträge von Rudolf Ehrenberg zu kennen, der eben damals — er, der Mediziner und Physiologe — an einer Auslegung von Hebräer 10, 25 arbeitete. Wir können uns jetzt nur auf die Äußerungen von Rosenzweig in seinem rückblickenden Brief an diesen Freund stützen. Und daraus geht hervor, daß Rosenzweig das paulinische Ölbaumgleichnis aus Römer 11 auf den Hebräerbrief im Ganzen übertragen hat. Wie die Christen in Israel eingepropft sind, so wurzele das Hebräerbriefchristentum Rosenstocks im gegenwärtigen Leben Israels. Ich glaube, damit will Rosenzweig sagen: Wo Paulus eine Einheit von Juden und Heiden lehrt im Blick auf Christus als Ziel des ganzen Ölbaumwachstums, dort leitet der Hebräerbrief uns an, in der Inkarnation, die in der Abrahamnachkommenschaft geschah, den Inbegriff des unauflöslich einen Menschseins zu erkennen. Die von Rudolf Ehrenberg ausgelegte Stelle Hebräer 10, 25 wird dann zur Warnung, die von Christus gestiftete Menschheitssynagoge nicht zu verlassen. Denn im Blick auf das Eschaton müßte solches Verlassen für den einzelnen wie für die Menschheit katastrophale Folgen haben.
Das also macht das Leipziger Gespräch zu einem Ereignis der Religionsgeschichte. Demjenigen, der im vollen Genuß idealistischen Erbes und in ungebrochener Philosophiegläubigkeit überzeugt war, eine Position tragisch klassizistischer Religiosität jenseits von Judentum und Christentum eingenommen zu haben, tritt ein Judenchristentum gegenüber, das nicht nur ein Ende der christlichen Assimilation an den Renaissancehumanismus signalisiert, sondern auch einen Typ wissenschaftlicher Arbeit, der in ein Neuland jenseits der Universitätsherrschaft durch Theologen und Philosophen aus dem 12. Jahrhundert vorgestoßen ist.
Und auch wenn nur drei Wissenschaftler, alle Nichttheologen und Nichtphilosophen, an diesem Gespräch beteiligt waren — dennoch war dieses Gespräch ein erster Schritt in eine Menschheitsökumene, in der das Evangelium in ganz neuer Weise als Torheit und Skandal provokant geworden war. Damit aber hatte sich dieses Gespräch auch distanziert von allen Versuchen, — auch den allerneuesten —‚ die Brisanz der herangereiften Situation dadurch zu entschärfen, daß der Hellenismus als Torheit und der Skandal des Kreuzes als Mißverständnis erwiesen wird. Wie wir gleich sehen werden, war Rosenzweig durch das Leipziger Gespräch mit der Frage konfrontiert worden: Muß ich mich nicht zur Präsenz des Judentums als des größten aller Skandale in der nachhellenistischen Welt des 20. Jahrhunderts bekennen?
Rosenzweigs Erneuerung des jüdischen Bekenntnisses als Konsequenz des Leipziger Gespräches
Was für Rosenzweig dieses Gespräch vom Typ pietistischer oder erwecklicher Bekehrungsgeschichten unterscheidet, ist die Tatsache, daß er die Erfahrung dieses Gespräches nur mit dem Ausdruck »Zusammenbruch« bezeichnen kann. »Mir ist im Jahre 1913 etwas geschehen, was ich, wenn ich einmal davon reden soll, nicht anders bezeichnen kann als mit dem Namen Zusammenbruch« (Brief an Meinecke, 30. 8. 1920). Halten wir an dieser Stelle schon fest, wie für Rosenzweig die Erfahrung des Zusammenbruchs längst vor Ausbruch des Weltkrieges Lebenstatsache geworden war. Wir werden im letzten Abschnitt unserer Darlegungen darauf einzugehen haben, welcher Gegensatz sich hier gegenüber Spengler und der gesamten theologischen wie nichttheologischen Krisenliteratur nach 1918 auftut.
Was aber meint Rosenzweig eigentlich, wenn er im Blick auf Leipzig von Zusammenbruch spricht? In einem späteren Brief an Rosenstock hat er das folgendermaßen erklärt: »… so haben Sie mich mit Recht 1913 in Leipzig dazu gezwungen, als Sie mir standhaft nicht glaubten, keine Äußerung von mir als meine Äußerung gelten ließen, bis ich selber erschrak, wie faul mein Fleisch und wie träge mein Blut war, da ging ich selber an die Untersuchung der Knochen« (Briefe 658).
Wie wir aus anderen einschlägigen Briefen entnehmen können, haben wir keinen Anlaß, den Ernst dieser Prüfung in irgendeiner Weise zu bezweifeln oder abschwächend zu verstehen. Rosenzweig konnte sogar gelegentlich diese Zeit als eine der Todesbereitschaft beschreiben. Äußerlich war sie angefüllt mit Verhandlungen und Vorbereitungen auf die christliche Taufe. Wenn es zu dieser nicht kam, dann hat das allein theologische Gründe, wie wir gleich sehen werden. Freilich blieb es Rosenzweig im Umkreis dieser Taufvorbereitungen auch nicht erspart, das ganze Ausmaß des Unverständnisses für seine Lage kennenzulernen, wie es ihm in der Gestalt eines liberalen protestantischen Pfarrers entgegentrat. Aber auch wenn Rosenzweigs Brief an seine Mutter (Briefe 65 ff.) nicht ohne Schärfe und Bitterkeit über dieses Unverständnis spricht — ausschlaggebend für seinen Entschluß, Jude zu bleiben, war es keineswegs. Rosenzweig gibt diesen Entschluß Rudolf Ehrenberg am 31. 10. 1913 mit den folgenden Worten bekannt: »Ich muß Dir mitteilen, was Dich bekümmern und, zunächst mindestens, Dir unbegreiflich sein wird: ich bin in langer und, wie ich meine, gründlicher Überlegung dazu gekommen, meinen Entschluß zurückzunehmen. Er scheint mir nicht mehr notwendig und daher in meinem Fall nicht mehr möglich. Ich bleibe also Jude« (Briefe 71). Was in diesem Briefe dann folgt, ist eine tiefgründige Erörterung, in der alles, was im »Stern der Erlösung« über das Verhältnis Christentum und Judentum gelehrt wird, bereits im Kern enthalten ist.
Rosenzweig schreibt nicht nur zu seiner eigenen Rechtfertigung, sondern, wie er selbst sagt, weil er auch vom Christen die theoretische Anerkennung seines Schrittes fordert. Dies um so mehr, als Rosenzweig seine Haltung mit einem Vers des Johannesevangeliums begründet: »Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich« (Joh. 14, 6). Rosenzweig erkennt dieses Wort Jesu und seine Exklusivität ausdrücklich an. Aber er legt es in einer ganz unerwarteten Weise aus: »Es kommt nur zum Vater — anders aber, wenn einer nicht mehr zum Vater zu kommen braucht, weil er schon bei ihm ist. Und dies ist nun der Fall des Volkes Israel (nicht des einzelnen Juden). Das Volk Israel, erwählt von seinem Vater, blickt starr über Welt und Geschichte hinüber auf einen letzten fernsten Punkt, wo dieser sein Vater dieser selbe, der eine und Einzige — Alles in Allem — sein wird« (Briefe 73). Wir sehen also, Rosenzweig setzt die Gültigkeit jenes johanneischen Logions voraus. Nicht etwa eine relativistische Lehre von zwei Heilswegen wird hier proklamiert. Vielmehr geht es darum, als Auftrag des Judentums die Existenzform der Weltlosigkeit bei Gott dem Vater anzuerkennen, während die Kirche und dies auch nach jüdischer Sicht rechtmäßig, missionierend in die Welt geht, missionierend die Welt durchzieht und in ihr lebt. So ist die Gemeinschaft von Christ und Jude das Zeichen der eschatologischen Dimension von Geschichte. Indem er 1. Korinther 15, 27 und Römer 11, 25 aufeinander bezieht, hat Rosenzweig nicht nötig, die Gemeinschaft von Juden und Christen auf einer rationalistischen Kritik des christologischen und trinitarischen Dogmas zu begründen, Wohl aber kann er dafür eintreten, daß das regnum Christi nicht in einer modalistischen Weise mit dem Reich Gottes identifiziert und damit um seine eschatologische Dynamik gebracht wird.
Die theologische Bedeutung dieser Position wird dadurch dokumentiert, daß Rosenzweig von ihr aus schon 1914 in seinem Aufsatz »Atheistische Theologie« die kommende Hauptaufgabe aller, auch der christlichen Theologie nach 1918 zu formulieren vermochte. ». . . wird es möglich sein, den Begriff der historisch-überhistorischen Offenbarung ins Zentrum der Wissenschaft zu rücken? Vor dieser Entscheidung steht im gegenwärtigen Augenblick das wissenschaftliche Bewußtsein des Protestantismus, von hier werden die Kämpfe der nächsten Zukunft entspringen« (Kleine Schriften 281).
Mit dem Begriff der atheistischen Theologie beabsichtigt Rosenzweig beinahe das Gegenteil von allem, was jenes Modewort der 60er Jahre zu favorisieren gedachte. Denn für Rosenzweig ist atheistische Theologie eine solche, die die Spannung der Offenbarungsfrage dadurch zu eliminieren versucht, daß sie sie, sei es kollektivistisch, sei es individualistisch, zu einem Bestandteil religiöser Selbstinterpretation des Menschen und seiner Gesellschaft macht. Eben deswegen sah Rosenzweig seine Aufgabe darin, den Offenbarungsbegriff ins Zentrum der Wissenschaft zu rücken, nicht mittels des Offenbarungsbegriffes die Wissenschaft von der Theologie fernzuhalten. Was das für Leben und Arbeiten heißen müsse, dies wurde Gegenstand eines neuen Dialoges zwischen Rosenstock und Rosenzweig, diesmal wegen der Umstände des inzwischen ausgebrochenen Krieges eines brieflichen.
2. Die Konfrontationserfahrung von Jude und Christ angesichts der einen Sprache der einen Offenbarung
Post Hegel mortuum: die Entdeckung der Gültigkeitsgrenze idealistischer Systembegründung
Die Aktualität der Judenfrage seit 1933 hat dazu geführt, daß der Rosenstock-Rosenzweig- Briefwechsel zwischen Mai und Dezember 1916 als eine Art Vorläufer der Nach-Auschwitz- Diskussion aufgefaßt und einseitig religionsphilosophisch oder dialog-theologisch interpretiert wurde.
Demgegenüber soll hier unterstrichen werden, was die Interpretation des Leipziger Gespräches ergeben hatte. Dialog und Streitgespräch der beiden Gelehrten sind initiiert durch die gemeinsame Konfrontation mit einem von beiden entdeckten Faktum: der erkenntnis- und vernunftgründenden Kraft der Sprache von Gottes Offenbarung. Es ist sachlich wie historisch gleich bedeutsam dies vor Augen zu haben: Der jüdisch-christliche Dialog hat eine Wurzel unabhängig vom nationalsozialistischen Rassismus. Dem versuchten Völkermord muß auch noch das negative Verdienst abgesprochen werden, uns die Notwendigkeit dieses Dialoges evident gemacht zu haben.
Völlig verdeckt bleiben mußte unter der Vorherrschaft der Rassismusproblematik die Tatsache, daß der Kriegsbriefwechsel zwischen Rosenstock und Rosenzweig von einer Frage der philosophischen Grundlagenforschung angeregt war. Denn rein äußerlich wird er veranlaßt durch die Entdeckung des Schellingschen Systemprogrammes von 1796 durch Rosenzweig im Berliner Hegelnachlaß während der Arbeit an seiner Dissertation. Rosenstock hatte während eines Heimaturlaubes im Jahre 1916 Rosenzweigs große Abhandlung über diesen Schellingfund lesen können. Das veranlaßte ihn, den dann bis in den Dezember hinein fortgesetzten Briefwechsel mit der Mitteilung zu eröffnen: »… nachdem ich Ihren Schellingaufsatz gelesen habe, bin ich zum ersten Male ohne alle Vorbehalte wissenschaftlich der Ihrige« (Briefe 641). Wenige Zeilen weiter unten wird diese Zustimmung inhaltlich präzisiert. Rosenstock dankt Rosenzweig dafür, daß er ihm die Revolution von 1 789—1 900 in einer Weise verdeutlicht habe, die sie ihm als Anfang jener Epoche kenntlich werden ließ, die mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges endete.
Im übrigen bedeutete die Entdeckung des Schellingschen Systemprogrammes von 1796 zwar nicht eine Neueinteilung, aber doch eine Neudatierung und eine veränderte Inhaltsbestimmung der idealistischen Systemgeschichte. Auch wenn das im allgemeinen Bewußtsein wenig reflektiert zu werden pflegt, die Priorität Schellings vor Hegel war immer schon bekannt und auch von Hegel selber in seiner Philosophiegeschichte ausdrücklich anerkannt worden. Ganz neue Schlaglichter aber warf der von Rosenzweig identifizierte Text auf den revolutionären Charakter idealistischen Systemdenkens und damit auf seine Stellung in der Epoche nach 1789.
Schellings Systemprogramm macht es ein für allemal unmöglich, die berühmte Sentenz Friedrich Schlegels, Fichtes Wissenschaftslehre verkörpere die zweite der drei Haupttendenzen der Neuzeit, in dem Sinne mißzudeuten, daß sie nichts anderes sei als die Übersetzung der Revolution in Philosophie und somit ihre politische Entschärfung. Was Schelling 1796 niederschrieb, war nichts anderes als die Weiterführung der Revolution im Terrain von Ethik und Religion.
Der Systementwurf beginnt mit der Losung, alle Metaphysik und Ontologie zu ersetzen durch eine Ethik der absoluten Freiheit. Diese Ethik wiederum hat nach Schelling sich die gesamte Naturphilosophie mittels des Gedankens einer spekulativen Physik zu unterwerfen. Damit wird es möglich, in der Beziehung zwischen Mensch und Natur alle historischen Traditionen in die Schranken zu weisen mit dem Kampfruf »Hinaus über den Staat« (Kleine Schriften 233), also einer Losung, die allen späteren Anarchismus des 19. Jahrhunderts vorwegnimmt. Und was Nietzsche in der letzten Phase seines Wirkens als wichtigstes Ergebnis seiner Philosophie ausgeben wird, auch das steht schon im Schellingschen Systemprogramm, wenn es behauptet, der höchste Akt der Vernunft sei der ästhetische. Und an dieser Stelle geht das Systemprogramm Schellings in die Sphäre der Religion über, indem es als Religion der Zukunft eine Mythologie der Vernunft, eine Lehre von den weltbestimmenden Potenzen fordert (a. a. 0. 234). Rosenzweig aber hat sicherlich recht, wenn er es als ausschlaggebend für die Interpretation des Ganzen bezeichnet, daß die hier ihr Programm entrollende Philosophie sieh selber als Philosophie des Geistes versteht und damit schon 1796 als Zentral- und Abschlußbegriff jenen aufruft, der für Hegels spätere Realisierung des Ganzen ausschlaggebend werden sollte.
Wie der Zusammenhang des Briefwechsels zeigt, liegen hier die Gründe für Rosenstocks Zustimmung zu Rosenzweigs Interpretation der idealistischen Systematik. Nach Rosenzweig ist der hier formulierte Systemgedanke unüberboten, ja auch unüberbietbar, nämlich als Idee der vollständigen Integration von Wahrheit und Wirklichkeit, als Aufgabe, alles Denken darauf zu konzentrieren, Wirklichkeit vollständig zu erfassen und auszusprechen. Ein Programm, das in dieser Form weder von der Antike noch im Mittelalter auch nur konzipiert werden konnte (a. a. 0. 274). Und wenn Hegel dieses Programm realisierte in Gestalt der dialektischen Methode, so hatte er damit nur die letzten Konsequenzen aus Schellings Priorität der absoluten Freiheit gezogen, wenn er noch die politische Ethik den Gesetzen einer deduktiven Logik folgen läßt und damit ungeahnte politische Konsequenzen von Altenstein bis Lenin entfesselte.
Umgekehrt resultierte hieraus aber auch der prinzipielle Charakter der im 20. Jahrhundert sichtbar werdenden Gültigkeitsgrenzen einer solchen Systematik. Wie wir wissen, sah Rosenzweig das 20. Jahrhundert bestimmt durch Technik, Vielstaatlichkeit, Vielsprachigkeit, Nationalismus und Sozialismus. Sie alle aber haben ihre Wurzeln jenseits des in Hegel gipfelnden Systems. Rosenstock bestätigt diese Einsieht von einer anderen Seite aus. Nach seiner Beschäftigung mit Schellings »Weltalter« und mit Hegels »Phänomenologie« schreibt er an Rosenzweig, beide Werke hätten ihn beeindruckt als Vorstöße, die geschichtliche Wirklichkeit zu erfassen. Aber ebenso deutlich sei, wie beide scheiterten am Instrumentarium einer unzulänglichen Begriffssprache (Briefe 703). Aus dem gleichen Grunde aber sei auch keine Rückkehr zu Kant mehr möglich. Denn nach Rosenstocks Studien der drei Kritiken ist er zu dem Ergebnis gekommen, daß Kants Philosophieren einerseits vorsystematisch, andererseits aber seine Logik bereits inhaltliche Metaphysik ist, ohne sich davon methodische Rechenschaft zu geben (Briefe 664, 697, 703).
Und noch eine wichtige Konsequenz zieht Rosenstock aus der Rosenzweigschen Schellingabhandlung. Sie markiert auch den Schlußpunkt jeder Form von Neuromantik. Denn das Programm von 1796 steht auch hinter dem Athenäum der Gebrüder Schlegel und ihrer Freunde (Briefe 642). Wenn hier keine Alternative zu dem idealistischen Systemprogramm zu finden ist, dann kann eine Repristination der romantischen Modernismen auch nicht als geschichtliche Möglichkeit für die Gegenwart angesehen werden. Das für deutsche »Geistesgeschichte« — hier ist das fragwürdige Wort einmal angebracht — so typische wechselseitige Ausspielen von Klassik und Romantik stellt sich hier heraus als eine Selbsttäuschung auf beiden Seiten. Als eine Selbsttäuschung darüber, daß beide, Klassik wie Romantik, die gleiche Wurzel haben im chiliastischen Bewußtsein von 1800, so wie es Novalis in »Die Christenheit oder Europa«, aber eben vor ihm deutlicher schon Schellings Systemprogramm ausgesprochen hatte.
Die beiden Briefpartner von 1916 tauschen auch ihre Meinungen über die Konsequenzen aus, die aus den idealistischen Systemaporien zu ziehen sein würden. Handelte es sich doch hier um sehr viel mehr als eine innerphilosophische Fachfrage. War das idealistische System doch das letzte, das universitätsgründend und somit wissenschaftsorganisierend gewirkt hatte. Rosenzweig hielt darum die Zeit für gekommen, die gesamte öffentliche Bildung auf neue Grundlagen zu stellen, so wie er es in seinem Entwurf »Volksschule und Reichsschule« eben damals entwickelte (Kleine Schriften, 420 ff.).
Rosenstock dagegen ist es vor allem darum zu tun, daß die Idee einer vollständigen Korrelation von Wahrheit und Wirklichkeit nicht preisgegeben wird zugunsten einer Anarchie der professoralen und nichtprofessoralen Privatphilosophen. Vielmehr arbeitet sein Denken an dem Versuch, die Wirklichkeiten von Raum und Zeit aufeinander zu beziehen durch das, was Rosenzweig kalendarisches Philosophieren nennt (Briefe 650, 701). Sein Gedanke dabei ist, die verschiedenen Dimensionen der Zeit zu erfassen und einander zuzuordnen, den Naturkalender, den biographischen Kalender, den Menschheitskalender und den Kirchenkalender. Damit aber stellt er sich wiederum eine neue Aufgabe. Wie ist diese Mehrheit der Kalender so einander zuzuordnen, daß sie eine sinnvolle Polyphonie und nicht nur einen uferlosen Pluralismus ergeben?
Offenbarung als Erleuchtung und Orientierung am Kreuz der Wirklichkeit
Rosenstock gebraucht im Zusammenhang mit der Zuordnung der eben genannten Kalender eine Grundformel seiner späteren Soziologie, indem er vom »Kreuz der Wirklichkeit« spricht (Briefe 702). Unverkennbar ist damit die theologische Thematik des Leipziger Gespräches wiederaufgenommen. Dies entsprach dem zweiten Anlaß des Briefwechsels. Rudolf Ehrenberg war nach Kassel gekommen, wo Rosenstock einen Teil seines Urlaubes in Rosenzweigs Elternhaus verbrachte. Von Ehrenberg erfuhr er, daß Rosenzweigs Entschluß, als bekennender und praktizierender Jude zu leben, unumstößlich war.
Wie wir wissen, war man im Leipziger Freundeskreis zunächst davon ausgegangen, daß die Konsequenz des Gespräches vom 7. 7. 1913 nur Rosenzweigs Taufe sein könne. Aber nicht dessen Entscheidung für das Judentum war der Grund für die aus dieser späten Vergewisserung erkennbare Distanz zwischen den beiden Gesprächspartnern, die erst mit dem Briefwechsel ab Mai 1916 endet. Rosenzweig selbst hat die noch in Leipzig eingetretene Entfernung ganz anders gedeutet. In seinen Augen entstand sie aus der Schwierigkeit, den Rosenstock des Religionsgespräches mit dem in Leipzig weiter lehrenden Privatdozenten ins Verhältnis zu setzen. Rosenzweig gesteht ganz offen, daß er das nicht vermochte (Briefe 666).
Aber nun hat Rosenstock seinerseits die Initiative ergriffen. Initiative wozu? Zu der Frage, ob Jude werden Post Christum natum nicht notwendigerweise ein Ausdruck jüdischer Verstockung gegenüber Christus sein / müsse. Das Einzigartige dieses Briefgespräches besteht nun darin, daß man in den nur zu beliebten Austausch interreligiöser Höflichkeiten mit all ihren unvermeidlichen Trivialitäten verfällt oder die Grenze der Verständigungsmöglichkeiten für erreicht erklärt.
Rosenzweig tut weder das eine noch das andere, sondern beantwortet die Frage nach seiner Entscheidung und ihrer möglichen Identität mit jüdischer Verstockung durch ein rückhaltloses Ja. Er kann das, weil er ganz sicher ist, nicht in Trotz und Selbstbehauptung zu verfallen. Die Psychologie des Kampfes um die eigene Identität und um Selbstverwirklichung war ja gerade in jenem Religionsgespräch für immer verlassen worden, in dem ein ganz neues Kapitel der gemeinsamen Geschichte von Christen und Juden aufgeschlagen worden war. Thema dieses neuen Kapitels war die plötzliche Klarheit darüber, daß es gerade die Einheit der Offenbarung Gottes ist, welche die beiden, nicht nur verschiedenen, sondern sogar gegensätzlichen Existenzweisen und Lebenswege des Christen und des Juden begründet.
Rosenzweig berichtet, wie ihm angesichts der Lektüre der Schriften des Tertullianus gegen Marcion aufging, daß nicht die Konzilsdogmen des 4.-8. Jahrhunderts, sondern das antignostische Bekenntnis des 1. und 2. Jahrhunderts den substantiellen Inhalt des christlichen Dogmas ausmacht, das in Christus den Sohn des Schöpfers als Herrn anruft. Und er wagt es, von hier aus die atemberaubende Perspektive einer Konkordanz der christlichen und der jüdischen Dogmengeschichtc zu entwerfen. Ein Zusammenhang, den Rosenzweig für intellektualisierbar hält durch und durch, dies aber nicht auf Grund der historischen Relativierbarkeit des Dogmas, sondern im Gegenteil auf Grund der Gewißheit von »dem großen sieghaften Einbrechen des Geistes in den Ungeist, das man Offenbarung nennt« (Briefe 671).
Aber wenn es sich so verhält, dann muß man auch an den gegenwärtigen und ganz persönlichen Verhältnissen von Jude und Christ — und dies ohne in den peinlichen Bekennerton der privaten Religiosität zu verfallen — gleichsam in einer neuartigen Anwendung von Anselms remoto Christo, zeigen können, wie diese Einheit der Offenbarung hier und jetzt zu verstehen ist. Und darum kann Rosenzweigs präzise Frage nur lauten: »Erklären Sie mir Ihren jetzigen Begriff vom Verhältnis Natur und Offenbarung« (Briefe 675). Und nicht ohne Grund knüpft er hieran die andere, hintergründige Frage: »Hat die Sprache Ihnen nicht mehr die Bedeutung, die sie damals hatte? Könnten Sie nicht mehr alles, was Sie meinen, ausdrücken, indem Sie von ihr sprechen?« (ebenda). Denn das ist der Sinn des nachanselmschen Christo remoto: Offenbarung so zu beschreiben, daß sie als fundamentale Voraussetzung und universalster Horizont menschheitlicher Kommunikation erkennbar wird.
Rosenstock wär der letzte gewesen, der dieser Fragestellung hätte ausweichen dürfen. Hatte er Rosenzweig gegenüber doch selbst bekannt: «Wie mir überhaupt die Offenbarung Gottes in der Welt von Tag zu Tag aus einem bloß hintergründig-metaphorischen abstrakten Begriff immer mehr zur unmittelbaren jetzt-hier-so-Wirklichkeit wird« (Briefe 663).
Das war im unbefangenen Überschwang der brieflichen Mitteilung gesagt. Jetzt aber stand Rosenstock dem Ernst, dem jüdischen Ernst der dezidierten Anfrage gegenüber. Wie reagierte er darauf?
Rosenstock antwortet zweimal während des ganzen Briefwechsels. Beide Antworten basieren auf Johannes 1, 14 und beide Antworten enthalten die gleiche Wahrheit, von der Rosenzweig ein reichliches Jahr später erklärt, daß sie für sein weiteres Denken entscheidend geworden sei (Kleine Schriften 358).
In der ersten Antwort— sie ergeht schon vor der oben zitierten Frage (Briefe 649)— führt Rosenstock aus: Offenbarung ist Perspektivenwechsel. Übergang von der Froschperspektive des eigenen Tuns, die wie Faust den ersten Satz des Johannesevangeliums umdeutet zu der Behauptung »Im Anfang war die Tat«, zur Anerkennung eines Oben und eines Jenseits des eigenen Tuns, ein Vorgang wie beim Sich-Aufrichten in eine neue Dimension, aus der Fläche in den Raum. Die eigentliche, weil auf Rosenzweigs Frage eingehende und darum entscheidende Antwort lautet noch grundsätzlicher: »Natur und Offenbarung: Derselbe Stoff, die umgekehrte Belichtung« (Briefe 676). Offenbarung ist nicht ein Zusatz zur Natur, etwa eine zusätzliche Information über etwas jenseits von ihr liegendes. Nein, Offenbarung ist Orientierung in der Natur, Orientierung in der Gesamtwirklichkeit durch die Erleuchtung ihres Inhaltes und Umfanges, Orientierung durch Erleuchtung über das Rechts und Links, das Vorn und Hinten, das Oben und Unten jenseits der eigenen Existenz.
Ein solcher Perspektivenwechsel ist nicht Sache des menschlich-natürlichen Verstandes. Er kann es gar nicht sein, denn wie soll er die Aufgabe lösen, die eigene Position nicht als erkennende Mitte und Maß aller anderen Dinge zu behaupten? Woher sollte der menschliche Verstand die Kraft dazu nehmen?
Rosenstock erklärte das in Form einer Abgrenzung von Schleiermachers Gefühl der unbedingten Abhängigkeit (Briefe 677). Im Unterschied zur Überwältigung durch ein mich umfassendes und umschließendes Äußere tritt hier die Erleuchtung des Schleiermacherschen Universums zum Kreuz der Wirklichkeit. Sie ermöglicht eine Erkenntnis des wirklichen Raumes mittels der wirklichen Zeit, einer Zeit, die nicht Form des inneren Sinnes (Kant), sondern Dimension jener Veränderung ist, für die es nur ein einziges Maß gibt, die Sprache Nach Rosenstock ist die Zeitlosigkeit im Denken nur Symptom der Abstraktion von Sprache. Eine Abstraktion übrigens, die immer unvollständig bleiben muß. Denn auch die Begriffe noch sind Sprache, Sprache freilich im Aggregatzustand der Erstarrung, also nicht etwa in einem höheren Seinsrang als gesprochene Sprache.
Johannes 1, 14 ist auch in dem Sinne eine soteriologische Aussage, daß die Inkarnation — und zwar sie allein — unser Bewußtsein von der Absolutheit und undurchdringlichen Identität, ja Tautologie seiner Selbstreflexion befreit: »Hier setzt die Logoslehre des Heilandes ein. Der Logos wird von sich selbst erlöst, vom Fluche, immer nur in sich selbst sich zu berichtigen. Er tritt in eine Verbindung mit dem Erkannten. Das Wort ward Fleisch — an dem Satz hängt wohl alles« (Briefe 679).
Und diese Sprachbefreiung ist es, deretwegen Glaube im jüdisch-christlichen Sinne zu einer metareligiösen Wirklichkeit werden läßt. Widerfährt doch allein dem Glauben, der den archimedischen Punkt außerhalb seiner selbst gefunden hat, die Erfahrung des Kreuzes der ganzen Wirklichkeit. Es ist dieser Glaube, der nach Jesu Wort schon in der Größe eines Senfkornes die Kraft besitzt, Berge zu versetzen. Rosenstock drückt das so aus: »Der Glaube ist ein Vermögen, das nur moralisch Gesunden voll innewohnt, das durch Unreinigkeit zerbricht und sich auflöst, ist ganz handfest einer sonstigen Naturkraft vergleichbar. Christus hat den Durchbruch dieser auf Erden latenten, gebundenen Kraft in den Weltenraum gen Himmel, uns vermittelt. Wo vordem nur Abrahams Schoß war, ist jetzt lebendige Ewigkeit und Aufstieg der Geister von Stern zu Stern. Die Offenbarung bedeutet den Anschluß auch unseres Bewußtseins an den über die Erde hinausreichenden Welt- und Himmelszusammenhang« (Briefe 676).
Es ist nach über sechs Jahrzehnten wohl höchste Zeit, die historische Bedeutung dessen hinlänglich zu würdigen, was hier im Gespräch zwischen Rosenstock und Rosenzweig erörtert wurde. In dreierlei Hinsicht kommt dem hier vertretenen Offenbarungsbegriff philosophische und theologische Bedeutung zu.
Er gibt eine neue und keineswegs erledigte Antwort auf die Frage Kants: »Was heißt: sich im Denken orientieren?« Nach Rosenstock und Rosenzweig heißt sich im Denken orientieren, sich an sich selbst orientieren und damit in einem unklaren Verhältnis zum wirklichen Raum und zur wirklichen Zeit verbleiben. Beide fordern darum das Denken auf, sich an der Sprache zu orientieren.
Speziell Rosenstocks Offenbarungsbegriff stellt eine Alternative auf zu dem Lessing-Hegel- Kierkegaardschen Dilemma von Offenbarung und Geschichte, an dem neuzeitliche Theologie sich rationalistisch, supranaturalistisch oder vermittelnd-symbolisch abarbeitet. Er erneuert, was Hamann bereits gegenüber Mendelssohn, Lessing und Kant angeregt hatte: den Begriff der Geschichte so zu erweitern, daß die aussichtslosen Konfrontationen oder Identifikationen von Offenbarung und Geschichte, Offenbarung als Geschichte ein für allemal hinfällig werden, wenn das Christusereignis selbst zum Maßstab der Geschichte und ihrer Zeitrechnung wird.
Das setzt freilich einen Begriff von Inkarnation voraus, wie ihn der oben zitierte Brief Rosenstocks verwendet, der Offenbarung und Inkarnation als Einheit versteht. Inkarnation ist dann nicht mehr — wie weithin in den altkirchlichen Konzilsdogmen und der auf ihr basierenden kirchlichen Tradition — der wunderhafte Anfang des Lebens Jesu, sondern Ausdruck für den Offenbarungscharakter seines gesamten Lebens als Christus, seine verheißene Geburt, sein prophetisches Lehren und Handeln, sein Kreuz, seine Auferweckung, seine Erhöhung, welche alle in ihrer Weise Gottes Logos im Fleisch manifestieren.
Wo aber ist in dem Welt- und Himmelszusammenhang von Offenbarung und Inkarnation ein Platz für den Juden? War es doch diese Frage, deretwegen die Freunde Rosenzweigs ganz selbstverständlich annahmen, er werde nach der Konfrontation mit der Offenbarung Christ werden wie sie selbst. Denn wozu kann der Jude sich anders bekehren als zu Jesus Christus?
Aber Rosenzweig tat es nicht, und Rosenstock erklärte ausdrücklich, er respektiere seine Entscheidung (Briefe 663). Und wir wissen schon, welch eigentümliche Bewandtnis es mit dieser Respektierung hat. Hinter ihr steht die Überzeugung von der Verstockung der Juden als einem christlichen Dogma, dem negativen Indiz ihres Einbezogenseins ins Geschehen der Offenbarung.
Darum aber basiert die individuelle Möglichkeit der Verstockung auf einer geschichtlichen Realität, verkörpert von der Synagoge als dem Bild der offenbarungslosen Wiederholung, einer zukunftslosen Lebendigkeit, die tatsächlich bis zur Parusie dauern wird, aber immer auf der Stelle tritt (So Rosenstock, Briefe 681).
So ist die Kirche demgegenüber auch in ihrer entartetsten Gestalt ein Lebewesen jenseits aller Völker und Völkergrenzen, Ursprung einer neuen Einheit, mit ihrer erst in der Parusie endenden Individualisierung, eine ganz andere Wiedergeburt des Gleichen als die von Nietzsche gefürchtete ewige Wiederkehr (Rosenstock, Briefe 683). Aus dieser Sicht der offenbarungsbestimmten Geschichte erklärt sich denn auch Rosenstocks verwegene Anrede an Rosenzweig »Lieber Mitjud post Christum natum post Hegel mortuum« (Briefe 655).
Die unauflösliche Gemeinschaft von Jude und Christ in der offenbarungsorientierten Wirklichkeit
Wie reagiert der Jude auf solche freundschaftliche rabies theologica des Christen? Er widerspricht nicht, sondern er stimmt zu, freilich von seiner eigenen Position aus. Denn er hat eine Gegenfrage zu stellen, gegen die, ob der Jude sich zu jemand anderem als Christus bekehren könne. Der Jude fragt: Kann ein Mensch — auch der Christ — sich zu jemand anderem als zu Gott bekehren? Alles, was Rosenstock über die Synagoge sagt, kann Rosenzweig akzeptieren. Denn ihm geht es um etwas ganz anderes. Gerade so, mit Augenbinde und gebrochenem Stab steht die Synagoge bei Gott, zu dem der Heide durch Christus erst kommt. Und darum gilt: »Ihr werdet uns nicht los, . . . Wir sind der innere Feind — Verwechseln Sie uns nicht mit dem äußeren« (Rosenzweig Briefe 686).
Denn in dieser Verwechslung sieht Rosenzweig einen theologischen Hauptfehler Rosenstocks. Er spricht so über die Juden, als ob er sie als Heiden betrachte (Briefe 686). Rosenzweig erinnert ihn: Armut, Starre, Offenbarungslosigkeit der Synagoge — all das sind die Folgen davon, daß sie das Joch des Himmelsreiches auf sich genommen hat und darum jene eschatologische Existenz lebt, mit der sie wie jener persische Höfling bei Herodot der Kirche mit dem ständigen Ruf in den Ohren liegt: »Despota, memneso ton eschaton« (Briefe 690). Aus dem gleichen Grund kritisiert Rosenzweig Rosenstocks Vergleich zwischen Abraham und Agamemnon. Denn Abraham opfert nicht wie Agamemnon ein Kind, sondern alle verheißenen Zukünfte, so wie die Synagoge alles opfert außer dem nackten Dasein (Briefe 689).
Damit provoziert Rosenzweig freilich den umgekehrten Vorwurf von Rosenstocks Seite. Er wiederum verwechselt die Kirche mit der Nationenwelt. Denn wenn diese sich selber in Nationalismus zum Programm erhebt, so ist das Ergebnis keineswegs wie Rosenzweig glaubt, »Ethnismos«, die Freiheit geschichtlichen Völkerlebens, sondern vielmehr Imperialismus, Nachfolge der von der Kirche vermittelten Tradition des Imperium Romanum, mit dem die Kirche wohl häufig gleichgesetzt worden, aber in der geschichtlichen Realität niemals identisch gewesen ist (Briefe 694). Die Diskussion dieser Argumente veranlaßt lange und gehaltvolle Erörterungen beider Briefpartner über die bestehende oder nicht bestehende Inhaltsgleichheit jüdischer und christlicher Frömmigkeit.
In diesem Fall ist es wohl Rosenzweig, der das Definitive sagt: »Nur für Juden und Christen besteht jene feste Orientierung der Welt in Raum und Zeit, besteht die wirkliche Welt und die wirkliche Geschichte, besteht Norden und Süden, Vergangenheit und Zukunft, die nicht Gottes sind (das ist verdammt leicht gesagt — im Koran und übersetzt im west-östlichen Diwan), sondern die Gottes geworden sind, werden sollen und deswegen auch sind» (Briefe 717).
Wir betonen nochmals: Rosenzweig widerspricht gerade dort nicht, wo Rosenstock seine Lehre über die Offenbarung Gottes durch die Inkarnation in Jesus Christus vorträgt. Auch er ist zutiefst davon überzeugt, daß, wenn die Offenbarung Gott selber und nichts außerdem zum Inhalt hat, es nur eine Offenbarung und darum auch nur einen Heilsweg geben kann. Alle Differenzen und Antagonismen zwischen Juden und Christen resultieren darum aus der geschichtlichen Wirklichkeit dieser Offenbarung und dem eschatologischen Charakter ihrer Weltorientierung auf das Kreuz, das bindet und scheidet zugleich.
Aber eben hierin ist es auch begründet, daß Konfrontation und Gemeinschaft zwischen Jude und Christ nur dort abreißen, wo der eine oder der andere seinen Glauben verleugnet. Die Sprachlichkeit der Offenbarung jedenfalls wird es ihrem Glauben immer ermöglichen an der kontrastreichen Wechselrede festzuhalten, in die sie nun einmal getreten sind: »aber so Ich und so Du sagen und das Ich und das Du so durch Haben zu verbinden, das kann nur Jude und Christ, sonst niemand« (Briefe 727 f.).
3. Die sprachliche und strukturelle Systematik der Zuordnung von Wahrheit und Wirklichkeit im neuen Denken
Einordnung in Philosophie- und Theologiegeschichte
Nach der herkömmlichen geisteswissenschaftlichen Historiographie bewegt sich das Leipziger Gespräch und auch der Briefwechsel von 1916 abseits der Hauptströme philosophischen und theologischen Denkens im 20. Jahrhundert. Jener wird nach der herrschenden Auffassung bestimmt durch die Abkehr von aller Metaphysik, die sich in die beiden Hauptarme der Ablehnung des Systemdenkens aufteilt, in den existentialistischen und den logisch-empiristischen Positivismus. Auf theologischer Seite korrespondiert dem die gemeinsame Distanz liberaler und dialektischer Theologie von der kirchlichen Tradition. In der Tat: Weder Rosenstock noch Rosenzweig sind einem dieser Lager zuzuordnen und stehen jeder in seiner Weise isoliert.
Aber wenden wir ihre eigenen Maßstäbe geschichtlicher Urteile an, indem wir danach fragen, wieviel an geschichtlicher Wirklichkeit in ihr Denken eingegangen ist, dann kommen wir zu ganz anderen Ergebnissen. Wenn jemand, dann haben sie die einzigartige Rolle der Judenfrage im 20. Jahrhundert so erkannt, wie es Rosenzweig einmal im Gefolge des Leipziger Gespräches nach der Begegnung mit einem wohlmeinenden liberal-protestantischen Pfarrer brieflich gesagt hat: »Und vom christlichen Standpunkt (und verzeihen Sie, Herr Pfarrer, erst der interessiert uns bei einem Christen, wie die Sache vom jüdischen Standpunkt her aussieht, wissen wir schon allein), also vom christlichen Standpunkt aus ist es« — das Judentum — »auch nicht tot. Beweis: . . . daß die Christen das Alte Testament benützen und der Pfarrer J., im Einverständnis mit der neueren Wissenschaft, in den Propheten Zeugnisse eines reinen und starken Monotheismus erkennt. Das ist eine >Lebendigkeit<, die wir gemein hätten mit den alten Athenern, deren Dramen noch heut im Lehrplan der Gymnasien stehen und die noch heut Herrn Oberlehrer Bunke aus Dräs‘en eine Quelle reinster Erhebung und Beglückung bieten. Oder eine Unsterblichkeit, wie sie der große Alexander genießt, welcher — >Staub und Lehm geworden< — nun >ein Loch wohl vor dem rauhen Norden< verstopfen darf. Viel Ehre Herr Pfarrer! Aber wir allzu ehrgeizigen Juden wollen uns nicht einmal mit so viel Ehre begnügen und statt zufrieden zu sein >vor Sturm und Wetter eine Wand zu verkleben<, reden wir uns ein, daß die Welt noch heute vor uns >erbeben< müßte; der Schädel, über dem Sie mit Ihrer Kirche ein melancholisch-geistreiches Alas poor Yorick rufen, hält sich selbst noch für arg lebendig und glaubt noch einmal die ganze Tischgesellschaft zum Weinen zu bringen — die vorläufig zwar nur über ihn lacht, aber ihm selbst damit immerhin bezeigt, daß er noch lebendiger ist, als sie Wort haben will« (Briefe 67).
Aber auch Rosenzweigs Schulprogramm von 1916 »Volksschule-Reichsschule« (Kleine Schriften 420 ff.) zeigt in allem, was es über eine philosophische Behandlung der Mathematik, einen nicht auf den Horizont der eigenen Nation beschränkten Geschichtsunterricht und die grundsätzliche Vielsprachigkeit der zweiten Bildungsstufe fordert, eine so eminente Klarheit über den Charakter unserer Zeit, daß wir in der Nichtwirksamkeit dieses Denkens jedenfalls einen der Gründe für die offenkundige Hilflosigkeit unserer Gesellschaft gegenüber den Erfordernissen der Epoche anerkennen müssen.
Wir können dieses Urteil auch anders ausdrücken. Rosenstock und Rosenzweig kritisieren wie viele Zeitgenossen das idealistische Systemdenken, aber im Unterschied zu ihnen nicht in der Absicht, das Systemdenken überhaupt zu diskreditieren. Sie werfen den großen Idealisten nicht vor, daß sie Systeme konzipiert haben, um die Einheit der Wirklichkeit denkend zu erfassen. Im Gegenteil. Sie sehen darin einen unausweichlichen Imperativ, vor dem auch die nicht fliehen können, denen mittlerweile deutlich ist, in wie vieler Hinsicht jene idealistischen Systeme ihrem Anspruch nicht genügen. Aber diese Einsicht ist keine Rechtfertigung für die Flucht in Skeptizismus und Agnostizismus, wie ihn eine methodisch uferlose und sachlich anarchische Spezialisierung produziert.
Darum muß aufs stärkste unterstrichen werden: Beide Autoren betonen im Briefwechsel, wie sehr es ihnen um »den Schritt ins System« geht, wie sehr für sie das neue Denken systematischen Charakter hat. So kann Rosenzweig in jenem eingangs zitierten Nachwort sich besonders darüber beklagen, daß man am »Stern« eines nicht verstanden hat: Er ist ein System der Philosophie (Kleine Schriften 374). Aber auch der geradezu als Inbegriff des asystematischen Denkers und der Sprunghaftigkeit verschrieene Rosenstock erklärt im Briefwechsel von 1916, er glaube den »erlösenden Schritt ins System« getan zu haben (a. a. 0. 641). Welcher Art aber ist eine Systematik, die sich in ebensolchem Gegensatz zu der des Idealismus wie der agnostizistischen Systemlosigkeit des Positivismus weiß?
Rosenzweigs Entdeckung der systematischen Bedeutung von Metalogik und Metaethik
Rosenzweig hat die Systemkonsequenzen seines mündlichen und brieflichen Dialoges mit Rosenstock in mehreren Briefen gezogen, von denen der am 18. 11. 1917 an Rudolf Ehrenberg gerichtete und als »Urzelle« des »Stern« in den Kleinen Schriften 357—372 gedruckte der bei weitem wichtigste ist. Er beginnt mit einer Erinnerung an gemeinsame Diskussionen des Offenbarungsbegriffes mit Rudolf Ehrenberg auf einer Harzwanderung im Jahre 1914, um dann in eine Paraphrase von Rosenstocks Brief vom 28. 10. 1916 (Briefe 675—680) überzugehen, mit der Rosenzweig festhält, daß er aus diesem Brief die über alles weitere entscheidende Antwort empfangen hat: Offenbarung ist Orientierung.
Dieser Satz ist oben kommentiert und diskutiert worden. Für Rosenzweig wurde er der Anlaß, den ersten Systementwurf des neuen Denkens, eben die »Urzelle« des »Sterns« zu konzipieren. Es sei unterstrichen: der Offenbarungsbegriff war es, der als Organon einer neuen Systematik gewirkt hat. Und diese Tatsache wohl ist es hauptsächlich gewesen, die zu dem religionsphilosophisch verengten Mißverständnis des neuen Denkens geführt hat. Man kann die Bedeutung des Offenbarungsbegriffes für die neue Systematik aber nicht erläutern, ohne auf den eigentlichen Philosophen des neuen Denkens — neben dem Juristen Rosenstock und dem Historiker Rosenzweig — auf Hans Ehrenberg hinzuweisen, der in der »Urzelle« mehrfach als entscheidender philosophischer Gewährsmann genannt wird. Und dies mit Recht. Ist es doch Hans Ehrenberg gewesen, der in seinen Fichte-Untersuchungen (zusammengefaßt in Disputation, Bd. 1, München 1923) nachgewiesen hat, welche Schlüsselfunktion dem Begriff der Offenbarung in der idealistischen Systemgeschichte zukommt. Es sei dies besonders deswegen betont, weil in letzter Zeit mehrfach die Meinung geäußert worden ist, die Konzeptionsphase des »Sterns« habe unter dem Einfluß von Cohens Spätwerk gestanden. Wie irrig dies ist, haben unsere bisherigen Darlegungen schon gezeigt, ist aber auch von Rosenzweig selbst in jenem Nachwort zum »Stern« ausdrücklich festgestellt worden.
Wie nicht anders möglich, geht Ehrenbergs Nachweis von Kant aus und zeigt, wie die systembestimmende Rolle des Offenbarungsbegriffes schon in dessen Philosophie angelegt ist. In dem von uns bereits zitierten Aufsatz von 1786 »Was heißt: Sich im Denken orientieren?« entwickelt Kant, wie ein vernünftiges Gottesbewußtsein seine Verantwortung dadurch wahrnimmt, daß es sich zur Kritik und gleichzeitig selbst zum Kriterium aller Offenbarung aufwirft. Ich finde es nirgendwo so deutlich wie von Ehrenberg analysiert, daß es diese Offenbarungslehre Kants ist, von der Fichte ausgeht, wenn er die gesamte Arbeit der kritischen Philosophie zusammenzufassen sucht unter dem Titel einer Kritik aller Offenbarung (1792). Ehrenberg zeigt nun, daß genau hier die Vorstufe der zwei Jahre jüngeren »Wissenschaftslehre« zu suchen ist. Denn — so Ehrenberg — der Ursprung des absoluten Ich ist religionsphilosophisch. Der Begriff des Ich ist entwickelt worden aus einer Gotteslehre, in welcher Gottes gesamte Aktivität identifiziert worden ist mit dem Akt der Selbstoffenbarung des göttlichen Ich.
Die weitere idealistische Systemgeschichte wird dann dadurch bestimmt, daß der Begriff der Offenbarung als systematischer Zentralbegriff den der Schöpfung eliminiert und ersetzt. So vor allem bei Fichte selbst, in dessen »Wissenschaftslehre« von 1812 es folgendermaßen heißt. »Gott ist: richtig. Er offenbart sich: richtig — in der Erkenntnis nämlich, durchaus nur in ihr. Was ist, ist Gott in ihm selber und seine Offenbarung, die letztere: Erkenntnis. Was außerdem noch zu sein scheint, scheint eben nur zu sein, in der Erkenntnis nämlich« (zitiert nach Ehrenberg, Disputation 1, 205). Die systematische Bedeutung des Offenbarungsbegriffes wird hier für jedermann erkennbar. Offenbarung, das ist im System des Idealismus der Zentralbegriff der Vermittlung. Er eignet sich dafür, weil er, als Selbstoffenbarung Gottes verstanden, zugleich das Modell bilden kann für das Verhältnis von absolutem und endlichem Geist, für die Selbstvergewisserung des endlichen Geistes im absoluten. Denn so wird es später Schelling ausdrücken: Offenbarung ist Urwissen. Bekanntlich ist auch Hegel in der Tradition dieses Offenbarungsverständnisses geblieben, wenn er seine Logik interpretierte als die Darstellung des Wesens Gottes in sich selbst, die anderen Teile seines Systems dementsprechend als das Aus-sich-heraustreten Gottes in seiner Offenbarung.
Rosenzweig beschreibt nun in der »Urzelle« seine Aufgabe so, daß es gelte, den neuen Offenbarungsbegriff dergestalt zu bewähren, daß argumentativ gezeigt wird, welche neuen Wirklichkeiten er aufzudecken vermag, denen das von 1800 her bestimmte philosophische Bewußtsein bisher verschlossen ist. Freilich darf das nicht auf den beliebten trivialen Einwand hinauslaufen, jene Absolutheit von 1800 sei eine bloße historische Selbsttäuschung und insofern nur eine sich selbst überhebende Relativität gewesen. Damit wäre man nur in jenen Relativismus zurückgefallen, von dem Rosenzweig so tief überzeugt war, daß er ihm für immer verboten sei. Wenn dieser Weg des Relativismus aber als Abweg erkannt darum für immer verbaut ist, bleibt nichts übrig als zuzugeben: das absolute Bewußtsein von 1800 war keine Selbsttäuschung, sondern Wahrheit, aber eben darum auch eine historische Tatsache.
Rosenzweig konnte mit Recht meinen, damit ein ganz neues Verhältnis des Absoluten und Relativen entdeckt zu haben, nämlich dasjenige, in welchem nicht das Relative dem Absoluten inhärent, sondern das Umgekehrte gilt: »Der Mensch hat zweierlei Verhältnis zum Absoluten, eines, wo es ihn hat, aber noch ein zweites wo er es hat« (Kleine Schriften 359).
Das heißt dann aber, daß das Auftauchen des absoluten Bewußtseins an einem bestimmten Datum der Geschichte nur eine allgemeinere Wahrheit belegt. Die Geschichte, weit entfernt ein Konglomerat von Zufällen zu sein, ist vielmehr der Bereich einer ganz bestimmten Weise der Manifestation von Wahrheit: »Ich glaube, es gibt im Leben alles Lebendigen Augenblicke oder vielleicht auch nur einen Augenblick, wo es die Wahrheit spricht. Man braucht also vielleicht überhaupt nichts über das Lebendige zu sagen, sondern man muß nur den Augenblick abpassen, wo es selber sich selber ausspricht. Der Dialog, den diese Monologe untereinander bilden (daß sie einen Dialog untereinander machen, ist das große Weltgeheimnis, das offenbare, offenbarte, ja, der Inhalt der Offenbarung . . . also den Dialog aus diesen Monologen halte ich für die ganze Wahrheit« (Rosenzweig, Briefe 712).
Ganz unerwartete Perspektiven, die sich hier auftun. Denn wenn das Sprechen der Wahrheit ein bestimmter, auch historisch oder biographisch datierbarer Moment ist — was gilt dann über das Vorher und das Nachher?
Das noch nicht oder nicht mehr sprechende Lebendige ist doch nicht einfach noch gar nicht oder nicht mehr vorhanden. Und wenn man das verneint, dann muß man sagen können, als was das noch nicht oder nicht mehr sprechende Lebendige dann existiert. Eben als eines, für den jener Moment des Sprechens kommen kann. Rosenzweig hat erkannt, daß dies nicht in Möglichkeits- oder Eigenschaftskategorien beschrieben werden kann. Der Mensch, der die nur ihm eigene Wahrheit sagen kann, das ist weder das Subjekt der Ethik noch das einer Biologie oder Anthropologie. Es ist das, was Rosenzweig im Stern« das Metaethische oder das Selbst des Menschen nennen wird. Wir halten es für besonders bedeutsam, daß Rosenzweig im Gegensatz zu allem philosophischen Irrationalismus, auch dem existentialistischen, die systematische Bedeutung des Metaethischen erkannt und in ihrer Bedeutung entwickelt hat. Der Mensch als das Metaethische, das heißt den Menschen verstehen als Relationsbegriff im Sinne der Kommunikationsform Leben.
Aber wir haben es gehört: Rosenzweig geht davon aus, daß für alles Lebendige jener Augenblick des Aussprechens der Wahrheit kommen kann. Darum tritt auch die außermenschliche Wirklichkeit in das Licht dieser neuen Perspektive. Wenn Leben nicht nur ein biologischer Ablauf oder eine unbestimmbare Kraft, sondern eine Kommunikationsform ist, dann kann auch nicht von vornherein als festgelegt gelten, was an ihr partizipiert oder nicht. Und wiederum entdeckt Rosenzweig einen kategoriell bisher noch gar nicht erfaßten Aspekt der Wirklichkeit. Im »Stern« wird er ihn das Metalogische, die Welt oder ihren Sinn nennen. Eine terminologische Entscheidung von erheblicher systematischer Tragweite. Denn Welt hat hier aufgehört ein reiner Strukturbegriff im Sinne von Kosmos oder ein bloßer Maximalwert im Sinne des Universums alles Seienden zu sein. Welt wird hier vielmehr als ein Wirklichkeitsbegriff verstanden, der an der reinen Tatsächlichkeit der Dinge orientiert ist.
Wir haben gesehen, daß die Explikationen des im Dialog mit Rosenstock gewonnenen neuen Offenbarungsbegriffes weit hinausgreifen über Religion und Theologie. So ist es denn auch gar nicht erstaunlich, daß Rosenzweig schon zwanzig Jahre vor Bonhoeffer, und wohl auch in einem theologisch präziseren Sinn als dieser, ein Bewußtsein hatte vom rnetareligiösen Charakter jüdischen und christlichen Glaubens: »Die Sonderstellung von Judentum und Christentum besteht gerade darin, daß sie, sogar wenn sie Religion geworden sind, in sich selber die Antriebe finden, sich von dieser ihrer Religionshaftigkeit zu befreien und aus der Spezialität und ihren Ummauerungen wieder in das offene Feld der Wirklichkeit zurückzufinden. Alle historische Religion ist von Anfang an spezialistisch gestiftet, nur Judentum und Christentum sind spezialistisch erst, und nie auf die Dauer, geworden und gestiftet nie gewesen. Sie waren ursprünglich nur etwas ganz Unreligiöses, das eine eine Tatsache, das andere ein Ereignis« (Kleine Schriften 390 f.).
Aus dem gleichen Wissen resultiert wohl auch der historische Scharfblick, der Rosenzweig schon ein halbes Jahrhundert vor der Genfer Weltkonferenz für Kirche und Gesellschaft feststellen ließ: «Für uns handelt es sich jetzt um 1789. Die Kirche hat seitdem kein Verhältnis mehr zum Staat, sondern nur zur Gesellschaft« (Briefe 706).
Vergleicht man den hier nur angedeuteten Erkenntnisreichtum des neuen Denkens mit Rosenzweigs Vorschlag, dieses als »absoluten Empirismus« zu charakterisieren (Kleine Schriften 398), so kann man nur bedauern, daß er hier zwei Termini verwendet und in einer Weise verbindet, die den Errungenschaften dieses Neuansatzes direkt widerspricht. Denn die Erfahrung, um die es hier ging, war gerade etwas ganz anderes als das, was man als Empirismus zu bezeichnen pflegt, und das Adjektiv »absolut« ist völlig ungeeignet, diesen Unterschied zu kennzeichnen.
Rosenstocks Formulierung einer Fundamentalgrammatik für Psychologie, Soziologie und Geschichte
Rosenstock hat die Systemaspekte des neuen Denkens im Unterschied zu Rosenzweig nach mehreren Seiten hin aufgerollt. Das erste war seine Antwort auf die im Dezember 1916 von Rosenzweig gestellte Frage: »Wenn Sie mir über Einzelheiten schreiben wollen, so bitte über die Sprachen. Ich bin auf komischen empirischen Umwegen da, glaube ich, sehr in Ihre Nähe gekommen, was ich freilich auch wollte, ich wußte nur nicht, wie es anfangen« (Briefe 720). Daß Rosenstock diese Bitte wirklich erfüllt und brieflich geantwortet hat, bezeugt Rosenzweig in einem Brief an Rudolf Ehrenberg vom 29. 3. 1916 (Briefe 179).
Dies um die Jahreswende 1916/17 bzw. im Frühjahr 1917 entstandene Schriftstück von Rosenstock ist demnach das älteste Dokument dessen, was unter den irreführenden Titeln »Sprachdenken« oder gar »Personalismus«, »Ich-Du-Prinzip« in den neueren Philosophiegeschichten aufzutreten pflegt.
Diese Kennzeichnungen müssen aus theologischen wie sprachtheoretischen Gründen zurückgewiesen werden. Denn Rosenstock proklamiert hier nicht irgend ein Prinzip, sondern entwickelt lediglich die Gedanken seines mehrfach erwähnten Briefes über Offenbarung, nach welchem Sprache und nicht Religion die primäre Ebene und das primäre Medium der Relation Gottes und des Menschen ist. Die Sprache ist das Indiz dafür, daß man den Menschen in letzter Instanz nur als den Angeredeten Gottes definieren kann.
Weitaus irriger noch sind jene oben genannten Kennzeichnungen in sprachtheoretischer Hinsicht. Denn keineswegs geht Rosenstock aus von einer Gleichzeitigkeit des Ich mit dem Du. Grundgedanke seiner Sprachlehre ist vielmehr die aus Anrede und Imperativ resultierende Priorität des Du. Die Konstituierung eines Ich und eines ihm entsprechenden Ichbewußtseins erklärt Rosenstock als eine Reaktion, die auf Anrede und Imperativ erst nachträglich folgen kann. Die dritte Person, das Er, Sie, Es der Grammatik interpretiert Rosenstock als ein drittes Stadium, das der objektivierenden Versachlichung, das nicht, wie weithin geschieht, als die Ausgangslage des Bewußtseins betrachtet werden darf.
Diesen sprachlichen Aggregatzuständen der Sprache ordnet Rosenstock die Tempora zu. Den Imperativ, wie wir schon sahen, der zweiten Person, dem Ich die konjunktivischen und voluntativen Tempora. Der Indikativ, der von Haus aus durchaus nicht präsentischen Charakter besitzt — man vergleiche nur das Hebräische —‚ gehört zur Sphäre der dritten Person.
Rosenstocks Analyse der grammatischen Personen erweist ihre Fruchtbarkeit auch in soziologischer Hinsicht. Kann doch alles, was über den Bereich der zweiten Person und des Imperativs gesagt wurde, als wirksam wiedererkannt werden in der mündlichen Praxis des geistlichen und weltlichen Rechtes. Die Kunst dagegen erweist sich unter den Voraussetzungen dieser Sprachlehre als die soziologisch umfassendste Verallgemeinerung des konjunktivischen und voluntativen Sprechens im Stil der ersten Person. Und niemand kann es ernsthaft bezweifeln, daß die Sprache der Wissenschaft nichts anderes ist als eine Sonderform der Objektivierung, wie sie den Genera der dritten Person entspricht (Rosenstock-Huessy, Die Sprache des Menschengeschlechts, Bd. 1, Heidelberg, 1963, 783).
Welche unmittelbar politisch-moralische Bedeutung dieser Fundamentalgrammatik zukommt, vermochte sie schon 1919 in der Auseinandersetzung mit Spenglers »Untergang des Abendlandes« unter Beweis zu stellen. Während die akademische Schulwissenschaft in einer Fülle von Einzelkorrekturen die Ohnmacht des Spezialistentums so bestürzend offenbarte, wie jenes berühmte Spenglerheft der Zeitschrift »Logos« von 1921 und ein Theologe wie Gogarten Spengler mit unverhohlenem Jubel begrüßte, war Rosenstock der einzige, der erkannte, mit wes Geistes Kind man es in diesem Buch zu tun hatte. »Sein Werk enthüllt, wie tief die Krankheit des europäischen Geistes bereits gefressen hat, daß er seiner Erneuerung aus ewigen Quellen stolz ausweicht. Spengler will nicht leben. Das ist das Grausige einer solchen Erscheinung, daß die Seele hier all ihre Geheimkräfte aufbietet, um zu sterben« (Rosenstock-Huessy, Die Sprache . . .‚ Bd. 2, Heidelberg 1964, 72).
Im Unterschied zu allen anderen, die sich mit einer Rektifizierung der zahlreichen Einzelirrtümer Spenglers begnügten, setzt sich Rosenstock schon 1919 mit jener kulturmorphologischen Hauptthese auseinander, die die Einheit der Menschheitsgeschichte preisgibt, aber mit Toynbee ein unbestrittenes Hausrecht in der akademischen Universalgeschichte erobert hat.
Rosenstock hielt dem schon am Anfang unseres katastrophenreichen Jahrhunderts entgegen, daß Spengler als ein typischer Vorkriegsdenker nur jene klassizistisch-tragizistische Kulturidee festzuhalten versucht, die schon Gibbons »Niedergang und Fall des römischen Imperiums« (1787) bestimmt hatte.
Rosenstock tritt dem entgegen mit dem Bewußtsein, daß eine wirkliche Geschichtsmorphologie nicht in einer Weise von der Geschichtlichkeit der Sprache abstrahieren kann, wie es schon der Titel des Spenglerschen Werkes verrät. Verwendet er doch für ein durch und durch nichtchristliches Buch den christlichen Begriff des »Abendlandes«, anstatt wie er es müßte, den des klassizistischen »Europa« zu gebrauchen. Das Wort »Untergang« aber offenbart den Versuch, als Schicksal hinzustellen, was doch die offenkundige Folge politischen Handelns war. Darum konnte Rosenstock seine ganze Kritik zusammenfassen, indem er den Titel »Untergang des Abendlandes« übersetzte in »Der Selbstmord Europas«. Nur fünf Jahre nach dieser Spenglerkritik geschah es, daß Rosenstock seine Sprachlehre neu formulierte und unter dem Titel »Angewandte Seelenkunde« veröffentlichte. Den Kern dieses Textes bildet der oben referierte Sprachbrief an Rosenzweig. Rosenstock hatte ihn jetzt erweitert zu dem, was in einer Zwischenüberschrift jenes Werkes »Grammatik der Seele« genannt wird. Damit ist das Ziel dieses seines Vorstoßes ausgesprochen, eine Neuorientierung der Nachkriegspsychologie anzuregen, die zugleich die Brücke zu der in Universität und Gesellschaft immer wichtiger werdenden Soziologie schlug.
Denn das charakterisierte den bedrohlichen Zustand der Gesellschaft nach 1918: Während die wissenschaftliche Psychologie den Menschen auf ein Funktionsbündel von Nerven, Trieben und Reizen reduzierte, unbekümmert darum, wie sich das zum übrigen Inhalt seines Lebens verhalte, blühte im Hintergrund eine Subkultur des Okkultismus, deren Gefährlichkeit im umgekehrten Verhältnis zu ihrer Nichtachtung durch Theologie, Medizin, Psychologie und Soziologie stand.
Bereits in der Spenglerkritik hatte Rosenstock (Sprache . . .‚ Bd. 2, 74) von der Bedeutung der Revolutionen für den Gesamthaushalt der Geschichte gesprochen. Ein bedeutsamer Ausdruck. Bezeichnet er doch genau, worum es Rosenstock in seiner Kritik an Psychologie und Soziologie ging, nämlich um ihr gänzlich unerklärtes Verhältnis zur Geschichte als dem Inbegriff der Vollwirklichkeit menschlichen Lebens. Titel und Untertitel von Rosenstocks 1931 erschienenem ersten Hauptwerk bringen diesen Zusammenhang von Geschichte, Psychologie und Soziologie sehr treffend zum Ausdruck, wenn sie die »Europäischen Revolutionen» im Blick auf Volkscharaktere und Staatenbildung zu behandeln versprechen. Auch dieses Konzept taucht schon damals im Dialog mit Rosenzweig auf, interessanterweise in einem Brief des letzteren, wo dieser sich gegen Rosenstocks gegenteilige Annahme als eifriger Schüler dieser Lehre von der Revolution bekennt und dabei schon auf Rußland als Bestätigung der Rosenstockschen Voraussagen hinweist (Briefe 268).
4. Schluß
Die Entdeckung des neuen Denkens wollten wir beschreiben. Eine merkwürdige Geschichte war da zu erzählen, die Geschichte davon, wie mehrere Wissenschaftler, fernab aller theologischen Schulen und kirchenpolitischen Fronten ihrer Zeit, mitten in ihrer juristischen und historischen Arbeit lange vor Ausbruch des Weltkrieges das eigene familiäre und akademische Milieu mit völlig neuen Augen betrachten müssen. Sie erschraken über das, was sie sahen. »Gutmütig klugheitsanbetend in Selbstauflösung begriffen« sagt Rosenstock (Briefe 663) gelegentlich, um zu beschreiben, warum sich ihm die Landschaft seines Lebens in Familie, Staat, Universtität und Kirche völlig verändert hatte.
1916 wußten beide Korrespondenten noch nicht, wie gefährlich dieses Neuland für sie werden würde. Als Rosenstock 1935, bereits nach seiner Emigration, nach den Bekenntnissynoden von Barmen und Dahlem, als sich das Scheitern des Kirchenkampfes bereits abzuzeichnen begann, sein Vorwort für die Edition der Briefe von 1916 schrieb, war es längst klar geworden: Die Front, an der gedacht und gekämpft wurde, war nicht mehr die der privaten oder persönlichen Existenz, sondern, wie Rosenstock Barth aufgreifend und neu interpretierend sagt, die der »theologischen Existenz heute«.
Ein beachtlicher Bedeutungszuwachs dieser bekannten Formel. Denn in Rosenstocks Sinn bedeutet theologische Existenz nicht mehr nur existenzielle Bewährung von Theologie, theologische Sachbezogenheit von Kirche, sondern bezieht sich, wie Rosenstock selber erläutert, auf die »ewigen, typischen, überpersönlichen Fragen des Daseins von Jude und Christ inmitten der Völkerwelt.«
Rosenstock ahnte wohl nicht, als er diese Worte schrieb, daß diese Fragen sich wenige Jahre später auf die eine des Seins oder Nichtseins der Juden reduzieren würden. Aber schon 1935 bezeugten diese 1916 geschriebenen Briefe: Wo über das Sein oder Nichtsein des Juden in der Völkerwelt entschieden wird, dort geht es auch um Sein oder Nichtsein der Christen.
Kreta-Berlin
Mai/Juli 1987