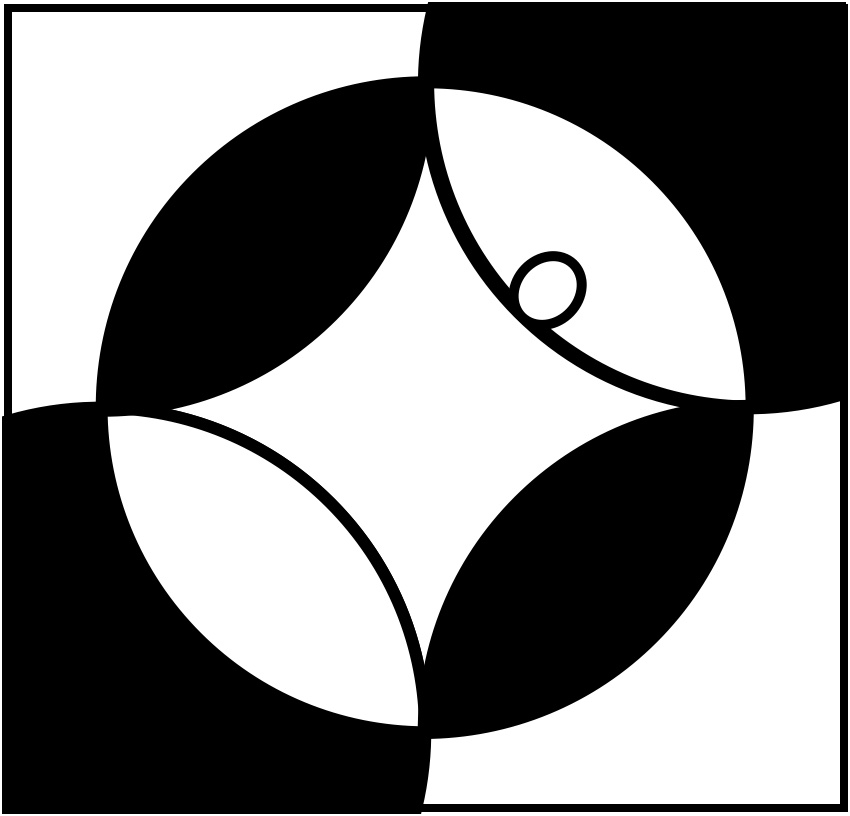Wolfgang Ullmann: Die Einheit der Offenbarung und die Dreiheit der Offenbarungsreligionen
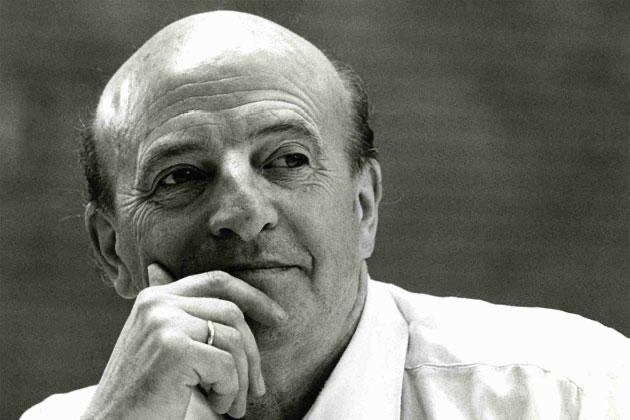
Das Religionsgespräch zwischen Franz Rosenzweig und Eugen Rosenstock-Huessy und seine Bedeutung für das Verhältnis von Islam und Christentum heute
1. Der alte und der neue Religionskonflikt
“Die Juden sind unser Unglück!” Dieser unter dem Datum des 15.11.1879 von Heinrich von Treitschke in den ‘Preußischen Jahrbüchern’ formulierte Satz sieht aus unserer heutigen Perspektive wie eine Stichflamme aus, die, auf verborgene Weise weiterglimmend, dann im Deutschland des 20. Jahrhunderts einen Flächenbrand hat auslösen helfen, in dem Kulturbestände ganz anderen Ausmaßes und Umfanges zugrundegegangen sind, als Treitschkes antisemitisches Pamphlet verteidigen wollte.
Ein Wetterleuchten hatte schon Wochen vor Treitschkes Essay begonnen. Der Berliner evangelische Hofprediger Adolf Stoecker thematisierte in einer Rede am 19. September 1879 das, was seither als die sogenannte ‘Judenfrage’ den politischen Diskurs in Deutschland emotionalisierte und vergiftete. Unter den scheinheilig bescheidenen Titeln “Ein wenig bescheidener - ein wenig toleranter - etwas mehr Gleichheit” führt Stoecker einen Generalangriff auf die gesellschaftliche Rolle der Juden im wilhelminischen Deutschland, der keines der Stereotypen auslässt, mit Hilfe derer bis in die Zeit des antijüdischen Terrorismus nach 1933 die deutsche Öffentlichkeit einerseits aufgehetzt, andererseits so weit verängstigt worden ist, dass sie wie schreckensstarr zusah, als ein Teil unbescholtener Bürger und Bürgerinnen planmäßiger Entwürdigung und Ausgrenzung aus dem sozialen und politischen Alltag unterworfen wurde.
Die Begründungen für diese Diskriminierungskampagne waren ebenso denunziatorisch wie weltfremd. Als kulturell, religiös und sozial nicht integrierbarer Fremdkörper seien die ohne Beschränkung aus dem Osten immigrierten Juden eine durch ihre Menge und Unintegrierbarkeit bedrohliche Belastung des deutschen Volkskörpers. Stoecker hält es nicht für nötig, seine Behauptungen zahlenmäßig zu untermauern und zu präzisieren. Pauschale, mit rhetorisch-demagogischem Geschick vorgebrachte Generalisierungen über jüdische Dominanz in Presse und anderen Teilen des Kulturlebens genügen Stoecker, um ein Bedrohungsszenarium zu entwerfen, genau so wie wir es heute aus der ‘Das-Boot-ist-voll-Rhetorik’ kennen. Die demagogische Infamie von Stoeckers Vorgehen besteht darin, dass er unter dem Deckmantel scheinbarer Bitten unterschwellige, aber durchaus hörbare Drohungen in die Öffentlichkeit wirft. “Ein wenig bescheidener…”, das heißt: Wir Deutschen sind bisher dem wachsenden jüdischen Einfluss kaum entgegengetreten. Wir können auch ganz anders! “Ein wenig toleranter!” - das heißt: Wir Deutschen haben es satt, euch Juden gegenüber Toleranz zu üben. Macht euch darauf gefasst, dass es jetzt ganz anders kommt. Und mit “Etwas mehr Gleichheit!” wird angedeutet, dass die nach der Französischen Revolution möglich gewordene Assimilation der Juden an die nichtjüdische Gesellschaft ihre Grenze erreicht hat und damit eine Beschränkung der Gleichheit unvermeidlich ist.
Was diese in Bitten verkleideten Kriegserklärungen aber im Tiefsten so unehrlich werden lässt, ist die Art und Weise, wie eine mächtige Mehrheit einer nichtsahnenden Minderheit gegenüber Todfeindschaft proklamiert, weil sie angeblich die herrschende Mehrheit angegriffen und in ihrem Existenzrecht gefährdet habe. Der so scheinfreundlich vorgetragene Frontalangriff sei also nichts weiter als eine legitime Verteidigungsaktion.
Treitschke und Stoecker fordern unisono ein vollständiges Aufsaugen alles Jüdischen in einer deutschen Nationalkultur, fügen aber sogleich einschränkend hinzu: “Die Aufgabe kann niemals ganz gelöst werden, eine Kluft zwischen abendländischem und semitischem Wesen hat von jeher bestanden.” (Treitschke , aaO.). Noch polemischer heißt es bei Stoecker: “Und unfruchtbar ist das Judentum wirklich, überall nur der Schatten der christlichen Kirche, in deren Bereich es sich findet: in Deutschland aufgeklärt und in Parteien zerrissen; in romanischen Ländern zwischen dem strengsten Talmudismus und dem Unglauben geteilt; bei den slawischen Völkern in Formeln erstarrt und verwesend wie der Islam selbst.” (Stoecker, Unsere Forderungen an das moderne Judentum).
Obwohl das 20. Jahrhundert den Beweis dafür erbracht hat, dass diese scheinbar zivilen und bescheidenen Bitten in der Tat Forderungen waren, die am Ende mit tödlicher Gewalt gegenüber einer wehrlosen Minderheit durchgesetzt wurden, wäre es müßig, nach über 120 Jahren in eine Polemik gegen die beiden Autoren und ihre Behauptungen über Judentum und Islam einzutreten. Denn nicht nur wäre alles, was wir vorzubringen hätten, notwendig durch den Fortgang der Geschichte ermöglichter Anachronismus. Viel wichtiger ist die Überlegung, dass, würde gegen Antisemitismus und Antiislamismus aus der Position von Liberalität und Toleranz argumentiert, die Antwort auf derartiges Argumentieren nur die Stoeckerschen Formeln sein könnten, die darauf hinauslaufen festzustellen, dass das Ende der Toleranz und der Bescheidenheit erreicht sei, weil - wie es in Treitschkes Text heißt - “in den Tiefen unseres Volkslebens eine wunderbare mächtige Erregung” arbeite. Dieser Erregung gegenüber haben nach Treitschke alle Appelle an Bildung und Toleranz ihr Recht verloren. Denn das erwachte Gewissen des Volkes wendet sich vornehmlich gegen die “weichliche Philanthropie unseres Zeitalters” (aaO.). Welche Autorität sollte gegen dieses “erwachte Gewissen” aufgeboten werden? Alles, was als Liberalität und Toleranz in Anspruch genommen werden könnte, würde als Ausdruck “weichlicher Philanthropie” zurückgewiesen werden. Sollten wir doch nie vergessen, dass in Treitschke einer der Hauptrepräsentanten des deutschen Liberalismus spricht!
Niemandem werden die Analogien zu den Argumentationsmustern unserer Tage entgangen sein, in denen besonders seit dem 11.9.2001 der Kernsatz freilich lautet: “Der Islam ist unser Unglück!” Auch wenn immer wieder versichert wird, die politische Front richte sich nicht gegen den Islam als solchen, sondern gegen dessen Perversion zum islamistischen Terrorismus: Im Hintergrund wirkt offen oder unterschwellig die Huntington-These mit ihrem zweiwertigen Geschichtsbild der modernen Kultur des Westens auf der einen und dem vormodernen Fundamentalismus des orientalischen Islam auf der anderen Seite, das genau wie Stoecker und Treitschke Judentum und Islam als einen noch zu zivilisierenden und - wenn nötig auch mit Gewalt - zu modernisierenden Rückstand der Weltkultur betrachtet.
Worauf es hier ankommt ist die Klarstellung: An kritischen Einwänden gegen diese Kulturkriegsthese Huntingtons hat es weder von seiten der Historie noch der Politologie von Anfang an gefehlt. Aber trotz ihrer aller Kritik hört sie nicht auf, das politische Handeln des Westens nicht nur zu beeinflussen, sondern sogar zu bestimmen. Wer diese These entkräften will, braucht darum nicht nur argumentativ einsetzbares Detailwissen. Er braucht einen völlig anderen Kompass als den Huntingtons und seiner Schüler. Er bedarf einer Art Aufklärung, die nicht nur die Kategorien des Liberalismus, sondern auch die seiner Kapitulation vor den verschiedensten Typen des Fundamentalismus aus dem Felde zu schlagen vermag.
2. Offenbarung als Krisenzentrum von Idealismus und Geisteswissenschaft
Aber woher soll die Aufklärung der zur Selbstbehauptung mit allen Mitteln aufgestachelten Identität kommen? Welche Wissenschaft verfügte über den Kompass, mit dessen Hilfe aus den unsicheren Brandungen des Kulturkrieges hinausgesteuert werden könnte? Sprachen doch in Stoecker und Treitschke die Repräsentanten der beiden Kulturmächte Kirche und Universität, die jede für sich aber auch gemeinsam beanspruchten, diejenigen Autoritäten zu sein, an denen die gesellschaftliche Öffentlichkeit sich zu orientieren habe, wenn es darum ging, ihr Selbstverständnis zu formulieren und zu verteidigen.
Aber wir haben es gerade gesehen: Die Äußerungen Stoeckers wie Treitschkes laufen auf Inkompetenzerklärungen hinaus. Treitschke beruft sich, offenkundig von Stoecker dazu angeregt, auf die Anonymität der “Tiefen des Volksgewissens”. Das Stoeckersche “Wir”, das seine als “Bitten” kaschierten Forderungen an die Juden richtet, vermeidet es sorgfältig klarzustellen, in wessen Namen und auf Grund welchen Mandates es seine Stimme erhebt. Weder die Theologie noch die Kirche sind Legitimationsinstanzen der Stoeckerschen Agitation.
Insofern könnte eingewandt werden, eben weil wir es mit politischer Agitation zu tun haben, dürfe man gar nicht erwarten, dass sie sich durch Benennung der von ihr vertretenen Instanzen zu legitimieren versucht. Aber das Bild verändert sich nicht im Mindesten, wenn wir vom Agitator Stoecker weg auf einen herausragenden Repräsentanten der Universitätstheologie wie Harnack blicken. Er war gewiss kein Parteigänger des Stoeckerschen Vulgärantisemitismus. Aber auch er teilte jene Kulturvorurteile des deutschen Idealismus gegenüber dem Judentum, die schon Schleiermacher bewogen hatten, das Alte Testament aus dem biblischen Kanon auszuscheiden. Und er teilte diese Vorurteile nicht nur, sondern gab ihnen am Ende seiner wissenschaftlichen Laufbahn theologischen Nachdruck, indem er Marcions antijüdisches “Evangelium von fremden Gott” als die einzig legitime Botschaft eines Neuen Testamentes erklärte, dessen Funktion dann nur in der Entautorisierung des Alten bestehen konnte.
Was hier beschrieben wurde, das genau war der Hintergrund jenes Leipziger Gespräches vom 7. Juli 1913, in dem die drei Wissenschaftler, der Rechtshistoriker Rosenstock, der Philosoph Rosenzweig und der Biomediziner Ehrenberg so miteinander sprachen, dass für einen von ihnen, den Philosophen Rosenzweig eine auch die persönliche Religionszugehörigkeit betreffende wissenschaftliche Umorientierung die Folge war.
Ich habe vor einigen Jahren (in stimmstein 2, 1988, S. 147-188) das Leipziger Gespräch als ein “Religionsgespräch” bezeichnet. Das gedenke ich nicht zurückzunehmen. Ich möchte aber jetzt mit mehr Nachdruck als in jener Abhandlung darauf bestehen, dass der Anlass des hochbedeutenden Gespräches ein wissenschaftlicher war: die Erfahrung jenes Kompetenzverlustes, die gerade geschildert worden ist, indem erinnert wurde, wie ein konservativer Hofprediger die Kampfbegriffe des Liberalismus nutzt, um antisemitische Vorurteile nicht theologisch begründen zu müssen und der Sprecher des Nationalliberalismus die antisemitische Agitation als angeblichen Aufbruch des Volksgewissens instrumentalisiert, um dem Nationalismus zivilreligiöse Kräfte und Stimmungen zuzuführen.
Das Leipziger Gespräch von 1913 aber stellte diese Vorgänge samt und sonders in ein völlig neues Licht, weil es sie als Symptome einer Wissenschaftskrise interpretierte, deren Grundsätzlichkeit und Tragweite der der Kirchen- und Religionskrise am Vorabend der Reformation in nichts nachstand. Rosenzweig hat bis in den Stern der Erlösung hinein immer wieder das Jahr 1800 als Angel- und Bezugspunkt seines Denkens bezeichnet. Nimmt man diese Standortbestimmung so ernst, wie sie von Rosenzweig gemeint war, dann erkennt man unschwer, worin seiner Meinung nach die Wissenschaftskrise nach 1900 bestand. Es war die nicht zu verkennende Handlungsunfähigkeit des klassischen deutschen Idealismus gegenüber den sich abzeichnenden Frontlinien des 20. Jahrhunderts.
Rosenstock hat in einer 1926 publizierten Rezension damaliger Neuerscheinungen der Hegel-Literatur die Erklärung dafür gegeben, warum Rosenzweig besonders sensibel auf die sich abzeichnende kritische Situation nicht nur der deutschen Wissenschaft reagieren musste. Mit seinen beiden Bänden Hegel und der Staat (1920) habe er sich als der wichtigste Repräsentant eines gegen den Neukantianismus opponierenden Neuhegelianismus erwiesen. Er musste das, weil er “1800” als einen Wendepunkt der Wissenschaftsgeschichte genau so ernst nahm, wie Fichte, Schlegel und ihre philosophischen Diadochen Schelling und Hegel das selbst getan hatten, nämlich als den Schritt von der Philosophie, d.h. des Suchens nach Wissenschaft zur Wissenschaft selbst, der Schritt von der Aufklärung im Lessingschen zur vollständigen Aufgeklärtheit im Fichteschen und Hegelschen Sinne. Was dieser Wissenschaft und der von ihr behaupteten Aufgeklärtheit ihre unvergleichliche historische Bedeutung verlieh, war ihre Kraft zum Wahrnehmen der Wirklichkeit als Einheit, für die es allenfalls im Aufbruch der ionischen Naturphilosophie im 6. vorchristlichen Jahrhundert eine geschichtliche Analogie gab. Was sie aber über die letztere hinaus hob, das war ihre Entschlossenheit gegen den in Kants Kritiken angelegten Dualismus zwischen Geistes- und Naturwissenschaften ebenso zu opponieren wie gegen die Spaltung der Gesellschaft in Intellektuelle und die unaufgeklärte und unaufklärbare Masse.
Lösbar geworden waren diese ungemeinen Aufgaben im Selbstverständnis der Idealisten dadurch, dass sie der Überzeugung sein konnten, das Verhältnis von Wissenschaft und Religion für immer dadurch geklärt zu haben, dass sie allen Abgrenzungsstrategien der Tradition und der Vergangenheit gegenüber eine revolutionäre Erweiterung wissenschaftlicher Reflexion so vornahmen, dass Religion selbst zu einer Dimension dieser Reflexion werden konnte. Rosenzweigs Freund Hans Ehrenberg kommt das Verdienst zu, im ersten seiner drei Bände über den deutschen Idealismus (Disputation, 1923-1925) die Schlüsselrolle des Offenbarungsbegriffes für diesen philosophischen Aufbruch nachgewiesen zu haben. Fichtes Erstlingsschrift Kritik aller Offenbarung ist hier als Antithese genau so wichtig wie die auf ihr aufbauende These der später folgenden Wissenschaftslehre. In der Totalität der idealistischen Reflexion ist für eine von außen in sie eingehende Offenbarung, die Kant als gegebenen Traditionsbestand glaubte gelten lassen zu können, kein Platz mehr. Viel mehr ist sie zu einem immanenten Bestandteil eines seine eigenen Reflexionsstufen in immer neuen Schritten hinter sich lassenden Bewusstseins geworden.
In Hegel und der Staat zeigt Rosenzweig, wie dieses Religionsverständnis dazu führt, dass der Staat über den Religionsgemeinschaften stehend zur letzten und einzigen Verwirklichung der sittlichen Idee werden muss, gerade weil die Moralitätspotentiale der unter ihm existierenden verschiedenen Religionen in ihn eingehen. Aber schon Nietzsche hatte von seinen ersten Schriften an gegen dieses allzu harmonische Bild Einspruch erhoben. Ist das Verhältnis von idealistischer Moral und Religion ein solches, dass es sich so bruch- und widerstandslos in unser historisches Bewusstsein integrieren lässt? Die gleiche Frage hatten mit je verschiedener Akzentuierung vor ihm schon Friedrich Heinrich Jacobi und Kierkegaard gestellt.
Nach 1870 und nach Bismarck lebend musste Rosenzweig wahrnehmen, dass der Staat mitnichten die Wirklichkeit der sittlichen, sondern der über alle Sittlichkeit triumphierenden nationalen Idee geworden war. Religion und Kirche aber schickten sich an, kraft ihrer zivilreligiösen und emotionalen Einflüsse den Staat für diese zu instrumentalisieren.
An jenem Julinachmittag in Leipzig war man sich darum einig, dass selbst Hegels Konzept des absoluten Geistes, der alle Moralität in sich aufsaugenden Dynamik des Nationalismus ebenso wenig gewachsen war wie den fundamentalistischen Aktivitäten des Antisemitismus. Und ganz gewiss nicht konnte man sich Rettung von der Kantschen Abgrenzung zwischen Vernunftglauben und Offenbarungsglauben versprechen. Behaupteten die Agitatoren von 1879ff doch gerade, den Schwächen des Vernunftglaubens mit den Kräften des Offenbarungsglaubens aufhelfen zu können.
Rosenstocks Position im Leipziger Gespräch bestand in der schlichten Feststellung, man müsse sich hinsichtlich der eigenen religiösen Position ehrlich machen statt in eine “Objektivität” und Relativität zu flüchten, die gerade für die Wissenschaft zwangsläufig unfruchtbar werden müsse, weil sie nicht nur Relativismus, sondern Agnostizismus nach sich ziehe.
Rosenstock konnte zeigen, dass der Schein der Objektivität lediglich dadurch entstehe, dass man, vom eigenen Argumentationszeitpunkt abstrahierend, unter Berufung auf irgendwelche Autoritäten von Sokrates bis Kant oder Hegel so tat, als seien die zu den Autoritäten gehörenden Zeitkoordinaten letztlich belanglos. Rosenstock konnte seinen Gesprächspartnern klarmachen, dass der historische Idealismus, wie ihn gerade Rosenzweig damals noch vertrat, auf einem vorchristlichen Wissenschaftsverständnis basierte, für das die Wirklichkeit als ein auf zeitindifferenten Rekapitulationen immer gleicher Zyklen gleichsam von Jahreszeiten, Jahren und Äonen beruhe.
Das 1913 in Leipzig diskutierte Problem aber war gerade so nicht beschreibbar. Setzte es doch die Singularität einer Konfrontation voraus, die sich nur um den Preis der Auslöschung ihres Inhalts als Teil eines gleichmäßigen “Stirb und Werde” verstehen ließ. In seinem berühmten Bekenntnisbrief vom 31.10.1913, in dem Rosenzweig seinem Freund Rudolf Ehrenberg erläutert, warum er den nach dem Leipziger Gespräch zunächst gefassten Entschluss, sich taufen zu lassen, widerruft und Jude bleibt, lüftet er zugleich eines der Geheimnisse dieses Gespräches. Es sei dabei um die keiner Dialektik, auch der Hegelschen nicht auflösbaren Konfrontationen der Geschichte gegangen. Man hätte schon seine Zuflucht zum Dualismus von Gott und Teufel nehmen müssen, wenn man Rosenstocks Forderung einer Klarstellung der eigenen Position im geschichtlichen Konfliktfeld von 1913 anders erfüllen wollte als durch eine Bezugnahme auf Gott den Schöpfer, den Christen wie Juden bekennen als denjenigen, der sich ihnen beiden offenbart hat.
Aber was wird mit diesem Bekenntnis eigentlich gesagt? Dass Gott sich den Christen anders als den Juden offenbart habe? Ganz zu schweigen von den Muslim und allen anderen, die sich auf ihnen zuteil gewordene und ihre Traditionen begründende Offenbarungen berufen.
Die Teilnehmer des Leipziger Gesprächs waren sich einig, dass man mit derartigen Fragen alsbald wieder in dem Relativismus landet, den hinter sich zu lassen man gerade angetreten war. Darum muss abermals unterstrichen werden: Es war eine wissenschaftliche Forderung, der die Einführung des Offenbarungsbegriffes genügen sollte. Es ging darum, eine Singularität auszumachen, die in allen Dimensionen der Wirklichkeit eine solche Orientierungskraft zu entfalten vermochte, wie der Dualismus von Gott und Teufel oder Christ und Antichrist, wie sie etwa von Carl Schmitts “politischer Theologie” ins Feld geführt wurde.
Hier war nun freilich mit der Emanzipation der Philosophie von der Theologie im 17. Jahrhundert jene oben beschriebene Problematisierung eingetreten, die den Offenbarungsbegriff als Ausdruck einer supranaturalistischen Fremdbestimmung der Vernunft aus dem Denken zu eliminieren suchte, anderseits aber dem Gottesbegriff eine fundamentale Orientierungsfunktion zuwies. Für Descartes kann allein Gott und seine Güte garantieren, dass die uns umgebende Wirklichkeit nicht ein Phantom unserer Einbildungskraft ist. Und noch Kant wollte im Rahmen dessen, was er “Vernunftglaube” nannte, die Orientierung an Gott als Garanten einer von der Vernunft geforderten Einheit der Wirklichkeit festgehalten wissen.
Nur - und nicht einmal ein Kant war imstande, diese Frage befriedigend zu beantworten! - wie soll der extramundane Gott und Schöpfer eine Orientierung ermöglichen, wo es doch gerade um die intramundane und innergeschichtliche Orientierung zu tun ist? Entweder wird Gott selbst zur innergeschichtlichen Instanz säkularisiert, so wie es die neuzeitliche Religionskritik immer aufs neue bewerkstelligte - oder in seiner Überweltlichkeit verlor Gott seine Orientierungskraft, verflüchtigt in eine historisch indifferente religiöse Mystik.
In seinem nach dem Leipziger Gespräch 1914 verfassten Aufsatz “Atheistische Theologie” hat Rosenzweig diese Problematik im Blick auf das jüdische Volk als Tatsache der Menschheitsgeschichte so ausgedrückt: “Eben um das jüdische Volk als das Herzstück des Glaubens zu verstehen, muss er den Gott denken, der zwischen Volk und Menschheit die Brücke schlägt. Seine Theologie mag wissenschaftlich sein, wie sie will und kann: Um den Gedanken der Offenbarung kommt sie nicht herum.” (Kleine Schriften, Berlin 1937, S. 290). Gerade wenn man um diesen Gedanken, und zwar aus wissenschaftlichen Gründen nicht herumkommen wollte, dann musste man aber auch in der Lage sein, begrifflich klarzustellen, was unter jener “Brücke” zwischen Volk und Menschheit denn zu verstehen sei. Man kann ohne Übertreibung sagen, Rosenzweigs Hauptwerk “Der Stern der Erlösung” (1921) sei gar nichts anderes als ein Versuch, auf diese Frage eine wissenschaftliche Antwort zu geben. Das zu betonen besteht um so mehr Anlass, als dieses Hauptwerk der Philosophie des 20. Jahrhunderts gerade in Deutschland noch immer in seinem wissenschaftlichen Anspruch nicht ernstgenommen und als eine jüdische Religionsphilosophie etikettiert und damit missverstanden wird.
Rosenzweig selbst hat Sinn und Intention seines Werkes als Antwort auf die Wissenschaftskrise gekennzeichnet, die der Zusammenbruch der idealistischen Tradition im Nihilismus der Nach-Nietzsche-Generation ausgelöst hatte. Wenn man, wie oben gesagt, die endgültige Klärung des Verhältnisses von Religion und Wissenschaft als einen Kernimpuls des Idealismus sehen muss, dann verstand es sich auch, dass dieses Verhältnis nach dem Scheitern der Positionen von 1800 erneut auf die philosophische Tagesordnung gesetzt werden musste.
Und dass dabei das Judentum eine ganz andere Stellung einnehmen musste, als in den Systemen nach 1800, die es als Ausdruck einer erledigten Epoche der Religionsgeschichte hatten ad acta legen wollen, das versteht sich von selbst. Es versteht sich aber auch inhaltlich aus dem nicht mehr idealistischen Offenbarungsverständnis, das der Stern der Erlösung nicht erst proklamiert, sondern bereits voraussetzt.
Es handelt sich um etwas völlig anderes, als was Spinoza, Lessing oder die idealistischen Klassiker vor Augen hatten, wenn sie das Ganze der Geschichte als den Weg der Selbstoffenbarung Gottes zu verstehen suchten. Rosenzweig hat es in dem Brief vom 18.11.1917 an Rudolf Ehrenberg (sog. “Urzelle” des Stern) als ein neues Verhältnis des Absoluten und Relativen beschrieben, wiederum unter Bezug auf das Schicksalsjahr 1800. Das “absolute Bewusstsein”, speziell im Sinne Hegels, war keine Selbsttäuschung, sondern Wahrheit, aber eben darum auch eine historische Tatsache. Rosenzweig konnte mit Recht meinen, damit ein ganz neues Verhältnis des Relativen und Absoluten entdeckt zu haben, nämlich dasjenige, in welchem nicht das Relative als dem Absoluten inhärent, sondern das Umgekehrte gilt: “Der Mensch hat zweierlei Verhältnis zum Absoluten, eines, wo es ihn hat, aber noch ein zweites, wo er es hat.” (Kleine Schriften, S. 359).
Das heißt dann aber, dass das Auftauchen des absoluten Bewusstseins an einem bestimmten Datum der Geschichte nur eine allgemeinere Wahrheit belegt. Die Geschichte, weit entfernt ein bloßes Konglomerat von Zufällen zu sein, ist vielmehr der Bereich einer ganz bestimmten Weise der Manifestation von Wahrheit. Es ist die Offenbarung, die diese neue Sicht auf die Geschichte und die Manifestation des Absoluten in ihr und damit auch den Gebrauch zweier neuer Kategorien in ihr begründet, die der traditionellen Philosophie fremd geblieben waren: die des Metaethischen und des Metalogischen. Metaethisch heißt die Eigenschaft des Menschen, Zeuge und Adressat des Absoluten in der Geschichte zu sein. Metalogisch bedeutet nicht ein Reden über Logik im technischen Sinne. Metalogisch ist vielmehr jene Kategorie, die Totalität und Diversität des Seins der Dinge beinhaltet, die ihnen die von keiner Möglichkeit je einholbare Wirklichkeitsfülle verleiht.
Das religionsgeschichtlich Merkwürdige an diesem einzigartigen Monument nachidealistischen Denkens ist nun aber, dass es ursprünglich auf christlicher Grundlage errichtet werden sollte, weil sein Urheber als Reaktion auf das Leipziger Gespräch die Absicht gehabt hatte, dem Beispiel des Mitunterredners Rosenstock zu folgen und sich taufen zu lassen. Dass es dazu nicht kam, hat nun mit einem Wandel des Offenbarungsverständnisses zu tun, der für Rosenzweig den Schritt in die Kirche verbot. Der Brief an Ehrenberg vom 31.10.1913 nennt die Begründung: Es ist die Christologie, die nach Meinung Rosenzweigs die Offenbarung in eine unmittelbare, die jüdische, und eine mittelbare, die christliche, gliedert: “Das Christentum erkennt den Gott des Judentums an, nicht als Gott, aber als Vater Jesu Christi” (Briefe, Berlin 1935, S. 73). Das Christentum ist so gesehen die Tochterreligion des Judentums, als solche durchaus legitim, aber eben darum niemals Ziel für den, der bereits bei Gott ist in der Mutterreligion des Judentums.
Auf diese Weise ergibt sich für Rosenzweig eine in sich stimmige Erklärung für die Einheit der Offenbarung trotz der Mehrheit der Offenbarungsreligionen. Christentum und Judentum haben auf je eigene Weise Anteil an der zweigestuften Offenbarung Gottes, als des Gottes Israels und des Vaters Jesu Christi. Freilich bleibt bei dieser Art der Offenbarungsdogmatik ungeklärt, warum die dritte Offenbarungsreligion, der Islam, aus ihr ausgeschlossen bleibt.
Die Antwort Rosenzweigs hierauf lautet: Der Islam ist nur eine negative Bestätigung für die Einheit der Offenbarung. Einerseits ist er als nachchristliche und nachjüdische Religion nur ein Echo der bereits geschehenen Offenbarung. Andererseits erklärt Rosenzweig (Kleine Schriften, S. 390), sei der Islam nur ein innerreligiöses, religionsgeschichtliches Ereignis, im Gegensatz zu der metareligiösen, menschheitsgeschichtlichen Tragweite der Tatsache Judentum und des Ereignisses Christentum. Gegen Ende des Kriegsbriefwechsels mit Rosenstock fasst Rosenzweig sein negatives Urteil über den Islam nochmals zusammen, indem er behauptet, die Gotteslehre des Islams laufe auf ein offenbarungsloses Nebeneinander von Gott und Welt hinaus, das es so weder bei Juden noch bei Christen gebe. (Briefe, aaO. S. 717).
Geht man die im 2. Teil des Stern enthaltenen Texte durch, die den Islam behandeln und liest sie im Lichte der von Rosenzweig für die 2. Auflage hinzugesetzten Randtitel, so macht man die höchst überraschende Entdeckung, dass Rosenzweig den Islam als „Religion der Vernunft, der Notwendigkeit, der Menschheit, der Tat, der Pflicht“ charakterisiert. Mit anderen Worten: Der Islam ist in Rosenzweigs Sicht nichts anderes als was die Aufklärung und der Idealismus als „natürliche Religion“ der Offenbarungsreligion gegenüberzustellen pflegten, freilich mit dem bemerkenswerten Unterschied, dass diese „natürliche Religion“ jetzt in der Gestalt einer positiven, historischen Religion auftrat. Das Letztere war Rosenzweig so wichtig, dass er in dem Nachwort zum Stern 1925 erklärt, die Islamkommentare seien die einzig rein religionsphilosophischen Teile des Stern.
Für das Offenbarungsverständnis Rosenzweigs ergibt sich hieraus: Die Einheit der Offenbarung verhält sich dergestalt zu den drei Offenbarungsreligionen, dass Judentum und Christentum die zwei Teilhabeweisen an dieser einen Offenbarung repräsentieren, der Islam aber nur ein mittelbares und historisch bedingtes Verhältnis zu ihr hat. Wir sehen uns mit dem merkwürdigen Widerspruch konfrontiert, dass Rosenzweig im Gegensatz zur übrigen Philosophie und Theologie seiner Zeit den Islam durchaus in sein Denken einbezieht, ihn aber nur als Folie für ein Offenbarungsverständnis beansprucht, das er – gerade in der Abgrenzung vom Islam an der oben zitierten Stelle (Briefe, S. 717) – als ein „Überschatten der Welt mit Überwelt“ kennzeichnet.
Dass wir damit wieder bei der oben dargestellten Problematik und dem Widerspruch zwischen innergeschichtlicher Orientierung und einem sie ermöglichenden „Außerhalb“ angelangt sind, wird niemand übersehen können. Dazu kommt noch eine ganz andere biografische und geradezu private Problematik: die Rolle Rosenstocks in der Formulierung von Rosenzweigs Offenbarungsphilosophie. Zwei Aspekte hat diese Verbindung beider Autoren. Einmal ging über das Leipziger Gespräch von 1913 von Rosenstock der erste Anstoß zum neuen Offenbarungsdenken aus, was Rosenzweig mehr als einmal bezeugt und unterstrichen hat. Am nachdrücklichsten in dem „Urzelle“ des Stern in den Kleinen Schriften gedruckten Brief an Rudolf Ehrenberg vom 18.11.1917 (aaO. S. 357ff); außerdem erläutert Rosenzweig in dem am 15.9.1918 an den gleichen Empfänger geschriebenen Brief die Zusammenhänge von „Urzelle“ und Stern.
Interessanter noch aber ist der zweite Aspekt. Als eine Art Resümee seiner Auffassung vom Verhältnis von Judentum und Christentum, wie er sie in geradezu klassischen Formulierungen während des Kriegsbriefwechsels (aaO. S. 666 ff) Rosenstock vorgetragen hat, springt am Schluss die Frage heraus: „… erklären Sie mir Ihren jetzigen Begriff vom Verhältnis von Natur und Offenbarung“ (Briefe, aaO. S. 675).
Ich halte schon die Formulierung dieser Frage für epochemachend. Denn indem sie Natur und Offenbarung aufeinander bezieht, verlässt sie das in der lateinischen Theologie herrschende Schema von Natur und Gnade, Natur und Übernatur. Noch sehr viel weiter aber geht das, was Rosenstock in seinem Antwortbrief (aaO. S. 676ff) ausführt. Hier wird die ganze Offenbarungsdebatte auf ein völlig neues Niveau gehoben, weil Rosenstock nicht ein Verhältnis von Welt und Überwelt, also ein vertikales, sondern ein horizontales Verständnis von Offenbarung voraussetzt, nämlich die Inkarnation im Sinne von Johannes 1,14 „Das Wort ward Fleisch.“. Dieser Ansatz führt zu einem völlig anderen Verständnis von Offenbarung, nämlich ihrer Auffassung als Orientierung. Dies aber dergestalt, dass nicht die Position des Orientierung Suchenden als archimedischer Punkt dient, sondern die Offenbarung als Erleuchtung allererst alle Dimensionen der Schöpfung sichtbar werden lässt: „Und so ist die christliche Offenbarung die Heilung der babylonischen Sprachverwirrung, die Sprengung des Gefängnisses, zugleich aber das Siegel auf die neue Zunge, die nun beseelte Sprache. Seitdem lohnt es wieder zu denken, weil das Denken ein Maß außer sich selbst, im sichtbaren Wandel Gottes, hat” (aaO. S. 639).
Von diesem horizontalen Offenbarungsverständnis aus brauchen die drei Offenbarungsreligionen nicht mehr nach Partizipationsstufen, von der jüdischen Unmittelbarkeit über die christliche Mittelbarkeit bis zur islamischen Äußerlichkeit geordnet zu werden, um die Einheit der Offenbarung mit der Mehrheit der Offenbarungsreligionen ins Reine zu bringen. Die Offenbarung selbst ist vielmehr nichts anderes als diejenige Sprache, in der die Einheit der Schöpfung immer neu wahrgenommen und bekräftigt wird, gegen die Chaotik der Heidentümer mitsamt ihren Überwelten. Rosenzweig hat Rosenstocks Konzept von Offenbarung als Orientierung nicht nur in der „Urzelle“, sondern auch im Stern (aaO. Teil II, Heidelberg 1954, S. 127) selbst aufgenommen, freilich in einer Form, die der Horizontalismus des Rosenstockschen Offenbarungsverständnisses gerade nicht akzeptierte. Wie man an der zitierten Stelle nachlesen kann, ist es doch das Einzelindividuum, dessen Perspektive von der Offenbarung begründet werden soll und nicht jene umfassendere, das Einzelindividuum gerade transzendierende Perspektive, die Rosenstock schon in dem Briefwechsel von 1916 „das Kreuz der Wirklichkeit“ nennt, also mit jenem Begriff, der das Konzept seiner später 1926 –1958 entwickelten Soziologie bestimmten sollte.
Mit dieser nur begrenzten Rezeption des Rosenstockschen Ansatzes hängt auch der von Rosenzweig nie aufgegebene Vertikalismus seines Offenbarungsverständnisses zusammen, der sich vielleicht am deutlichsten in einer Formulierung des oben zitierten Grundsatzbriefes an Rosenstock erhalten hat, wo Offenbarung als „das große sieghafte Einbrechen des Geistes in den Ungeist“ definiert wird (Briefe, aaO. S. 671). Inkarnation, „das Wort ward Fleisch“ – das ist etwas ganz anderes als Einbrechen des Geistes in den Ungeist, und wenn Paulus Römer 8,16 davon spricht, dass der Geist Gottes unserem Geist Zeugnis gibt, dann erklärt er damit, dass gerade unser Geist zu seiner Befreiung der Offenbarung in viel höherem Maße bedarf als alles, was man „Ungeist“ nennen könnte.
Da nicht der „Ungeist“ Adressat der Offenbarung und ihres Wirkens ist, sondern Fleisch und Geist der Kreatur, kann auch nicht irgendeine „Religion der Vernunft, der Notwendigkeit etc.“ von ihr so abgegrenzt werden, wie es in Rosenzweigs Stern geschieht. Erst wenn auch der Islam als Offenbarungsreligion voll ernstgenommen ist, kann ein theologisch legitimer Begriff von der Einheit der Offenbarung gebildet werden.
Aber auch dieses Vorhaben kann nicht abseits von den Wegen in Angriff genommen werden, die Rosenzweig und Rosenstock in ihren Dialogen und Diskursen gebahnt haben. Denn auch für Rosenzweig wird die horizontale Dimension unausweichlich, wo er Offenbarung auf Schöpfung bezieht, um den metalogischen und metaethischen Aspekten der Wirklichkeit gerecht zu werden.
Dabei geschieht es nun freilich, dass sich das, was in der Offenbarungslehre der „Ungeist“ genannt wurde, wiederum in einer keineswegs unbedenklichen Weise Geltung verschafft, nämlich als das Nichts der creatio ex nihilo. Welche eine krasse contradictio in adiecto: Schöpfung „aus“ – auch wenn das „aus“ das Nichts sein soll – das beraubt die Schöpfung entweder ihrer Anfänglichkeit - oder zwingt zu einer höchst bedenklichen Spekulation über einen Anfang, der die Schöpfung des Nichts als notwendige Voraussetzung der Schöpfung aus Nichts behaupten musste.
Niemand wird angesichts solcher Sätze sich nicht an die ganz andere Interpretation der Schöpfung durch das erste Kapitel des Johannesevangeliums erinnert fühlen, die jeden Gedanken an ein anfängliches Nichts durch die Namhaftmachung des Logos Gottes ausschließt und auch die Finsternis, die an das Nichts gemahnen könnte, nur als Raum anführt, der dazu da ist, das Licht erscheinen zu lassen. So wird Schöpfung zur Erleuchtung selbst und Offenbarung hört auf, etwas der Schöpfung gegenüber Nachträgliches zu sein.
Wieder anders stellt sich Schöpfung nach islamischer Tradition dar, nämlich als Akt der schlechthinnigen Allmacht und Allursprünglichkeit, einer irreduziblen Kontingenz und Tatsächlichkeit, die in jedem Augenblick von Gottes Allmacht widerrufen und zunichtegemacht werden könnte, dem allein das unwiderrufliche Sein zukommt (Stern II, aaO. S. 36). Es ist nur eine scheinbare Paradoxie, dass die Einheit der Offenbarung auf drei verschiedene Fassungen der Schöpfung hinausläuft. Es liegt schlicht daran, dass Schöpfung als Akt nicht erzählt, sondern nur anerkannt werden kann. Könnte sie erzählt werden, würde sie zu einer historischen Vergangenheit, was ihrem Wesen widerspräche. Auch Genesis 1 erzählt nicht, wie Gott schafft, sondern was er tut, nachdem er Himmel und Erde „im Anfang“ geschaffen hat.
Dass das Anerkennen und Bekennen der Schöpfung auf drei miteinander unvereinbare und gegeneinander inkompatible sprachliche Ausdrucksweisen führt, das erklärt sich aus ihrer zeitlichen Reihenfolge und der aus dieser resultierenden Sozialstruktur. Allen drei gemeinsam ist Genesis 1,1 – das Bekenntnis eines nicht hintergehbaren Anfangs. Der trinitarische Schöpfungsbericht von Johannes 1 beschreibt die Schöpfung als Stätte der Inkarnation, eine Beschreibung, die bei den nach Johannes 1,13 Wiedergeborenen gar nicht anders lauten kann, als die dann folgenden Wir-Aussagen.
Der binitarische Schöpfungsbericht jüdischer Tradition, wie ihn Rosenzweig entwickelt, setzt eine – um Rosenzweigs Begriffe zu gebrauchen – gemeinsame Sprache voraus, die den metaethischen Charakter der menschlichen Existenz ebenso bezeugt wie die Bejahung des metalogischen Seins der Dinge – das Volk, das den Sabbath kennt und begeht.
Die strikt monistische Schöpfungslehre des Islam, sie kann nur das Bekenntnis derer sein, die die Singularität Mohammeds gegenüber allen Religionen bejahen.
Wir haben mit den letzten Sätzen immer schon vorausgesetzt, dass die Einheit der Offenbarung auch von einer Philosophie, die Offenbarung nicht als etwas philosophisch Transzendentes ansieht, nicht angemessen begriffen werden kann und darum theologisch erfasst und diskutiert werden muss. Aber auch die Theologie müsste an dieser Aufgabe scheitern, wenn sie als Metaebene zur Offenbarung und zu den drei Offenbarungsreligionen auftreten wollte. Sie würde sich sehr bald wieder auf die Abstraktionen einer „natürlichen Religion“ vor- Rosenzweigschen oder Rosenzweigschen Typs zurückgeworfen sehen.
Die Lösung dieser nach dem Ende der idealistischen Zuordnung von Wissenschaft und Religion zu einer erstrangigen Dringlichkeit gewordenen Aufgabe setzt in der Wissenschaft etwas voraus, was Rosenstock sein ganzes Leben hindurch nicht müde wurde zu fordern: eine Soziologie, die den Parametern aller Strukturen der Sprache menschlichen Handelns ebenso gerecht wird wie eine Metaethik und Metalogik sehende und anerkennende Philosophie und eine die Offenbarung als Sprache interpretierende und kommentierende Theologie.
Die von Gershom Scholem gegen Rosenzweig vorgebrachte Kritik, er habe die Synagoge als eine Art pietistische Kirche verstehen wollen, hat wohl darin etwas Richtiges gesehen, dass diesem die soziologischen Anforderungen des Offenbarungsdenkens weit weniger deutlich waren als Rosenstock. Eine auf den Leipziger Disput anspielende Stelle aus dem 2. Band von Hegel und der Staat ist eine erstaunliche Beurkundung dieser Grenze seines Denkens. Stellt sie doch der Marxschen Vision einer Endzeitgesellschaft allein die Kirche als Alternative gegenüber (Hegel und der Staat, Bd. 2, München – Berlin 1920, S. 204).
3. Der Islam als dogmatisches Problem
Erst unter dem Eindruck des Falles von Konstantinopel 1453, des Endes der östlichen Metropole der Christenheit, begann eine öffentliche theologische Auseinandersetzung mit dem Islam. Weder der Bilderstreit des achten und neunten Jahrhunderts noch die Kreuzzüge hatten im Islam etwas anderes als einen äußeren Feind gesehen, den es mit militärischen Mitteln zu bekämpfen und zu besiegen galt. Ein so hoch gebildeter Autor des 13. Jahrhunderts wie Wolfram von Eschenbach kann in den Muslimen nur schlicht ungläubige Heiden, also etwas Vorchristliches sehen, obwohl sie in seinen Dichtungen eine so wichtige Rolle spielen.
Erst Nicolaus von Cusa beteiligt den Islam als gleichberechtigten Gesprächspartner eines universal-religiösen Diskurses in der nach 1453 verfassten Schrift De pace fidei. Im neunten Kapitel dieses Textes werden die Einwände des Islam (übrigens auch die des Judentums) gegen den traditionellen christlichen Trinitarismus als durchaus berechtigt anerkannt.
Und schon am Vorabend der Reformation hatte Johannes Reuchlin in seiner Schrift De verbo mirifico (1494) seine Kenntnis der jüdischen Mystik zu einer Art Heilsökonomie der Religionen zu entwickeln versucht, in der jeder biblische Gottesname einer bestimmten Epoche zugeordnet war, El Schaddaj der Natur, Jehova dem Gesetz, Jehoschua/Jesus der Gnade. 1517 führte er diesen Gedanken weiter aus, indem er ihn in Form eines Trialoges De arte cabbalistica zwischen dem Juden Simon, dem Moslem Marannus und dem Philosophen Philolaos verhandelt werden lässt. Auffälliger Weise trägt der Moslem in diesem Dreiergremium einen Namen, der ihn als zwangsbekehrten spanischen Juden nach dem Fall des Kalifats von Cordoba erscheinen lässt.
Trotz dieser Präliminarien aber gilt: Erst die Reformation hat den Islam zum Gegenstand dogmatischer Entscheidungen werden lassen, was er auch nach Rosenzweigs Darlegungen im Stern schon deswegen niemals sein konnte, weil sein Offenbarungsverständnis letztlich das eines monotheistischen Heidentums blieb.
Ganz anders Luther, der schon in den Resolutionen zu den Ablassthesen sein Verwerfungsurteil über jede Form von Kreuzzug ausgesprochen und auch darum vom Papst verurteilt worden war. Für Luther schloss die Verwerfung des Kreuzzuges den Türkenkrieg als Form der Selbstverteidigung nicht aus. Aber Kreuzzug – das war in seinen Augen eine der krassesten Formen religiöser Selbstrechtfertigung, und dies auch noch gegenüber einem Gegner, der die Christen hinsichtlich der von ihm vollbrachten Selbstverleugnungen bei weitem in den Schatten stellte. Man denke nur an die islamische Striktheit in der Erfüllung von Fastengeboten oder die vollständige Enthaltung vom Alkoholgenuss.
Gerade diese Ablehnung einer bloß macht- und kulturpolitischen Beurteilung des Islam musste aber die dogmatische Verwerfung um so unumgänglicher erscheinen lassen. Hatten die kursächsischen Visitationsartikel von 1528 sich noch auf eine rein politisch-moralische Verdammung des Islam beschränkt – daher auch unter der Überschrift „Vom Türken“ – so verfährt die Augsburger Konfession von 1530 schon ganz anders, indem sie den Islam als „Mahometistae“ unter die antitrinitarischen Ketzer der Alten Kirche einreiht, ihn damit freilich als innerchristliche Häresie beurteilt. Eine These, der sich 340 Jahre später noch die Habilitationsthesen des jungen Harnack anschließen sollten. Dieses dogmatische Urteil der Augsburgischen Konfession erinnert in gewisser Weise an Rosenzweigs Kritiken im Stern, die im Islam eine Art rationalistischen Unitarismus in der Gotteslehre sehen.
Nikolaus von Cusa war hier ganz anderer Meinung, wie wir gerade gehört haben und wollte darum den Islam durchaus in den theologischen Diskurs auf trinitarischer Ebene einbezogen sehen. Aber damit entstand die Schwierigkeit, inwiefern die offenkundig voneinander abweichenden Trinitätslehren des Cusaners und von Augustana I ins Verhältnis zu setzen seien, abgesehen davon, wie weit die Kennzeichnung des Islam als „Mohammedanismus“ als dogmatisch korrekt anerkannt werden kann.
Einen Ausweg aus diesen Schwierigkeiten weist eine ganz andere Position, die ebenfalls bereits in der Reformation, ansatzweise in Luthers Vorwort zu einer antiislamischen Kampfschrift Epistel von der Türken Religion (1530), am klarsten aber in den nach 1521 niedergeschriebenen Tertullioanmarginalien und der 1523 entstandenen Protestation Müntzers enthalten ist. Der Schritt, der hier am klarsten in Müntzers Sentenz Marcion est fundamentum Turcarum (Marcion ist das Fundament der Türken) vollzogen wird, ist der Schritt von einer trinitarischen zur christologischen Interpretation des Islam, eine sowohl historisch wie dogmatisch richtige Entscheidung.
Denn wenn Müntzer den Islam mit Marcion in Verbindung bringt, dann bezieht sich das auf die Leugnung des Kreuzesleidens Christi wie auf eine Lehre vom Erbarmen Gottes, die genau wie Marcion Erbarmen und Gerechtigkeit Gottes nicht als Einheit zu erkennen vermag.
Was Müntzer nicht ahnen konnte und erst recht nicht die anderen, den Islam weithin nur äußerlich beurteilenden Reformatoren, das war der Hinweis auf die historischen Wurzeln und Kontexte des Islam, die Müntzers Marcion-These enthielt und von denen auch Rosenzweigs Islamdarstellung völlig abstrahiert.
4. Der Islam als Konsequenz des Konzeptes einer Weltreligion
Weder Rosenzweig noch Rosenstock konnte bewusst sein, was erst die religionsgeschichtlichen Quellenfunde der Mitte des 20. Jahrhunderts ans Licht gebracht haben: die Tatsache, dass bereits im 3. Jahrhundert und nicht erst mit Konstantin jener Epocheneinschnitt sich vollzog, den der Eintritt des Christentums in die Religionsgeschichte mit sich gebracht hat.
Es ist das Verdienst des jungen Hans Jonas, durch den 2. Band seines Buches Gnosis und spätantiker Geist 1934, 2. Bd. 1954) dem merkwürdigen Konzept Spenglers einer von der vorchristlichen Spätantike bis 1100 lebenden „arabischen Kultur“ einen konkreten historischen Sinn abzugewinnen. Wies er doch nach, dass die klassisch und konsequent von Marcion vollzogene Außerkraftsetzung der Schöpfungslehre trotz ihrer kirchlichen Verwerfung eine unabsehbare historische Tragweite zuwuchs, weil die kirchliche Verwerfung nur innerkirchlich wirken konnte, und, wie der tiefgreifende Einfluss des Manichäismus zeigte, auch innerkirchlich unvollständig geblieben war, weswegen der Manichäismus ab dem dritten Jahrhundert die ganze Religionsgeschichte des Nahen, Mittleren und Fernen Ostens umzugestalten vermochte.
Dass es aber zu diesen religionsgeschichtlichen Prozessen kommen konnte, ist einem Vorgang geschuldet, der in unserem Geschichtsbewusstsein entweder gar nicht vorhanden ist oder lediglich jenes Schattendasein führt, für das das Buch des jungen Jonas stehen kann. Nach dem Vorbild der sogenannten Konstantinischen Wende möchte ich diesen im 3. Jahrhundert spielenden Vorgang die Origenische Wende nennen, die Tatsache, dass mit dem ägyptisch-palästinensischen Kirchenlehrer Origenes ein Christ auf den Plan tritt, der alt- und neutestamentliche Tradition auf dem damals höchstmöglichen Niveau philologischer und philosophischer Wissenschaft vertritt und damit für die Schriften des Alten und Neuen Testaments genau dieselbe kulturelle Relevanz einfordert wie für die Literatur der griechischen und lateinischen Klassiker.
Ein Anspruch, der sofort energischste Reaktionen auslöst, Reaktionen, die in die Verwerfung des Christentums durch die nach 200 maßgeblichen Vertreter griechischer Philosophie, Ammonios Sakkas (der selbst schon Christ gewesen war), Plotin und Porphyrios führte. Das weitverbreitete Bild, das Christentum sei lediglich vom spätantiken Judentum verworfen, vom hellenistischen Heidentum aber begeistert angenommen worden, sozusagen als „Platonismus fürs Volk“, wie Nietzsche sich auszudrücken pflegte, ist eine historische Fehleinschätzung von wahrhaft katastrophalem Ausmaß. Verkennt sie doch völlig, welche Ereigniskataklysmen im 3. Jahrhundert sich vollzogen haben mussten, ehe jemand wie Konstantin die Folgerungen für das römische Kaisertum durch dessen vorher undenkbare Christianisierung zu ziehen vermochte. Noch viel schwerwiegender ist das Nichtverstehen der radikalen Veränderungen, die das 3. Jahrhundert im Verhältnis von Religion, Wissenschaft und allgemeiner Kultur vollzog.
Indem Origenes für Altes und Neues Testament hebräischen und griechischen Text der biblischen Überlieferungen eine Kanonizität im Sinne der damals schon vorhandenen Maßstäbe von Klassizität beanspruchte, stellte er nicht nur das Paradigma einer einheitlichen Menschheitsgeschichte auf, das weit über die Ansätze Homers, Herodots, der Tragödienklassiker, Platons und Vergils hinausging. Er veränderte auch die Stellung der Klassiker griechischer und lateinischer Literatur. Weil sie in der Sicht des Origenes aufhörten, Quellen dessen zu sein, was die antike Wissenschaft theologia mythica nannte, d.h. künstlerische Überhöhung der unendlichen Pluralität der Lokalkulte, konnten Homer und die anderen Klassiker nunmehr als religiös unbedenkliche Kulturdokumente gelesen und tradiert werden, wie es Origenes, Basilius der Große und Gregor der Theologe den Christen ihrer Zeit denn auch empfahlen.
Die wütenden Proteste hiergegen von Ammonios Sakkas bis Kaiser Julian, der bekanntlich auch bemüht war, sein Christentum wieder abzulegen, konnten diese Kulturveränderung nicht mehr rückgängig machen. So konnte auch Plotin, wenn er den von Origenes geltend gemachten Positionen opponieren wollte, dies nicht mehr auf der Grundlage der traditionellen theologia philosophica tun. Denn diese Grundlage basierte auf deren Definition theologia, i.e. de divinitate ratio sive sermo („Theologie, das ist Rechenschaft oder Rede über das Göttliche“). Die christliche Theologie aber hatte mit dem weltverändernden ersten Vers des Johannesevangeliums, an dem noch Faust die eigene Orientierung zu gewinnen sucht, Theologie aus einer Rede über Göttliches die Rede Gottes selbst werden sehen. Das lehnte Plotin auf das Heftigste ab. Aber um diese Ablehnung vollziehen zu können, konnte er sich eben nicht mehr auf die von den Christen antiquierte heidnische Theologie beziehen. Er musste vielmehr eine Dimension jenseits von Sein und Denken in der beidem praäexistierenden Einen erreichen, von der aus er die Autorität in Anspruch nehmen konnte, die Christen als Zerstörer aller Mysterien und Arcana des Heidentums verurteilen zu können.
Dass wir in derartigen Gedanken den Hintergrund für die auf eine Totalauslöschung von Christentum und Kirche zielenden Christenverfolgungen des Decius und Diokletian zu sehen haben, wird niemand verkennen können. Der fehlende Einblick in die Vorgänge des 3. Jahrhunderts verleitet immer wieder dazu, das Scheitern dieser Liquidationsversuche als den mit Konstantin eintretenden Wechsel als Sieg des Christentums zu interpretieren.
Im Blick auf die Christianisierung des Kaisertums und das Ende der Christenverfolgungen auf dem Boden des Imperium Romanum – im Perserreich gingen sie auf höchst blutige Weise weiter! – ist das gewiss richtig. Aber man darf trotz dieser Feststellung nicht vergessen, dass im 3. Jahrhundert aufgrund der vom Christentum ausgelöste religiösen Verwerfungen drei miteinander unvereinbare Menschheitsverfassungen entstanden waren, die, wie wir gleich zeigen werden, auch nach Konstantin weitergewirkt haben.
Die von Origenes nach dem biblischen Konzept einer Vollzahl der Zeiten (Epheser 1,10) gesehene Perspektive einer Heilsökonomie aller Äonen, der bekannten wie nichtbekannten; die philosophische Mystik Plotins des übergöttlichen Einen, zu dem alle Vielheit sich zurückwendet und dabei die Einheit von Religion und Denken immer neu vollzieht und bekräftigt, und schließlich das erstmals vollständig und universal konzipierte Programm von Weltreligion, wie es der 273 ums Leben gekommene, aus der judenchristlichen Sekte der Elkasaïten stammende Mani verkündet hat, indem er aus jüdisch-christlicher, zoroastrischer und buddhistischer Überlieferung seine Offenbarung von den drei Welten entwickelte: der friedlich intentionslosen des Lichts, der aggressiven der Finsternis und der empirischen, in der wir die Durchdringung beider erfahren.
Die immense religions- und kulturgeschichtliche Bedeutung des Manichäismus erklärt sich daraus, dass er von 242 – 273 persische Reichsreligion war. Die nach dem wohl gewaltsamen Tode Manis einsetzende Restauration des orthodoxen Zoroastrismus ist so gesehen auch eine Wirkung des Manichäismus, der einerseits durch seine Vertreibung aus dem Iran tiefgreifende Ausstrahlungen nach Mittel- und Südostasien zur Folge hatte und im Mittelmeerbereich durch die Restauration des Zoroastrismus den Gegensatz gegen Ostrom derart verschärfte, dass kriegerische Verwicklungen unausbleiblich waren.
Höhepunkte dieser Auseinandersetzung sind die beiden Schlachten im Jahrhundert des Auftretens von Mohammed. 627, also 5 Jahre nach Mohammeds Hedschra, werden die bis dahin siegreichen Perser von den Oströmern vernichtend geschlagen. Ein Sieg, der in gewisser Weise dem der Muslim bei Nihavend 624 präludiert, der das Perserreich zu einem Teil des Kalifenreiches und damit bis heute zu einer Kernlandschaft des Islam werden lässt.
Damit aber tritt an die Stelle der Konfrontation Christentum – Zoroastrismus oder ihrer beider Vermittlung im Manichäismus die Konfrontation von Rom und Islam, christlicher und nachchristlicher Religion. Die Frage der Weltreligion musste dann zwischen einer Verfassung auf der Basis einer einheitlichen Liturgie und dementsprechend einheitlichen Kalenders wie im Christentum und der islamischen Bekenntniseinheit ohne festes Territorium entschieden werden.
Tagtäglich sehen wir, dass diese Frage bis heute nicht entschieden ist. Verschärft wird darum die bestehende Problematik von allen, die meinen, eine Entscheidung mit militärischer oder institutioneller Gewalt erzwingen zu können. Aber weder leben wir im 7. Jahrhundert noch im 13., da man meinte, den Islam durch Kreuzzugsaufrufe erledigen zu können. Unsere Aufgabe besteht darum gerade darin, uns die Gründe für diese Unentscheidbarkeit zu vergegenwärtigen und die nötigen Konklusionen aus den vollzogenen Klarstellungen zu ziehen.
Die Globalität einer einzigen Weltherrschaft ist heute angesichts der Komplexität der Völkerweltgesellschaft noch viel weniger durchsetzbar als sie es in der Antike oder in irgendeiner anderen Epoche war - so oft die Bush-Administration aus durchsichtigen Gründen auch das Gegenteil behaupten mag. Dass dabei immer wieder der Islam als Imperialismusfeind Nr. 1 figuriert, liegt schlicht daran, dass er die Zusammenfassung aller nichturbanisierten, nicht irgendeinem Imperialismus zugehörigen, auf Stammestraditionen lebenden Teile der Völkergesellschaft darstellt. Auf diesen Teil der Weltgesellschaft ist der Imperialismus per definitionem nicht anwendbar. Freilich ist das nur einer, aber ein wesentlicher Grund für den illusionären Charakter der Imperialismusdoktrin.
Umgekehrt führt die soziologische Natur des Islam notwendigerweise wegen seiner eigenen religiösen Grundlage zur Problematisierung der Zugehörigkeit seiner Gläubigen zu einer Verfassung, die die Universalität der Menschenrechte voraussetzt.
Dennoch gibt es einen Weg des Umganges mit diesen, die Weltherrschaft beunruhigenden Inkompatibilitäten. Es ist das Festhalten an der Glaubens- und Gewissensfreiheit, an einem nicht hintergehbaren und uneliminierbaren Individualrecht, von dem aus alle überlieferten Sakralrechte in ihre religiösen Schranken gewiesen werden, so wie es durch Paulus geschieht, wenn er klarmacht, dass der Maßstab der Glaubensfreiheit das Gewissen des Anderen ist (1. Kor.10,29).
Noch immer zu wenig bedacht wird, dass aus solchen Grundsätzen zwingend die Unmöglichkeit einer einzigen Weltreligion als Menschheitsverfassung folgt. Umgekehrt erklärt sich aus den gleichen Voraussetzungen, warum erst die drei, zwischen 500 und 600 nach Chr. entstandenen, miteinander unvereinbaren Kalender der drei Offenbarungsreligionen die tatsächliche Menschheitsverfassung ergeben, so wie es Rosenstock-Huessy im 2. Band seiner Soziologie denn auch dargestellt hat:
Die jüdische Schöpfungs-Ära als ein nicht kosmologischer Ursprung der Menschheitsgeschichte; die islamische Hedschra-Ära als Indiz für die Gleichstellung aller Epochen der Völkerwelt; die christliche Ära als Blick auf ein einziges, das Kreuz der Wirklichkeit in alle Dimensionen eröffnendes Zentrum aller Epochen.
Diese irreduzible Dreiheit ist das einsichtigste Indiz für die Einheit der Offenbarung. Gerade weil sie sich nicht vereinheitlichen lässt, verweist sie auf eine ihr vorausliegende, aber ihr auf je verschiedene Weise zugänglich gewordene Einheit. Darum kann der Blick auf alle drei nicht aus der Kompetenz einer einzigen universalen Weltreligion oder eines weltreligiösen oder weltethischen Synkretismus kommen, sondern allen dem immer neuen und immer wieder durch die Wahrnehmung der offenkundigen Verschiedenheiten herausgeforderten Impuls wechselseitiger Aufklärung. So werden wir nie dazu kommen, irgendeinen Berg oder Tempel als den einzigen und letzten ansehen zu können. Das himmlische Jerusalem gehört keiner Religion oder Kirche oder Denomination oder Kultur. Und darum hat Jesus alle denkbaren Religionen angeredet, wenn er darauf hinwies, Gott könne nur im Geist und in der Wahrheit angebetet werden.
Mit W.Ullmann am 11.3.2003 korrigierte Fassung, zur Veröffentlichung freigegeben. Veröffentlicht in stimmstein 8 2003 / RIG 8 Wegmarken zur Transzendenz
T.Dr.