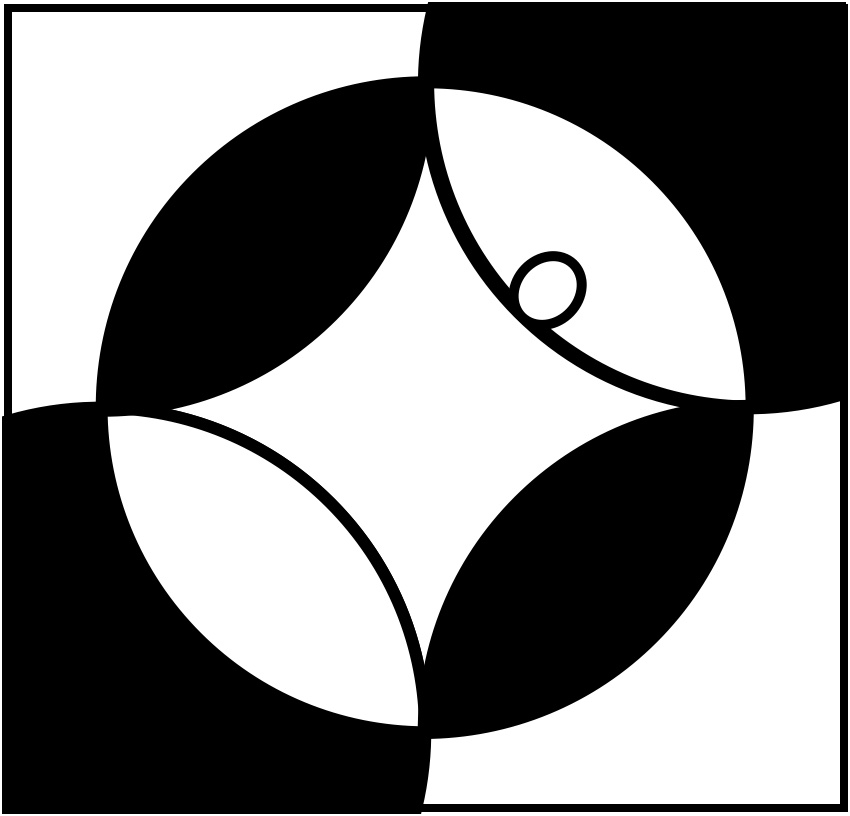Rosenstock-Huessy: Religio Depopulata (1926)
XI. Religio depopulata 1
I. Papsttum und Staatenwelt
Eine seltsame Weissagung über die Päpste vom Ende des 16. Jahrhunderts — auf den Namen des irischen Abtes Malachias aus dem zwölften Jahrhundert - wurde lange in der römischen Kirche hoch in Ehren gehalten. Jetzt, wo nur noch wenige (sechs!) Päpste kraft jener Prophetie bevorstehen sollen, wird man schweigsam über sie, aber im katholischen Volk leben ihre kurzen Stichworte fort, ähnlich wie die Lehninsche Weissagung über die Hohenzollern eine gewisse Popularität lange behauptet hat.
Trotzdem es sich um eine Fälschung zur Beeinflussung eines bestimmten Konklave handelt, sind die Charakteristiken, und zwar gerade der Endzeitpapate, für den Sinnenden nicht ohne Wert. Denn gerade der gläubige Christ hat zu allen Zeiten der Kirche eine lebhafte Witterung für die Gesetze des Todes und der Verwesung, für die Symptome der Endzeit also, gehabt, ob nun Johannes und Stephanus, ob Augustinus und Salvianus, ob Joachim v. Floris oder Oetinger und Bengel die Endzeit bestimmen und verkündigen.
Ein religiös erregter Mensch vermochte also sehr wohl aus sich oder aus der Überlieferung heraus eine vernünftige Vorstellung zu haben, nach welchen Gesetzen sich solche Endzeitvorgänge abrollen; und so wollen wir einmal die Worte aus jener Prophetie, die auf den letzten Papst ausgedeutet werden, ernst nehmen. Anlaß gibt uns dazu die Notlage, in die unsere katholischen Brüder und damit das kirchliche Leben der deutschen Christenheit durch die Indizierung der Schriften Josef Wittigs versetzt werden. Die römische Zentralverwaltung der Papstkirche hat hier das Glaubensleben aller derer getroffen, deren Herzen einer, seiner Kirche eingewachsen sind oder entgegenwachsen. In eigentümlich neuer Weise enthüllt Wittigs Schicksal die große Wende im Lehen der Christenheit, die so vielfältig empfunden wird. Wir wollen zu nächst ganz ahsehen von der Person Wittigs und wollen Lage und Leistung des Papsttums, das der Bischof von Rom bekleidet, für die christliche Kirche unabhängig uns klarzumachen versuchen.2
Die Worte der Prophetie lauten: Religio depopulata. Das heißt zunächst: die Religion ist ohne populus; sie wird „depeupliert”, entvölkert oder genauer entvolkt werden unter diesem Papste.
Hier wird also ein Erschöpfungsstadium der Papstkirche prophezeit, eine besonders tragische Lage. Welch auffallender Widerspruch zu dem, was die Erfolgsanbeter heute wahrzunehmen und auszuposaunen pflegen. Gerade Nichtkatholiken lieben es heute, eine fast bedingungslose Bewunderung vor den Erfolgen eben dieser Kirche zur Schau zu tragen und ihre Macht in die politische Rechnung mehr denn je einzustellen. Diesen ungläubigen Verehrern der Papstmacht werden wir auf einem Umweg verdeutlichen können, was es mit dem steigenden Erfolg des Papsttums auf sich hat. Dieser Umweg aber soll zugleich den gemeinsamen Kirchenboden aufdecken, auf dem die treue Gemeinde der Christen innerhalb der christlichen Denominationen sich finden kann, wenn sie beherzt die Wege der Vorsehung für die Kirche nachwandert.
Zunächst: Auf die einzelnen Päpste werden diese „Gesetze der Endzeit” umgelegt. Diese Verkörperung eines einheitlichen Geschicks durch die einzelnen Träger der dreifachen Krone entspricht dem eigentümlichen Gesetz dieses Geistesgeschöpfes Kirche. Man ordnet das zwölfte und dreizehnte Jahrhundert nach den Pontifikaten Alexanders III., des ersten „studierten” Papstes, des revolutionären Kaisermachers Innozenz III., der Urban und Bonifaz; Ranke läßt den Lauf des sechzehnten Jahrhunderts in der Geschichte der Päpste von Sixtus IV. bis Sixtus V. abrollen; eine hübsche Papstgeschichte des neunzehnten Jahrhunderts spiegelt alle Stufen und Grade und Schattierungen und Anläufe der Restauration des Ancien régime im Laufe des neunzehnten Jahrhunderts in den Papaten dieses Säkulums wider. Und wie eignet sich diese Reihe dazu, von dem unglücklichen Pius, der Napoleons Kaiserkrönung beiwohnen muß, und dem Restaurator des Jesuitenordens über den Papstkönig Italiens Pio Nono und den Vater des Antimodemisteneides, Pius X., bis zum gelehrten Bibliothekar der Ambrosiana und Legaten im restaurierten Königreich Polen Pius X I. — lauter Restaurationen: das abendländische Kaisertum , die christliche Theokratie des Mittelalters, das auf der Trennung von Glauben und Wissen errichtete Gebäude der Scholastik, die europäische Staatenwelt — alles wird zu restaurieren versucht, und die Päpste machen zwar nicht, aber sie bedeuten und bezeichnen wie ein empfindlicher Erdbebenmesser jede Erschütterung und neue Wendung in diesen Restaurationskrämpfen eines revolutionierten Jahrhunderts.
Oft hat man die ehrfurchtsvolle Empfindung, daß die Päpste so gar zur rechten Zeit zu bleiben und zur rechten Zeit zu scheiden wissen — die höchste Beglaubigung einer historischen Persönlichkeit! So hat erst die unwahrscheinliche und unerhörte Dauer des Pontifikates Leos XIII. die Festigung des Neuthomismus ermöglicht. Pius X. brach das Herz bei Kriegsausbruch. Ihm, dem Nichts-als-Priester, dem unpolitischen Frommen bescheidenster Herkunft, konnte daher für die Kriegsdauer ein Diplomat und Staatsmann aus römischem Adelsgeschlecht folgen. Als Benedikt XV. nach dem Weltkrieg stirbt, tritt in Pius XI. der gelehrte Historiker hervor. Leo XIII. hatte die Eigenschaften des Gelehrten als Restaurator des Thomas, des Staatsmannes aus seiner Tätigkeit in dem kirchenstaatlichen Zivilregime und in der päpstlichen Diplomatie, des Priesters als Bischof von Perugia wunderbar erworben und vereinigt. In seinen drei Nachfolgern erscheint diese dreifache Kraft noch einmal, aber auf die einzelnen umgelegt und auseinandergeblättert. Sie erscheint noch einmal. Und gerade diese Wiederholung ist bedeutsam. Denn damit wird eben diese Restaurationsstufe tiefer eingegraben in die Tafeln der Geschichte. Die Durchführung des neuthomistischen Programms erfolgt so zweimal, durch Leo XIII. und durch seine drei Nachfolger. Die Wichtigkeit gerade dieser Restauration wird augenfällig, wenn wir bedenken, daß erst sie die Antwort des Papsttums auf den endgültigen Verlust des Kirchenstaates darstellt. Hier wurde also eine millennare Stellungnahme notwendig. Wir sagten schon, daß Leo XIII. selbst noch ein hoher Regierungsmann des Kirchenstaats gewesen ist, auch gerade in der inneren Verwaltung des von Geistlichen regierten weltlichen Kirchenstaats. Das darf nicht vergessen, wer die Antwort Roms auf den Verlust dieser Staatsmacht, das heißt den Neuthomismus, richtig lesen will. Er dient durchaus der Erhaltung jener Weltstellung mit geistigen Mitteln; wogegen aber war der Kirchenstaat in die Welt gekommen? Er war das Gegengift gegen das Staatskirchentum. Päpsten, die wie Beamte von Kaisern abgesetzt wurden (1046 in Sutri), war dieser Ausweg aus der Erstickung durch den weltlichen Staat erst aufgedrungen, hernach notwendig und schließlich zur Gewohnheit geworden, der Ausweg, daß der Papst, das hieß: wenigstens der Papst — zum Schutze der Freiheit aller Landesbischöfe in der Staatenwelt — den Fürsten dieser Welt als Souverän überlegen oder doch unabhängig gegenüberstehen müsse. Thomas v. Aquino ist ja ein Sohn des Jahrhunderts der Papstrevolution gegen die Staufer. Er schließt nur ab, was größere Vorläufer von Gregor VII. über Bernhard und Gratian vom „verus imperator”, von den zwei Schwertern und von der päpstlichen Zentralgewalt in einer vom Eigenkirchenrecht der Laien zerfressenen Kirche gelehrt und durchgesetzt hatten. Ihnen zuerst und ihnen mit Recht sah die Welt so aus, wie sie heut jeder Priester nach dem Willen Leos XIII. auf dem Seminar ansehen lernt.
Gegen die Staaten ist der Geist dieser Lehre mit Recht gewappnet. Der Mißbrauch der Kirche zu weltlichen Yerwaltungszwecken (irreführend „Simonie” genannt) wird im zweiten Jahrtausend Schritt für Schritt aus der Kirche herausgekämpft. Dazu wird seit 1100 jener einzigartige zentralisierende Apparat in Rom, die erste rationale Verwaltung, geschaffen.3 Die Mißstände dieses Zentralismus, die von der Reformation später bekämpft worden sind, gehen nicht, wie die Reformatoren und ihre populären Jünger und Schüler vielfach bis auf den heutigen Tag wähnen, auf Konstantins Zeitalter zurück, so als sei die Kirche im 4. Jahrhundert Staatskirche geworden. Nein, Kaiser Konstantin wurde Christ. Das war alles, was damals geschah. Die römischen Staats- und Kaiserkulte wurden also damals abgeschafft!! Nicht ein — angebliches — Staatskirchentum seit Konstantin hat Luther bekämpft, sondern die gegen das Staatskirchentum der Ottonen und Heinriche sich aufreckenden Prinzipien der Staatlichkeit der Kirche! Die Reformation und ihr nach die liberale Geschichtslegende meinte 1000 und 1100, wo sie 300 sagte. Deshalb hat sie die verzweifelte Lage der mittelalterlichen Kirche, ihre Aussaugung durch den Staat, ihren großartigen Befreiungskampf nie würdigen können. Sie sah nur die Späne, die es allerdings bei diesem Blankhobeln der Kirche reichlich gegeben hatte. Deshalb war ihr der Kirchenstaat und die weltliche Macht des Papstes ein solcher Hauptspan. Aber das Staatwerden war für die Kirche das wichtigste Mittel in diesem Kampf gewesen und hatte allein in der Welt der Stammeskönige ihr einen geistigen Vorsprung zu sichern vermocht. (Heute hört man plötzlich im Munde evangelischer Funktionäre und Superintendenten das Wort „Kirche” viel öfter als irgend etwas anderes, besonders in der Öffentlichkeit. Diese Erscheinung geht aber auf die wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Landeskirchen seit dem Zerfall des Summepiskopats zurück und ist zwar eine erstaunliche Anpassung im Kampf ums Dasein, aber keine geistige oder religiöse Angelegenheit.) Wovon die Reformatoren nur den Schatten der römischen Mißwirtschaft sahen, das hat als Lichtseite den Kampf gegen das Königskirchentum. Gegen die Staaten kämpft also die Kirche der Päpste von Gregor VII. bis zu Pius X I. Das heißt: der römische Papst und der römische Zentralismus sind die Ahwehrvorrichtungen der Kirche gegen den Rückfall der christlichen Völker in die Selbstvergottung von Nationalkirchen nach dem Muster der arianischen Stammes- und Hofpriesterschaften.
Das Papsttum war in diesem Kampfe erfolgreich. Und sinnvoll erscheint danach der Ausgang der Reformation. Die Reformation hat negativ im Kampf gegen die Auswüchse der Verwaltung Roms und positiv in der Verchristlichung der Haushaltung und Hauswirtschaft Erfolge gehabt: Mißlungen ist ihr zum Glück die Herstellung jener arianischen Stammeskirchen oder Königskirchen. Die deutschen Einzelstaaten waren dazu zu klein.
Aber das Reformationszeitalter bedeutet allerdings einen Einschnitt in Roms Ringen mit den Staaten. Das Jahrtausend des Papstkampfes zerfällt dadurch in eine Periode der Abwehr der dynastischen Interessen und eine zweite Periode der Abwehr der Staatsräson. Von 1075—1564 geben die Dynastien zu schaffen mit ihren Kinder- und Verwandtschaftsehen, ihrer Behandlung der Bistümer ausschließlich als Sekundogeniturpfründen. Von Heinrich IV. bis zu dem englischen Heinrich VIII. und Landgraf Philipp läuft eine Linie fürstlicher Eheprozesse. Gegen die Allgewalt der Blutsbande des hohen Adels steht der Papst bewußt als weltlicher Politiker, Staatsmann und Regent im Felde. (Durchführung des Zölibats, Kaiserwahlbeeinflussung, Ehehindernisgesetzgebung, Ehescheidungsrecht, Bistumsverwaltung durch Koadjutoren, Ausrottung des staufischen Bluts noch in die weibliche Linie [Albrecht von Habsburg] hinein: das alles muß unter diesem einheitlichen Gesichtspunkt gesehen werden.) Gegen das Blut wird nicht nur der Kirchenstaat, sondern auch der Geist heraufbeschworen, gegen das Stammesrecht die Philosophie und Jurisprudenz der Alten. Um mit den germanischen Stammesfürsten fertig zu werden, müssen damals diese geistigen Konzessionen von der Kirche an das antike städtische Heidentum gemacht worden sein. Gerade diese Konzessionen an den Polisgeist im Kampf gegen die Stämme, der im Thomismus geschlossene Pakt zwischen Theologie und Philosophie, zwischen christlichem Glauben und vorchristlichem Wissen ist es, der sich heut an der Kirche zu rächen beginnt, weil heut ein nachchristliches Wissen anhebt. Doch davon später. In erster Linie aber rettet sich die Kirche damals durch ihre staatliche Organisation im Papsttum und dessen Herrschaft in Italien.
Als die Dynastien sich vergeistigten, als statt der Dynastie der „weltliche” Staat dem Kirchenstaat mit der eigenen Räson entgegentritt, von Karls V. Abdankung etwa bis heut zu der Staatsräson und dem Staatlichkeitsrausch der Sowjets werden die Mittel der Abwehr gegen diesen verfeinerten Polytheismus andere, aber auch sie beruhen auf dem staatlichen System einer zentralen Kirchenstaatsverfassung. Indizes und Syllabi und Eide und Enzykliken bezeichnen nun die Kämpfe Roms; je mehr Religionskriege und Interdikte ihre Kraft verlieren, bezeichnen sie die Kämpfe gegen den weltlichen Staatsgeist.
Das Königsblut wird bekämpft von Gregor VII. und Bonifazius VIII. Den Staatsgeist bekämpfen die Papstsoldaten der Neuzeit, die Jesuiten. Nichts anderes aber ist dieser Staatsgeist der Neuzeit als die Philosophie. Die Philosophie wird jetzt statt des dynastischen Interesses immer steigend die Rechtfertigerin der Staatsmacht. Deshalb rückt sie im deutschen Einzelstaat von der vierten an die erste Stelle unter den Fakultäten in der Bedeutung. Deshalb schafft die deutsche Neuzeit den Dr. phil., den Lehrer in der Weltweisheit. Der deutsche Idealismus und die von ihm durchgeführte philosophische Vergottung des weltlichen Staates pur sang ist ein Höhepunkt in der Gefährdung der Kirche durch eine rein weltliche Sozial- und Gemeinschaftslehre.
Diese Philosophie, ob nun Kant oder Fichte oder Wundt und Eucken zur Hand genommen werden, sieht die Kirche überhaupt nicht! Sie hält sie für eine Gesellschaft wie jede andere (siehe darüber Rudolf Sohms Einleitung zum zweiten Bande seines Kirchenrechts). Über natürliche, geistgeborene Gemeinschaften, wie die Kirche ist oder die Synagoge, kommen in ihren Systemen einfach nicht vor. Das sind bloß irrationale Tatsächlichkeiten. Verstanden und gedeutet wird nur Staat und Nation; der philosophische, subjektive Verstand nimmt eben nur wahr, was Weiber oder was Männer oder was Männer und Weiber zusammen in Familie und Staat bauen. Das übergeschlechtliche, menschenmenschliche Wesen der Kirche kann der aus dem Geist männlicher Einsamkeit geborene Idealismus niemals erfassen. Da er aber trotzdem wähnt, alles zu erfassen, und seine Staatstheorien für universal und prinzipiell ausgibt, so mag man die ungeheure Gefahr ermessen, die von dieser modernen mechanisch-idealistischen Philosophie von Machiavell und Descartes bis zu Treitschke und Bergson der Kirche drohte und droht. Die in die Kampffront umgegossene Kirche, das Papsttum und seine Soldaten, die Societas Jesu fanden also hier eine wichtige und jedem katholisch-christlichen Denken auch nichtrömischer Prägung ein leuchtende Aufgabe. Gegen die Staatsphilosophie wird mit Bücherverboten, Wissenschaftsbekämpfung, Gedankenspitzelei eingegriffen. Wo das Mittelalter körperlichen, leibhaftigen Kampf und Krieg gefordert hatte, Exil, Rüstung, Scheiterhaufen, Folter, spiegelnde Strafen, da wird jetzt die geistige Verketzerung und Tötung ausgebildet. Die Abtötung jeder eigenen Willensregung durch Ignatius ist die bewußte Opferung geistiger Art, die jetzt verlangt wird. Gegen den Subjektivismus der Phiosophie hilft nur der Objektivismus des jesuitischen Systems, gegen die Autonomie der Vernunft nur die Heteronomie der Autorität. Dieselbe Kirche, die einst den Völkern das Lesen und Schreiben durch die Bettelmönche beigebracht hat, um Könige und Fürsten dadurch zu bekämpfen, verbietet nun die gesamte freigeistige, d.h. auf Philosophie sich gründende Literatur. Dieselbe Kirche, die in der Scholastik die Wissenschaften der Antike zu ihrer Fundamentierung aufgeboten hat, errichtet einen Wall von Verboten gegen die kosmogonische Naturwissenschaft und die vom staatlichen Nutzen gezüchtete Weltweisheit. Man kann heut wohl jedem denkenden Christen zumuten, die Gleichung oder den Bund: Staat und Philosophie, einmal ganz ernst zu nehmen. Im Übertritt des Denkinteresses von der Kirche auf den Staat liegt die Bruchstelle zwischen Nicolaus von Cues und Machiavell, also zwischen Mittelalter und Neuzeit. Hier liegt der Bruch zwischen Morus und Campanella und Bruno einerseits, Molina und Suarez andererseits. Schnell steigert sich die weltliche Staatsphilosophen-Reihe von Grotius über Hobbes, Spinoza, Leibniz, Locke, Rousseau, Kant, Hegel, um noch bei Wilson, Bethmann-Hollweg und Mussolini und Lenin sich auszuwirken.4
Als die selbst staatlich-kriegerische Abwehrfront der Kirche gegen alle „rein weltlichen” Einflüsse innen wie außen in der Kirche ist wahrlich Roms Stellung aus einem Guß, ist sie verständlich und begreiflich. Und für jeden, der die Denkverwüstungen durch Philosophie bis hin zum Darwinismus oder Marxismus überschaut und sich eingesteht, ist auch die Notwendigkeit einer Rettung der Christenheit vor dem Zeitgeist unzweifelhaft. Wenn ich nicht römisch bin, so nicht wegen dieser ein Jahrtausend währenden erfolgreichen Abwehr des fürstlich-staatlich-philosophischen Heidentums und Mannsentums. An ihm wird mir vielmehr die providentielle Rolle dieses Teils der christlichen Kirche deutlich und wieviel ihr jeder Christ, der heut lebt, verdankt. ——–
Gegen die Gier der Dynastien, die Staatsräson, die Lügen der Philosophie, den nationaldemokratischen Paganismus bedarf es der Zionswächter. Rom ist das in Rechtskirche, in das untere Jerusalem des Gesetzes, in Synagoge umgewandelte Kirchentum. Im Kampf gegen die Welt zur Behauptung des Erworbenen und anvertrauten Erbgutes ist das Schwert des Gesetzes tragbar. Im Papsttum wächst nie das innere Leben der Kirche, sondern wird das erwachsene Leben gegen außen bewahrt.
Der Neuthomismus hat nun überraschend schnell dank dem Weltkrieg den Kampf gegen die Staaten geistig im wesentlichen gewonnen. Er sieht und erlebt heut, wie sich die Staaten wetteifernd um den Papsthof bemühen, um ihre gesunkene Autorität neu aufzuputzen. Vor allem ist der geistige Zusammenbruch der den Staaten leibeigenen Philosophenlehren augenscheinlich. Noch vor zwanzig Jahren glaubte Pius X . mit sichtlicher Bestürzung den Einbruch der philosophischen „Moderne” abwehren zu müssen. Wer aber gibt heute noch außer den dazu Angestellten für eine autonome Philosophie oder eine subjektive Weltanschauung fünf gute Groschen? Wer begreift heute noch, daß die großen Raubtiere der Staatenwelt sich von jedem Katheder im Volk bis vor wenigen Jahren heiligen oder vergotten lassen konnten? Eine neue Methode ergreift seit einem Jahrzehnt die selbständigen Denker, eine Sprechweise , die jene von Scholastik und Philosophie gezogene Scheidewand zwischen Glauben und Wissen nur für das Knaben- und Jünglingsalter, für die Schule also gelten läßt, die aber jedem Wissen der Erwachsenen gerade die Glaubenserfahrung wirklichen seelischen und Gemeinschaftslebens zugrunde legt. Dieses Denken ins Kreuz der Wirklichkeit ist nichts als das erneuerte Credo ut intelligam, das Paradox der christlichen Liebessprache, die der Geist die Kirche zu sprechen gelehrt hat.5 Wir würden den Satz vielleicht heute fassen: Credidimus quando intelligimus. Das Wissen wird so ein dem Glauben „nachfolgendes”.6 Schon beginnt in den Kreisen der Jugend statt der Lehre vom Staat die Lehre von der Kirche der geistigen Arbeit zugrunde gelegt zu werden. Allenthalben beginnen die Gegenmächte der bloß natürlichen Geisteshaltung wankend zu werden und das Feld zu räumen. Die Wandlung ist so ungeheuer, daß Rom selbst sie noch nicht begreift, vielmehr zum Kampf gegen den Nationalismus rüstet und dazu ja auch im Lande des Fascismus, der „deificata nazione”, besonderes Recht hat. Trotzdem sind die Gegner schwach. Rom behauptet das politische Feld ja gerade nicht, weil es selbst erfolgreich zum Angriff übergegangen ist, sondern weil die bisherigen Widersacher: Staaten und Dynastien und Philosophien zusammensinken und teils mit Krachen teils lautlos wegbrechen oder, wo sie sich behaupten, an Roms Gunst Verstärkung suchen.
Und hier wendet sich nun das Blatt. Rom behauptet das Schlachtfeld eines Jahrtausends. Alle Staaten finden sich gehorsam bei ihm ein. Aber es bleibt auf ihm in einer wahrhaft tragischen Lage zurück. „Im Papsttum wächst nie das innere Leben der Kirche, sondern wird das erwachsene Leben gegen außen bewahrt”, sagten wir. Jener inneren Front müssen wir uns jetzt zuwenden. Die Kirche Christi hat nicht nur eine Front gegen die Staatenwelt. Sie hat eine andere, die eigentlich lebenspendende zum populus christianus. Wenn es heißt: Kirche oder Staat, Theologie oder Philosophie, Dogma oder Ismus, dann ist die Wahl nicht schwer. Aber es gibt andere Paarungen: Apparat und Mensch, Gesetz und Liebe, natürliche Trägheit und übernatürliche Berufung, Klerus und Volk. Und in diesen Paaren ist Gott nicht mit den stärksten Bataillonen der Jesuiten und Kongregationen, der Generalvikare und Offiziale, sondern da kann die Kirche in wenigen gläubigen Gliedern wachsen, leben und gedeihen, und der übrige Leib kann stinkig werden und verwesen. Für das bereits Gewordene bürgt die römische Kirche, für das Werden gibt es keine solchen Sicherheiten im Sichtbaren, sondern nur das Wagnis des Glaubens. Gelobt sei die Kirche, die lehrt: der Staat ist nicht Gott und die Nation ist nicht Gott und der männliche oder der individuelle oder der Kollektivgeist ist nicht Gott. Daher brauchen Rechtsordnungen und Philosophiesysteme dem Christen nicht Sorgen zu machen. Jedoch ein Aber ist dabei: Das menschliche Herz ist göttlich, und ein von Liebe erleuchteter, von Leiden geläuterter Sinn macht alle Staatskunst auch Roms zuschanden.
Nach innen, diesem Herzen zu, wird die staatliche Macht Roms Gift und Despotie, wo sie auf das übernatürliche Glaubensleben von Gliedern der Kirche angewendet wird. Es ist heut ja Mode, daß gerade Protestanten z.B. den neuen Codex juris canonici Roms als Wunderwerk preisen. In Wirklichkeit ist er bloß der Kriegskodex der streitenden Kirche. Mit diesem Kodex ist der geistige Kriegerstaat Roms auf seinem Gipfel. So kann man ins Feld ziehen gegen die Welt. Aber die Nichtwelt, die Christenheit innerhalb der römischen Kirche, bedroht von ebendaher der Despotismus, der geistige Tod der Seelen. Läßt sich doch dieser Kodex in zwei Sätze zusammenfassen: „Alles ist verboten oder kann verboten werden. Von allen Verboten kann man praktisch absehen und vom meisten ausdrücklich dispensiert werden.” Damit ist deutlich: die Kirche als das Herz der Welt, als die göttlich unbeirrbare Verwirklicherin des göttlichen Lebens in Menschenherzen, als das weiterwirkende Leiden und Sterben des ersten Christen in allen seinen von ihm zum Vater zurückgebrachten Brüdern und Gotteskindem ist eben deshalb nicht in Rom. Das macht nichts, solange Rom dies Herz hütet und betreut.
Aber im Augenblicke des Sieges Roms über die Welt ist der Sieger selbst Welt, selbst ganz Kopf, ganz Philosophie, ganz Staat geworden. Er ist versteinert und hat das lebendige Herz vom Gesetz überwältigen und morden lassen. Keinen Augenblick früher durfte des Siegers Seele verscheiden. Heut aber verscheidet sie, denn das Herz wird ausgestoßen, der lebendige Mittelpunkt herausgezwängt aus dem Steingehäuse, und das Herzblut verströmt.
II. Papst und Kirche
Das Papsttum hat recht und hat recht behalten. Man braucht ja nur an seine Friedensvermittlung 1917 zu denken, an die Stellung des Papstes zu sozialen Fragen. Nachträglich geben ihm die Ereignisse recht. Es wäre 1917 besser gewesen für Europa, sich zu vertragen, es wäre 1892 (Encyclica Novarum Rerum) besser gewesen, der eigentumschaffenden Wirkung der Arbeit Rechnung zu tragen.
Aber recht haben ist nicht alles auf Erden. Es ist die irdische Seite des Erdenlebens der Kirche. Und diese irdische Seite ist nur die irdische. Die Kirche ist eine zweite, geistige Schöpfung in die erste Schöpfung hinein, und ihr lebendiger Odem ist daher der heilige Geist der Liebe, Kraft und Zucht. Der Geist des Rechts, des Gesetzes, des Kodex, des Amts ist menschlich, „ius humanum”. Sobald es zu sehr menschelt, verliert die Kirche ihre Unsterblichkeit, droht ihr der Tod.
Nun ist ein seltsamer Widerspruch in der Lage der Kirche. Niemand verteidigt so wie sie die Freiheit des Willens beim einzelnen. Niemand aber leugnet so sehr, daß Gott die Kirche selbst sterben lassen könne. Heißt das nicht dieselbe Willensfreiheit für die Kirche leugnen, die für den Einzelnen verteidigt wird? Denn Willensfreiheit und Tod bedingen einander. Der Tod ist der Sünde Sold. Es gibt keine Gnade, die nicht die Kinder Gottes luziferisch mißbrauchen können. Dann stürzen sie flugs der Hölle zu. Was kann also die ewige Verheißung an die Kirche gegenüber dem Tod durch eigene Sünde bedeuten? Nun, wie heut die Kirche haben zu Jesu Zeiten die Pharisäer argumentiert: Zion hat die Verheißungen; wenn es Gott nicht mit Worten lästert, müssen sie ihm bleiben. Und deshalb mußte Jesus folgerichtig wegen Gotteslästerung im Sinne dieser tugendhaften und frommen Zionswächter ans Kreuz. Römer 8 bewahrt diese Crux auch für unsere Zeit auf.
Wie denn nun? Hat Gott denn alle Verheißung von der Synagoge genommen? Ist mit Christus etwa das Judentum verschwunden? Mitnichten doch. Die gläubigen Juden halten noch heut an ihren Verheißungen fest. Obwohl jeder Christ glaubt, daß mit der Kreuzigung Juda sich selbst das Todesurteil gesprochen hat, ist der Jude nicht gestorben, sondern in unheimlichster Weise als Zeuge jenes Augenblickes da. Auch Juda war in der Gnade, auch Juda hatte ewige Verheißungen. Es hatte das ewige Leben, aber es war und blieb dennoch frei zur Sünde. So ist es lebendig geblieben, weil Gott treu ist; und doch gestorben, weil es gesündigt hat. Es wurde ein Volk ohne Land, ein Volk in der Verbannung, ein Volk ohne eigene Arbeit und Sprache, eine Herde, deren Zaun das Gesetz ist, aber ohne Hirten und ohne Recht an der Erde. Wenigstens lehrt gerade die Kirche selber so von Jerusalem, und nur so kann sie Gottes Treue gegen den alten Bund hinüberretten in den neuen. Die gläubigen Juden selber wenden dies Schicksal positiver, ohne daß sie es doch leugnen. Sie betrachten sich als Volk von Priestern, die ihre Staatlichkeit aufopfem müssen für dies ihr Priestertum. Zions tägliches Opfer für seine Auserwählung ist der Mut zum Verzicht, der Heroismus dessen, der weiß, daß er sein Leben und sein Wirken in Gefahr bringt, weil oder wenn er sagt: ich bin ein Jude; für den keine Rechtsordnung, kein Gesetz Bürgschaft ist gegen Haß, Achtung, Mißhandlung oder Verachtung. Der Neuheide Blüher hat vor einigen Jahren entdeckt, daß über Judas Haupt sich ein Pogrom — es war gerad vor dem Rathenaumord — zusammenziehe. Aber das ist Judas Lage und Berufung seit zweitausend Jahren. Man muß so harmlos sein wie jener, um aus der ewigen Situation Zions einen Wetterbericht für den Tag her auszulesen.
Damit ist aber an dem großen Beispiel Israels jener schmale Weg gewiesen, der zwischen ewiger Begnadung und dem durch eigene Schuld verwirkten Tod der auserwählten Schöpfungen Gottes einherzieht und nach dem die heutige Lage der Kirche uns fragen macht. Der Segen bleibt; aber der Fluch gesellt sich dazu. Die Berechtigung bleibt; aber die Beschuldigung stellt sich dazu. Der Geist bleibt; aber das volle Leben entweicht. Und ein Schatten, ein Gespenst, tritt an die Stelle des blutvollen Lebens.
Die Kirche wird nicht sterben im äußerlichen Sinne des Wortes. Mussolini wird dafür sorgen, daß Italien die internationale Sehenswürdigkeit des Papsttums behält. Er hat das vor Jahren schon zynisch ausgesprochen. Die terza Roma gebraucht den Vatikan als zweites Rom, wie sie die Ausgrabungen auf dem Forum und in Pompeji als Rom des Augustus gebraucht. Aber das Italien, von dem das Papsttum heut konserviert wird, ist nicht mehr das Italien, das die Päpste im Kampf gegen das Imperium zum Leben erweckt, revolutioniert, aufgerufen und geschaffen haben. Seit Gregor war Italien ein Feld der Papstpolitik und ein Gegenstand des päpstlichen Prestiges. Seit Mussolini wird der Papst ein Gegenstand der fascistischen Politik und des italienischen Prestiges.7 Dieser Prozeß nimmt rasch zu. Der Fascio glaubt die katholische Kirche an Italien zu binden, wenn er das Papsttum protegiert. Und bei seiner ungemessenen Eitelkeit und seinen begrenzten an derweitigen internationalen Belangen wird er mit diesem Pfunde kräftig zu wuchern suchen.
So droht der Kirche von niemandem mehr eine Gefahr. Sogar und gerade in Italien hat der Staat entdeckt, daß er gar nichts besseres tun kann, als das Papsttum zu hofieren. Denn Rom hofieren heißt die Kirche humanisieren, heißt sie verirdischen und zur Rechts Kirche entkräften, heißt sie erniedrigen zum unteren Jerusalem der Zionswächter, zur erfolgreichen Macht unter Mächten und Potentaten. Womit sie gleich viel gilt wie alle irdischen Mächte und also gleichgültig wird. In den letzten Jahren sind reichlich Romane erschienen, die versucht haben, das Kommen des Antichrist dramatisch zu schildern. Das unübersteigliche Hindernis war, ein Papsttum, das von der Welt verfolgt wird, glaubhaft zu erfinden. Benson und Solowjew sind an dieser Aufgabe gescheitert. Es ist nicht glaubhaft, daß der Papst Petrus II. aus Italien vertrieben wird usw. usw. Die verzweifelte Lage des Papsttums ist, daß es nicht verfolgt wird! Der Fluch, der dem Segen an Petrus heut sich beigesellt, ist ein viel schrecklicherer: Wenn der Papst eine italienische Sehenswürdigkeit wird, so wird er eine Lokalgröße. Roms Fluch ist ein anderer als der von den Juden verwirkte. Er muß ein anderer sein nach Roms Eigenart. Es hat keinen Sinn, der Papstkirche die Orte zu nehmen, wie den Juden durch die Zerstreuung. Heimatlos wurde das Volk der jüdischen Stämme. Denn dies Volk von Priestern war ja und ist ein Volk der Familie, des Kinderreichtums, der Blut- und Rassenaufzucht. Die Kirche aber ist ein Volk von ehelosen Priestern, der Geistesverbindungen und geistigen Erbfolge, der Askese. Ein solches Volk schreckt man nicht durch Land- oder Heimatlosigkeit. Im Gegenteil — der Geistige missioniert gern, und die Bodenständigkeit ist ihm die schwerere Entschließung. Was also kann der Kirche sonst drohen? Das Volk Gottes verlor seinen Tempel. Der Tempel Gottes — verliert er sein Volk?
„Religio depopulata” heißt es von dem Regiment des Papstes. Die römische Priesterkirche mag kraft ihrer Verheißungen ewig bleiben, aber sie würde zum Gespenst, wenn sie eine Kirche ohne Volk würde; ein Außengehäuse zur Verteidigung der Wahrheit bliebe machtvoll versteinert stehen. Die Tore der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Aber das innere Leben der Papstburg hinter den Zinnen und Spitzen, Blut und Saft des Stammes der Kirche unter der jahrtausendalten Rinde des römischen Zentralismus— wie steht es mit der Verheißung für ihre Erneuerung?
III. Kirche und Volk
Wollen wir die Lage des katholischen Volkes ermessen, so müssen wir sehen, in welcher Weise es in den Bau der römisch-katholischen Kirche eingefügt worden ist. Wir werden auf einige allgemeine Erscheinungen dabei hinweisen müssen, und dann auf die Gestalt Josef Wittigs einzugehen haben, in dem dies treue katholische Volkstum noch einmal zu urgewaltiger Sprache innerhalb der Kirche gekommen ist. An Josef Wittigs Geschick verdeutlicht sich viel von dem, was über die Religio depopulata hier angedeutet worden ist. Wir begnügen uns aber deshalb auch, auf die Lage in Deutschland einzugehen. Das kirchliche Leben bei uns geht uns nahe. Unsere Betrachtung ist keine welthistorisch-erhabene. Sondern die Zukunft der Offenbarung Christi und seiner Kirche in unserem Volke ist das Anliegen und die Not, aus denen heraus allein wir sehend und hörend werden können. Nur diese liebevolle Verbundenheit mit einer begrenzten Not gibt Erkenntnisse. „Einzig die liebende Teilnahme bietet das Mittel zu verstehen”, sagt Augustin.
Als Obrigkeitskirche ist das Christentum nach Deutschland gekommen, als Verwaltungsmittelpunkte der fränkischen und deutschen Herrscher sind seine Bistümer gegründet worden. Als Erbstifter der adligen Sippen entstanden die Klöster in den verschiedenen Stammlanden. Als Kulturkirche und als Gesetzesreligion kam die neue Lehre ins Land. Auch später, als die romanisch-fränkische Kultur Verwaltungskirche durch die Geistes- und Rechtskirche der Scholastik abgelöst wurde, nahm Deutschland lange Jahrhunderte nur abgeschwächt an dieser Wandlung teil, weil ihm Stätten wie Bologna, Oxford, Paris und Orleans fehlten. Die Reformation ist auf diese Zurückgebliebenheit zum guten Teil zurückzuführen. In einem kurzen Sprung versuchte damals Deutschland aufzuholen, was es seit 1100 als Träger des kriegerischen Imperium geistig und kirchlich versäumt hatte. Deshalb nun seit dem fünfzehnten Jahrhundert die zahllosen Universitäten in Deutschland, deshalb die Bedeutung des deutschen Professors und der „Wissenschaft” — eines Wortes, das so Engländern und Franzosen fehlt — für die deutschen Reformationsstaaten. Die „teutsche Libertät” hat damals sich angeeignet, was ihr vor allem gefehlt hatte, die „akademische Freiheit”, so wie die Sowjets heute Hygiene, Technik und Naturwissenschaft Europas fanatisch anbeten, weil Rußland dies vor allem bis zur Revolution fehlte.
Im Abwehrkampf gegen diese neue Natur der Staatsuniversitäten hat sich die scholastische Geistkirche zur Jesuiten-, das heißt zur Kampfkirche gewandelt. Kampf ist ein Vorgang des natürlichen Daseins. So wurde also aus der Geistkirche von 1250 die Naturkirche, die Restaurationskirche von 1870, wie einst in entsprechender Wandlung aus der Kulturkirche Gregors I. im Investiturstreit Gregors VII. die Geistkirche geworden war. Alle diese drei Kirchenformen, Kulturkirche, Geistkirche und Naturkirche sind sich aber in einem gleich: Sie haben das Volk als Ganzes zur Betreuung übernommen, es ist christliches Volk ausschließlich kraft Taufe, und das heißt kraft der Erbfolge der Bekehrung. Wer sich persönlich bekehrt, wird Mönch oder Priester. Die ersten Jahre der Kirche haben es anders gesehen. Da war die Kirche nicht in erster Linie Geisteshochburg, nicht in erster Linie Naturkampfmacht, sondern sie war Seelenkirche. Seele um Seele ward ihr in persönlicher Bekehrung von Paulus bis zu Augustinus errungen! Ein katholischer Neutestamentler schreibt über diese Wandlung 8: „In der späteren Entwicklung — als das Heidentum sozusagen überwunden war und man nicht mehr durch Bekehrung, sondern gewissermaßen schon vom Mutterschoße an Christ wurde, als an die Stelle der vom Judentum oder Heidentum zum Christentum übertretenden Erwachsenen immer mehr die Kinder heidnischer oder christlicher Eltern traten, die eben einen Bekehrungsprozeß eben sowenig durchmachen können als sie einen Glaubensakt zu erwecken imstande sind —, haben sich die äußeren Voraussetzungen der paulinischen Lehre derart verschoben (früher zuerst gläubig, dann getauft werden, jetzt erst getauft, dann zum Glauben gelangend), daß sie selber völlig in den Hintergrund trat.”
In Deutschland wurde nun im wesentlichen nur der Klerus Träger dieser seelenkirchlichen ersten Schicht des Kirchenbaues aus Bekehrten statt aus Getauften. Ja im Klerus weitgehend wieder nur der, der jetzt eben deshalb den Namen des conversus, des Bekehrten bekam: der Mönch. Der Mehrzahl aller geistlichen Ämter aber wurden schon in der Kindheit die Kandidaten zugeführt oder bestimmt. Und so war selbst im Mönchtum der bekehrte Erwachsene die Ausnahme, nicht die Regel.
Der Geistliche ist Obrigkeit, ist Gelehrter und ist Führer zum politischen Kampf. Der selbst durch ein Damaskus hindurchgegangene, wiedergeborene Seelenhirte ist zusätzlich. Er fehlt nicht. Aber ihm haftet in allen seinen Funktionen vielfältig eine jener drei anderen Tätigkeiten vorwiegend an. Der Geistliche als Prozeßrichter, als Standesbeamter, als Zehntenbezieher, als Schulinspektor, als Wirtschaftsmeister, als politischer Führer, als Steuereinnehmer für den Staat, ist wesensälter als der jubelnde bekehrte Bekehrer auf deutschem Boden.9
Das treue katholische Volk hat seine ganze Kraft dafür hergegeben, um dem römischen Stuhl seine Kampfkraft gegen die Weltmächte zu ermöglichen. Seine Liebe diente willig dem Gesetz, das natürliche Volk dem geistlichen Klerus, der Mensch dem Apparat. Das natürliche Volk hat die Kleruskirche gespeist und ernährt, hat ihr — bisher — seine besten Söhne zugeführt. Die Selbstdarstellung des Volks, das doch an sich nicht aus Unmündigen bestehen soll, sondern Erwachsene, vollreife Ehemänner, liebende Bräute und Mütter, Führer und Gesetzgeber, Denker und Dichter umfaßt, kam darüber zu kurz. Denn die dem populus christianus zugewandten Gnadenmittel erhielten mehr und mehr etwas Zweitrangiges gegenüber dem Gnadenleben des Klerus. Nicht nach der Lehre der Kirche, aber nach der unvermeidlichen Praxis. Das Weltleben des Christen erlangte nie dieselbe Beauftragung, Führungsgewißheit, Heiligung wie das Leben des Klerikers oder gar Mönchs. Der Laie darf gewiß in der vita illuminativa ein einzelnes Kirchenjahr nachleben oder sich in der vita unitiva in seinen Gang mit hineinschwingen. Immer ist es doch nur ein einzelnes Jahr seines Lebens! Das Kirchenjahr verdichtet ein volles Menschenleben und das volle Leben der von diesem Menschensohne gestifteten Kirche. Auch der Laie selber aber lebt ein volles Leben von 70 oder 80 Jahren. Indeß die Kirche weiht sein Leben nicht mit der Vollkraft des biographischen Lebenslaufs. Die vita illuminativa oder Exerzitien oder mystische Versenkung oder die vita unitiva oder der moralische Lebenswandel oder die guten Werke oder die häufige Kommunion sind für den Laien niemals sein Leben selbst mit seinen persönlichen Gefahren und Aufträgen. Für den Geistlichen hingegen sind diese Dinge der eigene Beruf. Wenn Mönche liturgische Neuerungen erstreben, so ist das ernst: Es geht nicht nur um die eigene, sondern um die einzige ernste Lebensform, die ihnen eignet. Wenn aber erwachsene Laien liturgische Bewegung machen, so bleibt das vollwirklichste Stück ihrer Gotteskindschaft: Ehe und Arbeit, draußen aus diesem Gottesreich. Gott aber duldet keinen Partikularismus der Seelenkräfte. Der Spruch des Evangeliums sagt, daß es nur zwei Gebote gibt: den Nächsten zu lieben und Gott. Dies Gebot wird heut oft genannt. Daher braucht unsere Zeit nicht so sehr an das Gebot selbst erinnert zu werden. Aber die Unterscheidung der Liebesweisen in diesem Gebot ist abhanden gekommen. Die Menschen verkrampfen sich heut nämlich oft darein, ihren Nächsten, zum Beispiel die Geliebte, das Kind, den Armen, den Freund mit ihrem ganzen Vermögen zu lieben. Gott aber lieben sie wie sich selbst, nämlich dann, wenn im Stundenplan oder Terminkalender die Religion an der Reihe ist. Die Religion läßt sich so auf Zeitabschnitte neben Kunst, Beruf, Politik und Wissenschaft verteilen, Gott nicht. Das Leben des Laien in der Kirche ist also in dieser äußersten Gefahr: daß ihm nur gestattet wird, Religion zu praktizieren, statt Gott mit allen seinen Kräften zu offenbaren und zu bezeugen.
Die Kirche hat diese Peinlichkeit längst empfunden. Sie hat mit den kirchlichen Sakramenten den Lebenslauf von Taufe über Firmung und Eheschließung bis zur letzten Ölung zu begleiten und einzurahmen getrachtet. Aber Begleitung und Einrahmung ist noch etwas unpersönlich - allgemeines gegenüber dem wirklichen Termin des Mündigwerdens, des Mannwerdens, den kein Kirchenkalender vorher wissen kann. Die Priesterweihe gewährt dem Kleriker ein allerpersönlichstes Sakrament. Auch der heranwachsende Laie sollte den Anbruch seines Bundes mit der Welt seines Wirkens, seines Schaffens sakramental fassen dürfen und dazu ermutigt werden.
Gewiß, die Kirche hat zu diesem Zwecke den Beruf verklärt. Der Heiligung des Berufs durch Standesvereine und Traktätchen gilt ein eifriges Bemühen. Aber dieser bekannte, eindeutige, anhaltende und in der Standesehre sicher gegründete Beruf ist etwas Stationäres, Starres, das weder im Wirtschaftsleben noch in der Seele eines lebendigen, wachsenden und abnehmenden Menschen so zu finden ist. Heute wenigstens gibt es diese Berufe nicht mehr. Nur die Menschen, die mehrere Berufe heute zu kombinieren oder nacheinander zu durchlaufen wagen, bleiben menschlich. Der Beruf „ist” nichts; er wird aus vielen sogenannten Berufen. Und gerade das ist die christliche Lehre vom Beruf, wie sie der Klerus durchaus auf sich anwendet. Das Laienvolk bekommt daher auch hier nur ein Surrogat, einen zeitlos-starren Ersatzbegriff für die vollkräftige Berufung zugestanden.
Die Vereinsbetriebsamkeit aber weiter, die helfen soll, ist weder Fisch noch Fleisch; sie ist weder innerkirchliches Sakramentsleben noch wirkliche Berufsheiligung. Sie ist vielmehr Ersatz für beides. So bleibt das Volk letzten Endes doch nur auf die Vorschule des Lebens in Gott angewiesen und wird auf sie hingewiesen: auf Mystik und Moral. In der Mystik wird kirchlich-klerikales Leben komprimiert gekostet und genossen. Alle Mystik ist geistige Vorwegnahme, geistiges Wiederholen oder geistiges Auskosten der Wunder des sakramentalen Glaubenslebens, der sakramentalen Vereinigung mit Gott. Sie ist immer in der Gefahr geistiger Unzucht schon durch die Vereinsamung. Und sie hat nichts besonderes mit dem christlichen Glauben gemein, sondern ist ein Element der natürlichen Religion überhaupt. Sie erlaubt einen abgekürzten Genuß und eine verbilligte Mitgliedschaft des Lebens der Kirche, und stellt sich daher ein, wo aus dem Glaubensleben die Stundenplan-Religion als Sondergebiet innerhalb des Gesamtlebens werden soll.
Parallel dazu ist die Moral die Vorschule für das sittliche Glaubensleben. Sie ist ja die Regel für die schon dagewesenen, bloß wiederholten, aus dem Strom des Lebens herausgebrochenen und mit Etiketten belegten menschlichen Handlungen. Der Mensch handelt, wenn er moralisch handelt, nicht schöpferisch, frei, unter der Führung Gottes in einer erst während und durch sein Handeln erschaffenen Weit. Sondern er handelt wie alle Leute handeln. Jede Tat heißt so und so im kleinen oder großen Katechismus. Was er gibt sich daraus für das Verhältnis des Volkes der Laien zu Moral und Mystik? Der Mensch muß hindurch durch die Moral wie durch die Mystik. Ein fünfzehn]ähriges Mädchen muß die Süßigkeiten des Mysteriums irgendwie mystisch schmecken, ein sechzehnjähriger Knabe die Regeln der Moral fürchten lernen. In beiden Fällen wird dem Neuling der Schatz der Überlieferung vermittelt. Die Mystik beschenkt das neu hereinwachsende Glied der Kirche mit der Fülle der Wunder für den Gnadenstand der Seele; die Moral belastet dasselbe Glied mit der Fülle der Gesetzesfälle für den Sündenstand der Seele. In beiden Fällen lernen sie erröten, dort vor Freude, hier vor Furcht, und beidemal werden sie da durch aufgepflügt. Aber beide sind Einübungen auf das Christentum! Beide bleiben auf der Ebene der natürlichen Religion. Und wie die Mystik, die Selbstzweck wird, zur Unzucht entartet, so verdirbt eine Moral, über die der mündige Christ nicht hinaus dringt, seine Kraft. Die höchst moralische Kirchlichkeit der Laien macht sie geistig kraftlos.
Mystik und Moral sind die stehenden Gewässer, in denen das Glaubensleben des populus christianus sich zu sacken droht, wenn der Geist fehlt, der Unzucht und Kraftlosigkeit überwindet, wie er der Geist der Liebe, Kraft und Zucht ist, der Geist des höheren Jerusalem, der Geist der Erlösten und der Gotteskinder, die er wachsen sind zur Vollreife der Erwachsenheit, der Männlichkeit Christi. Mündiges Christentum bleibt dem katholischen Laien versagt. Ein Beispiel der jüngsten Zeit mag das belegen. Seit bald zehn Jahren tobt der Kampf um die Ausbildung des Volksschullehrers. Die Frage ist eine Unterfrage der Erwachsenenbildung in unserem Volke überhaupt. In den Kreisen derer, die Erwachsenenbildung ernst nehmen10, ist es klar, daß der Erwachsene anders lernt als das Kind. Der Erwachsene lernt im Kampf, an Widerständen, im Widerspruch, im Wandern. Der Lehrer im Volk, der hernach eine Lebenszeit in seinem Dorf leben soll, muß einmal die Welt im geistigen Sinne gesehen, einmal mannhaft widerstanden haben, muß einmal mündig geworden sein. Dieser Glaube an ein seelisches Mannesalter gilt ganz unabhängig von Konfessionalismus, Standesinteressen und Universitätsambitionen der reichlich mißleiteten Lehrerschaft.
Trotzdem will die Kirche den Lehrer dem sechsjährigen Kinde gleichstellen. Weil sie 1848 um die Volksschule und im Kulturkampf um die Gymnasien als Bekenntnisschulen mit Recht gekämpft hat, denn Kinder müssen allerdings in gegebenen Formwelten aufwachsen, deshalb bannt der Bischof von Limburg jede Äußerung zugunsten einer simultanen Lehrerakademie. Die Simultanschule für Kinder mag man noch so verwerfen und muß trotzdem aus christlichem Glauben die Kampfzeit für den Erwachsenen in der Welt zu leben Verpflichteten, ja gar in ihr Lehrenden fordern — freilich unter einer Bedingung, daß man nämlich an ein mündiges, männliches Christentum von Laien glaubt.
Liest man aber die bischöfliche Argumentation, so erschrickt man, mit welcher Selbstverständlichkeit hier die Gründe, die für sechsjährige Kinder gelten, auf Einundzwanzigjährige übertragen werden. Nur deshalb haben wir den Fall hier näher berührt. Wenn der Gedanke der Bewährung, dieser allerchristlichste Grundsatz, wenigstens erörtert würde, so ließe man sich auch eine Ablehnung der „mannhaften” Lehrerbildung gefallen. So aber ist der künftige Lehrer des Volks genau so ein Schäflein in der Herde wie der Erstklässler. Und dies eben ist die Haltung, in die das katholische Volk hineingedrängt wird; die ewige Verlängerung des vierzehnten Lebensjahres wird ihm seelisch — geistig angesonnen. Würde das durchgeführt, so müßten Skrupulanten und Betschwestern am Ende als die wohlgeratensten Früchte am Baume des Laienchristentums gelten, nicht aber eine Jungfrau von Orleans. Und damit wäre die Religion dann für die Erwachsenen, die Mündigen eine Kinderschule geworden. Sie entwachsen einer solchen Kirche, sie mögen wollen oder nicht, unter tausend Schmerzen oder voll Widerwillens mit eherner Notwendigkeit einfach, weil sie wachsen. Und dies geistliche Wachstum wird um so dringender, wenn täglich Hunderttausende durch die Wirtschaftsordnung um das natürliche Ersatzmittel für diese Mannwerdung gebracht werden. Die Arbeitsfrage, die Proletarisierung der Massen ist nämlich eine Frage vom Mündigwerden des christlichen Laien, weil die vom Thomismus empfohlene aus alten Wirtschaftsweisen stammende Zuweisung von Privateigentum heut versagt. Solange die Eheschließung auch Gründung einer eigenen Wirtschaft bedeutete, wurde der Mann dank der neuen Verantwortung in einem eigenen Wirkungskreis auf natürlichem Wege Mann und Meister. Heut ist das Wirtschaftsleben völlig abgetrennt vom Liebes- und Eheleben. Und der Proletarier kann nur durch geistliche Gemeindebildung und geistige Kämpfe den gegenwärtigen Zustand wirtschaftlicher Unmündigkeit und Knabenhaftigkeit, eben sein Proletariertum seelisch überdauern. Eine Kirche, die den sonst nirgends zur Manneswürde zugelassenen Arbeiter selbst in der Kirche klerikal leitet, verkennt die Krankheit, an der er — und das ist heut die Mehrzahl des Volkes — durch die Abhängigkeit in seiner Arbeit leidet. Sie verkennt es, weil sonst der Erwachsene im Vollsinn selbst zur Kirchenobrigkeit gehören müßte. Und davor schrickt sie zurück. Was ist die Folge? Die Kirche wird unwirksam. Und wenn man die Laienmännerschaft dreißigmal im Monat kommunizieren läßt und diese Praxis Laienapostolat betitelt, das Volk, auf das es ankommt, das Volkstum nämlich, das in jenen Laien steckt, wandert auf diese Weise nicht mit in die Kirche und wirkt sich nicht als Glied am Corpus Christi aus. In das Gotteshaus gehen die Männer. Aber dies Haus ist aus Stein. Die Statistiken erfassen eben nicht, was diese selben Männer im Volke wirklich arbeiten, reden, kämpfen, wirken und tun, inwiefern sie also selbst Gottes Haus als lebendige Bausteine bauen: Und nur dadurch würde ein Stück Laientum, ein Stück Volkskraft der Kirche, auf die es ankommt, der Seelenkirche, apostolischen Kirche, eingegliedert. Das sogenannte Laienapostolat ist Knaben- oder Jünglingsübung. Es verhüllt nur die Gefahr, die heraufzieht, daß man die Leiber des Volks in die Kirchen bekommt, aber die Seelen nicht in die Kirche. Nur die Unwirksamkeit der Kirche — deren Lehren ich mich beuge — hat auch mich selber vor den Toren der Kirche halt machen und mein Gehör meinen Nächsten, Seinem Volk zuwenden lassen. Doch abgesehen von allem Persönlichen —: Gott ist ein Gott der Lebendigen, derer die ihn mit ihrem ganzen ungeteilten Vermögen lieben, nicht — Religio depopulata.
IV. Josef Wittigs Wirken und Schicksal
Dem katholischen Volk ist ein Sprecher erstanden, ein Anwalt seines Wachstums und seiner Mündigkeit. Ein männlicher Mann, ein Kind des armen Glatzer Berglandes, Zimmermannssohn und selbst handwerklich in aller freien Zeit tätig, schwer oder gar nicht aus der angestammten Landschaft herauszubringen, verwachsen mit dem Leben seiner hart ums Brot kämpfenden Geschwister, in allen Ferien auf das Heimatdorf zurückkehrend, hat Josef Wittig in zwanzig Jahren alle Stationen des Priesterberufs und des Universitätslehramts pflichtmäßig durchschritten und erfüllt. Er hat zünftig lehren gelernt und zünftig predigen. Er ist ein liturgischer Mensch, wie denn die werkhafte und die priesterliche Haltung etwas Verwandtes aufweisen.
Aber als ihm im Schwabenalter der Sprachborn aufsprang, als die geistige Liebe der ersten Lebenshälfte Geistesgestalt werden sollte, im Alter des Vollkommens und des Mannes, da zeigte sich, daß er von seinem Volk Zeugnis ablegen mußte, dem Volk des dreieinigen Gottes. Jedes Menschen Leben enthält einen Auftrag und eine Sendung, und es bleibt darum solange ein Geheimnis, bis die Wendung zu diesem Auftrag hin deutlich wird. Dann mit der Wendung kommen die Schwierigkeiten; bis dahin scheint ja der Mensch ein Mensch zu sein, nun eben ein Mensch wie alle andern auch, gleichgültig, gleichviel wert, geachtet nach Herkommen, Stand, Lebensalter und Vermögen. Nun wird er zweideutig, unbestimmt, weil er sich in einen Berufenen wandelt. In diesem Engpaß und auf den Stromschnellen dieses Felsentales rettet den Menschen vor der Welt zuerst das vorher gesparte Kapital an gutem Namen, Ansehen, Redlichkeit, Moral, Examina und bürgerlichen Leistungen. Dennoch hilft dem Werdenden alles dies nur ein Weile. Ein Ärgernis, ein Bruch ist notwendig. Wer „ein” Mensch war und nun „dieser” Mensch des Ecce homo zu werden beginnt, der ist ja eben deshalb im Mittelstadium „zweideutig”. Die einen deuten ihn noch als „einen”, die andern schon als „diesen” Menschen. Erst hinter dem Bruch, hinter dem Ärgernis, wird der Mensch eindeutig; ganz eindeutig ist sogar erst der Vollendete, zur ewigen Seligkeit Eingegangene. Dieser Weg der Mannwerdung gleicht dem Kreuzweg des Wachstums und Leidens und Vollendens, den Jesus als den Lebensweg des Menschensohnes offenbart hat. Es geht ihn seitdem jeder, der ihm nachfolgt. Auch Wittig schien eindeutig ein katholischer Theologieprofessor, auch Wittig wurde, als er ins Alter der Berufung und des Schaffens trat, dem Lebenskreis, in dem er zu wurzeln schein, zweideutig. Auch Wittig hat den Bruch jetzt erfahren und wird den Liebenden und Erlösbaren sichtbar und eindeutig.
Auch dies andere würde sein Schicksal noch nicht zu mehr als einem Fall unter den vielen Fällen der römischen Kirchengeschichte machen, daß es doch die Autorität in der Kirche ist, die hier ein kirchliches Glied mißhandelt oder ermordet. Solcher Opfer ist die Geschichte voll. Bei der Jungfrau von Orleans hat ja die Kirche selbst ihr eigenes Urteil revidiert. Rom ist weltmännisch und staatsmännisch, und um größerer Liebe willen wird auch ein keimendes Leben wohl geopfert. Wäre der Fall Wittig der Fall Josef Wittigs, so brauchte man nur erneut festzustellen, was wunderschön im „Hochland” vom Oktober 1925 ausgesprochen worden ist, daß die Institution brutal ist. Vielleicht, daß man noch hinzusetzen dürfte, es möchten die lebendigen katholischen Glieder der Kirche unter dem römischen Papst an solch einem Falle auch ihrerseits die providentielle Aufgabe einer nichtrömischen Christenheit begreifen.
Aber der Fall Wittig hat eine tiefere Bedeutung. Die Unscheinbarkeit, daß „bloß” ein Mensch hier leidet, spricht nicht dagegen. Die großen Entscheidungen im Leben fallen in kleinen Dingen. Gott ist unscheinbar. Viel wichtiger und folgenreicher als päpstliche Weltkriegsfriedensvermittlung, Jubeljahre und Enzykliken ist die Behandlung eines lebendigen Gliedes der Kirche, eines Menschen, einer armen, aber lebendigen, von Gott geschaffenen Menschenseele. Die von Gott gebaute, von Christus hinterlassene Kirche besteht nicht aus der Peterskirche, dem Vatikan, dem Freiburger Münster einerseits und anderseits aus Leuten, die dort oder hier an diesen Steinhäusern Karriere machen wollen, sondern sie besteht aus laufenden, ringenden, und im Lauf und Ringen von Gott zu seinem Dom zusammengebauten Menschen, die hernach und unterwegen auch Bischofspaläste und Kirchen aus Stein bauen mögen, wenn dazu Zeit ist. Also wie gesagt, die Unscheinharkeit des Falles mag römische Diplomaten zum Lächeln bringen; einen Christen müssen immer die leisen, lautlosen, unscheinbaren Vorgänge durchschauern. Denn er weiß, daß er nichts „Besonderes”, „Heroisches” zu tun hat in der Welt, sondern nur das Alltägliche und Geringe und Kleine auf besondere Weise.
Das Besondere des Falles Wittig aber liegt darin, daß die römische Kirche durch die Ausstoßung von Josef Wittig einen entscheidenden Schritt zur „Religio depopulata”, ich möchte persönlich glauben: den entscheidenden, getan hat. Sie hat ihre Erneuerungshoffnung erstickt. Sie hat zwischen Kirche des Klerus und Kirche des Volks gewählt und das Volkstum der Klerikerkirche ohne jede Einschränkung geopfert. Damit wird sie zu jenem kraftlosen, entvolkten Mythos. Als in sich endgültiges, versteinertes Mythologem wird sie dem kraftvollen Leben entrückt. Die Papstkirche und ihre Geschichte wird zum alten Testament der christlichen Weit. In ihr, ihren Dogmen und Riten haben die Völker, die sie durchtränkt und durchwirkt hat, nun den alten Bund: die Kirche bleibt, aber sie hat ihre Kraft ausgewirkt oder verwirkt, wie man das nun ausdrücken mag. Sie wirkt nicht mehr, weil sie die Wirklichkeit des Volkstums, des christlichen Volkes nicht mehr erträgt.
Um das zu verstehen, müssen wir die Zweideutigkeiten ausräumen, die von Wittigs Gegnern um ihn gehäuft werden. Er ist Professor. Also scheint er wohl irgendeine Irrlehre, eine Weltanschauung oder einen Ismus zu lehren. Das wäre allerdings eine rein individuelle Angelegenheit. Was ein Professor sagt, dem widerspricht der nächste. Auch die ehrlichste Überzeugung des Wahrheitskämpfers ist nur seine Überzeugung, ja nur - seine Meinung. Und Meinungen können nicht tragisch genommen werden. Nun ist es richtig, daß Wittigs Gegner Professoren der Dogmatik sind. Das erregt den Anschein, als sei er selber wohl auch einer. Gerade dies ist der grundlegende Irrtum der kirchlichen Behörden, als gehe es Wittig um einzelne Sätze eines dogmatischen Lehrbuches, um Begriffe eines Kathedersystems, um Schulwissen für Schulbuben und solche Gehirne, die das zeitlebens — als sogenannte Akademiker und Gebildete — zu bleiben pflegen. Aber Wittig kämpft für das Dogma gegen die Dogmatikprofessoren, für die christliche Sprechweise gegen die heidnisch-aristotelische Denkweise, für die Namen gegen die Begriffe, für das Erbgut der christlichen Weisheit gegen den Modernismus der scholastischen Wissenschaft.
Denn Wittig ist mit jeder Zeile und mit den großen Werken als Ganzen, die er geschrieben hat, der Anwalt des dogmengläubigen Laien gegenüber der Gehirnakrobatik des Dogmensystematikers, des geschehenden Gemeinschaftslebens gegenüber der juristisch-philosophisch-obrigkeitlichen Theorie über dies Gemeinschaftsleben. Er ist der geborne Antimodernist. Denn ihm ist nicht nur das mathematisch-subjektive Weltbild der neuzeitlichen Philosophie ein Dorf jenseits der Grenzen seiner Grafschaft Glatz, ein böhmisches Dorf, sondern ebenso das syllogistisch-objektive Weltbild der scholastischen Philosophie. Beides ist ihm weder des Kampfes noch der Widerlegung wert. Er hat alle Hände voll zu tun, niederzuschreiben, wie das arme aber erlöste Christenvolk Gott den Herrn Vater Sohn und Heiligen Geist, preist und verherrlicht. „Ich selber kann und mag nicht ruhn; des großen Gottes großes Tun erweckt mir alle Sinnen; ich singe mit, wenn alles singt, und lasse, was dem Höchsten klingt, aus meinem Herzen rinnen.”
Dazu gehört allerdings eine Urgesundheit, um als Professor an einer deutschen Universität kein Idealist, kein Begriffler, kein Thomist und kein Kantianer, sondern ein sprechender und singender Laie zu sein. Ein Gegner druckt daher, er sei nervenzerrüttet usw. usw.! Die Freunde aber nennen ihn klagend und seufzend einen Dichter! So weit sind wir in dieser technisierten und organisierten und kunstvergötzenden Welt, daß ein Mensch, der Gottes Urwort und Uroffenbarung kindlich in Gebet und Lobgesang, in Geschichte und Erzählung aufklingen und rinnen läßt, ein »Dichter« sein muß. So machen die Theologen und Philosophen heut die Sprecher und Sager unschädlich. Was an Wittig poetisch und dichterisch erscheint, ist die Gleichniskraft unverdorbener Sprache und Seelenfülle. In des alten Arbeiter Fischers Lebensbeschreibung (herausgegeben von Göhre) — Wittig möge mir verzeihen — finden sich Töne derselben Poesie, derselben Epik, des selben Humors, die ja auch die bloßen Gelehrten theoretisch dank der romantisch historischen Wissenschaft alle als Attribute des Volkstums kennen und anerkennen. Also Wittig ist kein Dichtertheologe — was doch nur eine höfliche Umschreibung für einen harmlosen Narren sein soll -, er ist nicht harmlos und kein Narr, wenngleich er waffenlos dazustehen scheint wie das arme Volk. Aber dies Volk der Armut und Arbeit, der Erde und der Entsagung scheint euch Akademikern nur harmlos, ihr sterbt und euer Werk ist fruchtlos. Das Volk aber bleibt und trägt Frucht tausendfältig. Und das ist seine Waffe. Keine Waffe im sichtbaren Raum hat die schlichte Sprache des Herzens, aber die unendliche Wirkung in der werdenden, geschichtlichen Zeit.
Wittigs Vorleben ist ein wunderbar behütetes in dem Sinne, daß ihm die Wurzeln seines Volkstums durch die Akademikertracht nicht abgedrosselt worden sind bis ins reife Mannesalter. Er ist übrigens auch beruflich nicht Dogmatiker, sondern Historiker der alten Kirche der Väter, der Seelenkirche, also der aus Volk, nicht aus Kultur oder Wissenschaft oder Politik gefügten Kirche, wie wir das oben dargelegt haben. Er hat keinen irrigen Ismus zu vertreten, weil er nicht jene Trennung der Geisteskräfte in Glauben und Wissen in sich vorfindet, sondern Gott mit seinem ganzen Vermögen liebt. Er ist kein „Fideist”; denn er verachtet nicht Vernunft und Wissenschaft. Seine höchst gelehrte und entsagungsvolle, im Interesse des Verlegers soeben anonym erscheinende altchristliche Literaturgeschichte beweist das. Aber er weiß und lebt jene neue Welt, die, von Scholastik und Philosophie, von objektiv und subjektiv gleichmäßig angeekelt, der Liebeskraft der von Gott geschaffenen Geistessprache sich anzuvertrauen wagt. Wir können nie mehr als etwas sagen und aussprechen; denken ist nicht mehr, sondern weniger als sagen, eine nützliche Vorbegreifung oder Nachbedenkung der Sprache, aber immer Diener des heiligen Geistes. Nie ist der Gedanke selbst heiliger Geist. Denn ihm fehlt die zeitliche und örtliche Bestimmtheit, die konkrete Wirksamkeit, kraft der dem heiligen Geist Persönlichkeit beigelegt werden muß.
Wir können nicht Wittigs einzelne Zeilen und Worte auf ihre Rechtgläubigkeit hier prüfen. Und wenn wir es könnten, täten wir es nicht. Denn sein Werk ist ein Lebenswerk, ist ein einheitliches Schaffen des Mannes. Und gerade das ist das Fatale, was sich im Verhalten der Papstkirche wie gegen das Laienvolk so hier gegen den Anwalt des Volkes zeigt; sie sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Sie sieht Worte, aber nicht Sätze, Sätze, aber nicht Kapitel, Kapitel, aber nicht Bücher, Bücher, aber kein Wirken, so wenig wie sie beim Laien etwas anderes als einzelne Fälle, Handlungen, Akte, sogar Glaubensakte!, als abgeschnittene Sekundenspreu sieht oder duldet. Wie sie dem Laien nur ein Schulbubendasein aus lauter zerschnittenen Stunden zutraut, so hat sie nicht gesehen, daß sie nicht Bücher Wittigs auf den Index setzen konnte, ohne sich selber durch diese Schandliste ein für allemal von dem einheitlichen Wirken des Mannes Wittig zu scheiden. In einem philosophischen System, in einem theologischen Disput, wie zwischen Luther und Eck, kann ich Sätze verwerfen lassen. Dem Psalmisten, dem sagenden und singenden Menschen, kann man entweder lauschen oder man kann ihn hinauswerfen. So hat man denn auch sich nicht die Mühe genommen, einzelne Sätze in seinen Schriften zu zensieren, sondern hat fünf seiner Hauptschriften in Bausch und Bogen verboten, ohne Abänderungen bedenklicher Stellen zu ermöglichen, hat ihm ferner verboten, ohne Erlaubnis der römischen Stelle künftig etwas zu drucken, und hat damit den geistigen Menschen Wittig in jedem Falle vernichtet. Unterwirft er sich, so kann sich ja nur der Entgeisterte unterwerfen. Unterwirft er sich nicht, so haben seine Worte keine Hörerschaft!
Denn hier zeigt sich eine weitere Besonderheit des Falles Wittig. Der „Ketzer” hat eine Rückzugslinie ins philosophische Lager. Der abtrünnige Priester wünscht zu heiraten; kurz, irgendeine zweite Welt öffnet sich und eben deshalb schließt sich die alte kirchliche zu. Anders bei Wittig. Er hat ja das Herz gegen den Kopf, die Seelenkirche gegen die Obrigkeitskirche, das Dogma gegen die Dogmatiker verteidigt. Er hat eine solche Rückzugslinie in eine unkirchliche Geisteswelt nicht. Er könnte wieder Handwerker, wieder Volk, wieder Dörfler werden, denn er ist es immer geblieben; aber er hat keinen geistigen Ort und kein Wort außerhalb der Kirche zu sagen! Deshalb hat er ja „Die Kirche als Auswirkung der christlichen Seele” geschrieben — flugs auf den Index damit; deshalb hat er „Die Erlösten” von dem Moralin der Beichtjurisdiktion zu erlösen gewagt — flugs auf den Index damit. Deshalb hat er in „Herrgottswissen” und in „Die Kirche im Waldwinkel” die innersten Winkel der christlichen Kirche verklärt, weil er selbst nur im Innersten zu Hause ist.
Sein Lebenswerk gipfelt in dem „Leben Jesu in Palästina, Schlesien und anderswo”. Statt an Zeilen und Sätzen wollen wir daher an diesem Werk im ganzen zeigen, was Wittig der Kirche für einen Dienst geleistet hat. Die Geschichte des Lebens Jesu ist bekanntlich ein tragisches Kapitel in der Geschichte des neuzeitlichen Liberalismus. Von Reimarus bis Wrede führt durch ein hundertfünfzig Jahre eine tragikomische Reihe, an der Geister wie Herder und Hegel eifrig teilgenommen haben. Es waren alles Versuche , das „Leben” im Sinne der Lebensphilosophie, also vom Anfang und der Geburt her, zu beschreiben. Dieses ist die „natürliche” Lebensgeschichte. Sie genügt beim natürlichen Menschen der Gattung, bei „einem” Menschen. Denn der bleibt ja in seiner Natur. Aber Jesus ist der Stifter des übernatürlichen Lebens, das die Berufung empfängt, sich umwendet, die Zweideutigkeit mit dem Tode büßt und erst dadurch zur gesegneten Wirksamkeit gelangt. Die natürliche Biographie ist daher immer subjektive Milieuschilderung vom Biographen aus. Und so ist der Film von Reimarus bis Wrede abgerollt, bis ihn Albert Schweitzer entlarvte in seiner „Geschichte der Leben Jesu-Forschung”11. Seitdem gibt es natürlich noch Kinderbücher „Jesus der Jüngling” und ähnliches Zuckerwasser, aber mit Schweitzer ist die natürliche Leben Jesu-Forschung erledigt. Albert Schweitzer hat bekanntlich zur Besiegelung dieser Erledigung die weltlich-ärztliche Mission am Kongo erwählt, dem unerkennbaren Christus zu dienen statt dem subjektiv stilisierten Jesus der liberalen Theologie. Die alte Kirche hat dem gegenüber in den Evangelien, den Evangelienharmonien — bis zum Heliand — und in den Mysterien der Liturgie und der liturgischen Spiele das Leben von der Passionsgeschichte her, und das heißt das göttliche Leben des Menschensohnes gestaltet. Immer aber bleibt zwischen natürlicher Biographie und Passionsgeschichte ein schroffer Abgrund. Man kann ja die Passion als Thanatographie, weil alles aufs Kreuz beziehend, bezeichnen. Der Gläubige erkennt dann nur die kirchliche Thanatographie an, der Ungläubige nur die wissenschaftliche Biographie. Dies aber heißt den Abgrund zwischen Glauben und Wissen im Kernpunkte des Dogmas selbst verewigen. Dies Nebeneinander von theologischer Thanatologie und philosophischer Biographie Jesu ist in den Jahren seit dem Erscheinen von Schweitzers Buch auf einem unüberbietbaren Höhepunkt. Wie sehr, das zeigt die Wirkung der „philosophischen” Karikatur der liberalen Theologie, der neuheidnischen „Aristie des Jesus von Nazareth” auf die katholische Jugend, oder der Rückfall ins Gedankenlose gegenüber dieser Frage nach der ungeteilten Wirklichkeit von Leben und Sterben Jesu bei Karl Barth und Peterson. Die Scheidung in Passion und Bios, in das, was wir von Jesus als Glieder der Kirche glauben, und in das, was wir von Jesus als wissenschaftliche Forscher wissen, ist eben deshalb so unerträglich geworden , weil wir Gott auf die Dauer nur mit unserem ganzen Vermögen lieben können, und also jede Teilung dieser Gottesliebe den Glauben an die Göttlichkeit Jesu zerstören muß. Hier also begegnen uns die Verwüstungen der scholastischen Lehre von den verschiedenen Erkenntnisvermögen im Zentrum des Christenglaubens unserer Tage. Die ganze geistige Zerrissenheit des abgelaufenen Jahrtausends tritt in der Leben Jesu-Forschung erschreckend und Entscheidung, nein Verwandlung fordernd, vor uns. „Das Leben Jesu in Palästina, Schlesien und anderswo” wählt weder den Weg theologischer Thanatographie noch wissenschaftlicher Biographie. Weder ein natürlicher Heros erhält sein monumentum aere perennius, noch Gott eine neue Legende. Die Objektivität und die Subjektivität, beide haben zurückzutreten vor der Liebe, die Wittigs Leben in das Leben Jesu hineingesät und aus ihm hat er wachsen lassen. Auf drei Weisen, meint Wittig, könne man das Leben Jesu schreiben. Er wolle die dritte Weise wählen, in der es weiterlebe. „Der Mensch weiß nur soviel als er liebt.” Die eigenen mit der Passion Christi verlebten Jugendjahre, die mit Jesus, dem Meister seiner Jünger, verbrachten Lehr- und Wanderjahre, und der kraft Jesu geschöpflicher, weihnachtlicher Gestalt erlebte eigene Durchbruch zur Meisterschaft der Kindlichkeit, des ewigen Lebens in der Wiedergeburt und Erlösung erzählt Wittig, weil ja diese Erfahrungen allein wissend machen können! Hier ist jene neue Sprechweise, von der bereits oben als Erfüllung der Zeit die Rede war. Der Erzähler selbst weiß sich als Teil und Glied dessen, was er erzählt. Nur deshalb kann er erzählen. Aber deshalb sind ihm auch die Geheimnisse aufgetan, die im Übergang von der aus Gottvater geschenkten Vita zu der von Gottsohn geschenkten Passion liegen. Kein Doketismus — wie ihn die Obrigkeitskirche angsterfüllt den Laien zu mutet — und kein Naturalismus —, wie ihn der freie Geist nur zu bieten weiß —, zwischen beiden blickt der durch die Liebe wissend gewordene Sinn des Laien helläugig hindurch. Den alten Satz: daß Erkenntnisgrund und Realgrund nicht dasselbe sind, wendet Wittig entschlossen so an, daß er gleichzeitig beide Wege uns mitgehen läßt: den Weg seiner Erfahrung: da steht das Kreuz vor dem Knaben, Weihnachten begreift erst in seiner ganzen Erlösungsfülle der zum Geschöpf erlöste Erwachsene. Der Weg der Geschichte: da geschieht alles in der „richtigen” Reihenfolge. Aber beide sind nötig, eine Notwendigkeit, die Philosophen und Theologen gleichmäßig verkennen. Damit ist aller Modernismus in der Wurzel ausgerottet. Denn nun ist das Leben Jesu und das Weiterleben im Erzähler beides zusammen die Erneuerung des Dogmas von der unlöslichen Verknüpfung des Glaubens an den Vater, an den Sohn und an den heiligen Geist! Dies heißt Ernstmachen, dies heißt Praktizieren des dritten Glaubensartikels, der Schöpfung des Lebens und Offenbarung des Todes beide erschließt, dadurch wird die unerträgliche Sackgasse, in die eine den dritten Glaubensartikel tot liegen lassende Theologie geraten war, geöffnet. Die Konsequenzen dieses Verfahrens reichen über das Gesamtgebiet des Geisteslebens und der Wissenschaften. Und dieser Mann, der das leistet, was Pius X. mit seinem Antimodernismuseid äußerlich versucht hat, soll den Antimodernisteneid schwören, weil er die katholische Lehre von Grand aus zerstöre! So als habe er diesen Eid nicht mit jeder Zeile seiner Bücher geschworen. Aber Rom sieht eben nicht dies einheitliche Wirken, es sieht nur den „Fall”, nicht das Schaffen. Das Schaffen ist die Krone des Geschöpflichen, und in ihm werden uns unsere Sünden vergeben, wenn Sündenvergebung irgend Sinn haben soll. Das Schaffen ist nicht Werk oder Handlung, sondern Einsatz der Person im Glauben. Nicht umsonst „schuf Gott den Menschen in seinem Bilde”. Dröhnend wird dieser Satz wiederholt: Im Bilde Gottes schuf er ihn. Wittigs Einsatz gilt der Mannwerdung des Volks der Laien: „Jetzt laß das ängstliche Sorgen um die Sünde!12 Jetzt tritt aus den Lehrlings jahren in die Gesellenjahre über! Hilf mir am Reiche Gottes arbeiten, so fleißig und eifrig, daß die Sünden von allein verschwinden. Sieh, einmal mußt du auch Meister werden!” „Aber die Laien glauben, immer wieder Anfängerarbeit leisten zu müssen und wer den selten zum Glauben an sittliche Mannesreife und Meisterschaft ermutigt … Wir brauchen Lehrlingsstand, Gesellenstand, Meisterstand, brauchen Knechtsarbeit, Knappenschaft und Ritterschaft.” Alle diese Ordnungen und Kräfte liegen, wenn auch noch so keimhaft, im katholischen Wesen. „Grabt nur nach in dem reichen Mutterboden der katholischen Kirche! Scheltet nicht andere, wenn die Entwicklung noch nicht weiter ist, wenn sie unterbrochen scheint, denn ihr selber seid ja die Kirche. Entwickelt euch! Ordnet euch zu einem Volke der Erlösten!”
Hier aber steht der Satz, der erklärt, weshalb Rom auf Denunziation deutscher Dogmatiker despotisch gegen Wittig vorging und sein Saitenspiel zerbrach: „Denn ihr selber seid ja die Kirche.” Hier hat ein Theologe sich selbst vergessen, im Sinne des Evangeliums, und seine Bruderschaft mit dem Volk eingestanden. Die Theologen denken bestenfalls an ihre Studentlein — so ist auch wohl die Denuntiatio begründet worden — Wittig denkt an das Volk. Und das Volk geht dem Theologennachwuchs vor. Oder nicht? Die Kirche scheint doch mehr Angst um ihre Studenten zu haben als um das Volk. Ich kenne einen Theologen, der zum Kampf gegen Wittig aufbrach, als dieser ihm gestand: ich hasse die Theologen. Auch dies wieder ist vom Evangelium geboten. Wittig als Theolog und Priester muß dies sein Selbst hassen; das Evangelium meint bei dem Selbsthaß, den es zur Voraussetzung der Nachfolge macht, ja gerade die Abwendung von dem, was uns zur Natur geworden ist, also in erster Linie den eigenen Stand. Nur solche Selbstvergessenheit hätte die Klerikerkirche mit den Laien zu neuem seelischen Ausbruch verschmelzen können. Die Selbstvergessenheit des Geistes wurde ihr hier dargelebt. Sie brauchte sie nur zu dulden. Aber gerade hier bleibt Rom am empfindlichsten und zieht das Dasein als klerikaler Mythos und römisches Monument der Wiedergeburt zum Volk der Erlösten vor. Daher versteht Rom Wittig überhaupt nicht; Lutherus redivivus macht man aus einem Manne, der doch gerade nicht die geruhsame Beugung unter eine weltliche Obrigkeit predigt, sondern ein Mitarbeiten an der geistlichen Obrigkeit! Man hat ihn in einem Gutachten zum Jansenisten gemacht, zum Thomisten in der Willenslehre, zum Modemisten, nur um ihn braten zu können. Sie begreifen nicht, daß er spricht, wo sie denken, erzählt, wo sie memorieren, das Dogma durchlebt wissen will, wo sie Dogmatik wissen wollen. Aber sie begreifen „am meisten die Schilderung der Menschlichkeiten des Dogmatikers” und „hier kommt das Hufeisen zum Vorschein”. Jeder Fachmensch muß seine Berufslaster durchschauen. Ein christlicher Dogmatiker aber, der das nicht kann, ist unerträglich. Wittig sagt dazu13: „Ich verachte den theologischen Stil der Dogmatiker nicht, sondern ich halte ihn für ganz unwirksam, wenn er dem Volke gegenüber angewendet wird mit dem Anspruch, verstanden zu werden. Und über Unwirksames und doch immer wieder Versuchtes kommt mir manchmal ein vielleicht sehr unziemliches Lachen.” „Was ich über die Dogmatiker gesagt habe, ist von vielen als Spott über das Dogma aufgefaßt worden. Das tut mir sehr leid. Aber es ist auch ein Zeichen dafür, daß man den rechten Unterschied zwischen Dogma und Dogmatik, und zwischen Dogmatik und Dogmatikern nicht versteht.” Lachen, Weinen, Spotten, Lieben — das tut der Lehrer des Volkes. Der Fachmann ist feierlich. Deshalb hat der Fall Wittig mit dem Fall Hehn, dem Fall Schell und sämtlichen Fällen seit Gründung des Index nicht die geringste Ähnlichkeit. In Wittig wird nicht der Theologe verurteilt, sondern der Nichttheologe! Wittig ist nicht mit seinem Kopf der Kirche entwachsen, sondern mit seinem Herzen, das des Volkes ist, erliegt er der menschlich-irdischen Infiltration der Kirche des zweiten Jahrtausends. Von der durch die Scholastik heidnisch vergifteten Dogmatik der Papstkirche mit ihrer Spaltung der Geisteskräfte in Glauben und Wissen ist er als zu vollwirklich und zu vollsaftig, als zu lebendig und zu fröhlich nicht ertragen worden. Er liebt ja Gott mit seinem ganzen Vermögen, der Dogmatiker aber nur mit zwei halben! Dieser Klerus weiß selber nicht mehr, was er zu glauben lehrt. Es sind zu viele gelehrte Kontroversen darüber gehäuft. Die Dogmatiker selber glauben alle nur noch implicite. Wenn nun einer kommt, der sicherer, schlichter, völliger glaubt als sie alle, so stört er die humorlose Feierlichkeit der Amtsstube. Das Herz wird nicht verloren gehen, so groß seine Leiden sein werden. Aber die Kirche des Papstes wird zur bloßen Religio, zur Religio depopulata, zur Kirche ohne Volk.
“Religio Depopulata” als Teil des PDF-Scan
-
von Eugen Rosenstock, ausgegeben März 1926. ↩
-
Als Legitimation dafür, daß der nicht katholische Verfasser die Ereignisse im Leben der Kirche und Christenheit nicht von einem partikularen oder protestierenden Standpunkt zu betrachten pflegt, muß er seine älteren Äußerungen zur Kirchenfrage hier namhaft machen: „Europa und die Christenheit.” Josef Kösel, Kempten 1919. „Die Epochen des Kirchenrechts” in „Die Hochzeit des Krieges und der Revolution”. Patmosverlag 1920 (jetzt Berlin, Verlag der Arbeitsgemeinschaft). „Die Welt vor dem Blick der Kirche”; „Das Herz der Welt, ein Maßstab der Politik”, in „Kirche und Wirklichkeit, ein katholisches Zeitbuch”. Jena 1923. „Protestantismus und Volksbildung”. Eckartverlag, Berlin 1925 ↩
-
Vgl. Fabre-Duchesne, Introduction zur Ausgabe des Liber Pontificalis. ↩
-
Wilsons Buch über den Staat, Riezlers (Bethmanns Mitarbeiter) Buch über die N ationen, Mussolinis Dissertation über Machiavell und Lenins Schriften sehen alle die Kirche einfach nicht. ↩
-
Vgl. Franz Rosenzweig, Das neue Denken, im »Morgen«. 1925. ↩
-
Darüber siehe meine Soziologie I, 46ff. ↩
-
Vgl. Mussolinis Neujahrsansprache 1926 an den Gubernator Roms Cremonesi. Das nächste Konzil soll nach der Ankündigung Pius XI. die feierliche Aussöhnung mit Italien bringen. ↩
-
Abgedruckt bei Wittig, Meine »Erlösten« in Buße, Kampf und Wehr, Habelschwerdt 1925, S. 134f. ↩
-
1518 wurde die Türkensteuer des Reiches durch die Pfarrer von den Abendmahlsbesuchern ein kassiert. ↩
-
Vgl. die Deutsche Schule für Volksforschung und Erwachsenenbildung des Hohenrodter Bundes und Picht-Rosenstock „Im Kampf um die Erwachsenenbildung 1912-1926.“ ↩
-
Erste Auflage Tübingen 1906, dritte Auflage ebenda 1922. ↩
-
Ich notiere dazu die Äußerung des heiligmäßigen englischen Jesuiten Plater: W e all care a lot too much about our sins. Vgl. seine Biographie von C. C. Martindale. S.I. Harding & More, London 1924. ↩
-
Meine „Erlösten” in Buße, Kampf u. Wehr. Franke, Habelschwerdt 1925, S.97f. ↩