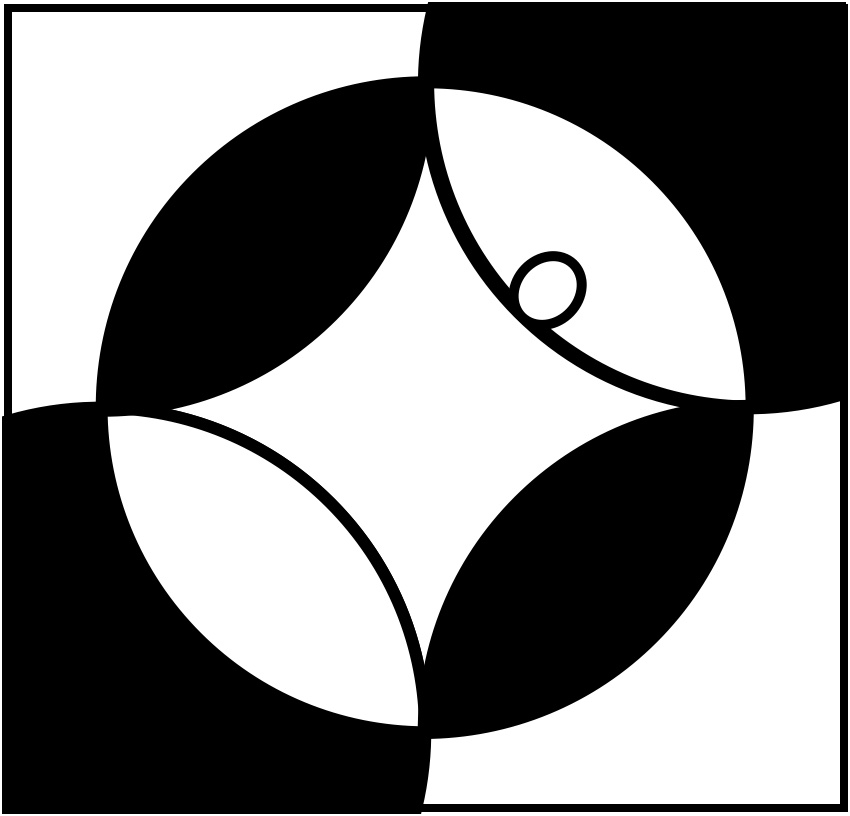Sven Bergmann: Warum St. Georgs-Reden?
Deutsche Eigenart im Spiegel Englands
Zwei Ereignisse haben im Ersten Weltkrieg zu erregten Diskussionen im deutschen Heer geführt: Der „Offiziershaß” und die „Judenzählung”. Auf den handgreiflichen Autoritätsverlust im Kriegsverlauf versuchte die Oberste Heeresleitung mit Schulungskursen zu reagieren. Als Leutnant organisierte Eugen Rosenstock dreitägige Lehrgänge für seine 103. Infanterie-Division. Im Rahmen dieser „Volkshochschule an der Front” entstanden die „St. Georgs-Reden”. Von den geplanten 49 Reden sind 16 überliefert. Dabei konnte er auf seine Überlegungen „Ein Landfriede” von 1912 aufbauen. Grundlegend war der Anspruch, keine „Stimmungsmache” im Sinne der offiziellen Kriegspropaganda zu betreiben. Die Herzen der Mitkämpfer sollten durch Würdigung der gemeinsamen Not des Tages und ein aufrichtiges Mitleiden gewonnen werden, gegen machtlüsterne Drachen wie gegen winselnde Würmer: „Schon 1915 entwarf ich einen Dialog, in dem die Veteranen des ersten Weltkrieges aus allen Völkern dadurch Frieden schlossen, daß sie sich zu des Feindes ständiger Gegenwart überwanden und mit ihm ins Gespräch kamen.” (Eugen Rosenstock-Huessy, Liturgisches Denken in zwei Kapiteln, in: ders.: Die Sprache des Menschengeschlechts. Eine leibhaftige Grammatik in vier Teilen, Bd.1, Heidelberg: Verlag Lambert Schneider 1963, S.485ff.).
Aber warum stellte er seine Reden seit 1915 in Kontext zum Heiligen Georg? Einen Hinweis gibt seine Freundschaft zu Werner Picht und dessen Interesse für England sowie für Stefan George (auch Eugens Schwager Hermann U. Kantorwicz war dem Frühwerk des Dichters zugetan). Der ein Jahr ältere Picht hatte 1912, nach beendetem juristischem Studium bei Alfred Weber, mit einer Arbeit über „Toynbee Hall und die englische Settlement-Bewegung: Ein Beitrag zur Geschichte der sozialen Bewegung in England” promoviert. Darin griff er einen Gedanken Max Webers auf: „Eine dankbare Aufgabe wäre der Vergleich mit dem christlichen Sozialismus Englands.” (Max Weber, Rez.: Was heißt Christlich-Sozial? Gesammelte Aufsätze von Friedrich Naumann <1894>). Genau dieser Aufgabe hatte sich Werner Picht in Anknüpfung an Pionierarbeiten der „Kathedersozialisten” Gerhart von Schulze-Gaevernitz und Lujo Brentano gestellt. Bei Picht ging es um die Niederlassungen Gebildeter in den Armenvierteln der englischen Großstädte und die Arbeiterbildungsbewegung. Dabei widmete er sich vor allem den „zwei großen Propheten” Thomas Carlyle und John Ruskin. Es war Ruskin, der einen „Code of the Guild of St. George” aufgestellt hatte: „We will try to take some small piece of English ground, beautiful, peaceful and fruitful. We will have no steam-engines upon it, and no railroads; we will have no untended or unthought-of creatures on it; none wretched, but the sick; none idle, but the dead.”
Im Jahr 1900 unternahm ein Hamburger Kandidat der Theologie, Walter Classen, eine Reise nach England, um die dortigen Settlements und speziell Toynbee Hall kennen zu lernen. Er hatte ein Gefühl für die Gefahr, welche in der Spaltung des Volks in zwei völlig getrennte Hälften, in die „zwei Nationen” nach dem Wort Disraelis, liegt, und er wollte sehen, ob man von den Engländern lernen könne, die Klassengegensätze zu überbrücken. (Werner Picht, Toynbee Hall und die englische Settlement-Bewegung. Ein Beitrag zur Geschichte der sozialen Bewegung in England (= Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik : Ergänzungsheft IX), Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 1913, S.121.)
Einige Gedanken aus seiner Dissertation stellte Werner Picht im „soziologischen Seminar” der Universität Heidelberg vor. Ein weiterer Referent zum Thema „Kunst und Volk” war Fritz Wichert, der neue Direktor der Mannheimer Kunsthalle (seit 1909). Der vergessene Vorgänger des Frankfurter Kulturdezernenten Hilmar Hoffmannhatte mit einer „Akademie für Jedermann” Aufmerksamkeit und Interesse gefunden. Das Doktoren- und Dozentenseminar galt intern als „Max-Weber-Seminar”, auch wenn dieser nicht beteiligt war, und ist nicht zu verwechseln mit dem „Baden-Badener Gesprächskreis” von 1910. In Heidelberg wurde vereinbart, daß Werner Picht seine Forschungen bei einer öffentlichen Veranstaltung in der benachbarten Industriemetropole Mannheim vorstellt. Im Anschluß an den Vortrag stieß der Grundgedanke eines harmonischen Austauschs zwischen den „zwei Nationen” auf Skepsis. Für den Heidelberger Mitstudenten, russischen Emigranten und Mannheimer Sozialdemokraten Eugen Leviné waren diese Hoffnungen trügerisch oder würden bald durch die bevorstehende Revolution überholt. Für ihn war klar: „Solange die Proletarierkinder mit den Bürgerskindern nicht zusammen spielen, solange glaube ich nicht an Eure Menschheitsversöhnung und an Eure brüderliche Gesinnung.” (Zitat aus „Dienst auf dem Planeten”)
Durch diese Position fühlten sich Werner Picht und Eugen Rosenstock herausgefordert. An eine Lösung der sozialen Frage durch gemeinsames Teetrinken glaubten auch sie nicht. Aber in der Überbrückung der Gegensätze durch gemeinschaftliche Arbeit sahen sie einen deutschen Weg. Diesen Gedanken brachten sie in ihr Engagement für die Erwachsenenbildung ein und später beim Aufbau gemeinsamer freiwilliger Arbeitslager für Arbeiter, Bauern und Studenten. Sicher hatten sie dabei Goethes Mahnung im Hinterkopf: „Wer sich Sankt-Georgen-Ritter nennet, denkt nicht gleich Sankt Georg zu sein”.
Die geplante „volksbildnerische Initiative” einer Zusammenarbeit zwischen Arbeitern und Bildungsbürgertum, zwischen Universität und Industriestadt, kam letztlich nicht zustande. Eugen Rosenstock vermutete eine Intervention Eugen Levinés bei der lokalen Mannheimer Sozialdemokratie. Ein kleines Vorspiel seiner Erfahrungen bei Gründung der Akademie für Arbeit in Frankfurt. Nur rührte hier der Widerstand eher aus Richtung des ungebrochenen akademischen Überlegenheitsgefühl des Lehrkörpers.
1917 fiel der Name St. Georg noch in einem anderen Kontext. Der Mitarbeiter Friedrich Naumanns, Wilhelm Heile, berichtete in der liberalen Zeitschrift „Die Hilfe” über den abgesetzten Reichskanzler Georg Michaelis:
Der Mann, den die Ritter vom großen Wort als den ersehnten starken Mann und neuen Sankt Georg begrüßten, der sich selbst mit einer krätzigen Sprache einführte, sich die Führung nicht aus der Hand nehmen lassen wollte: er ist nach hundert Tagen gegangen. Und der nun nach ihm als siebenter Kanzler an den Platz getreten ist, an dem einst Bismarck stand, ist derselbe Graf Hertling, dem der Kaiser schon im Juli das Amt des Kanzlers und des preußischen Ministerpräsidenten angeboten hat. (Wilhelm Heile, Die neue Regierung, in: Die Hilfe, 23.Jg., Nr.45 (1917, 8. Nov.), S.676).