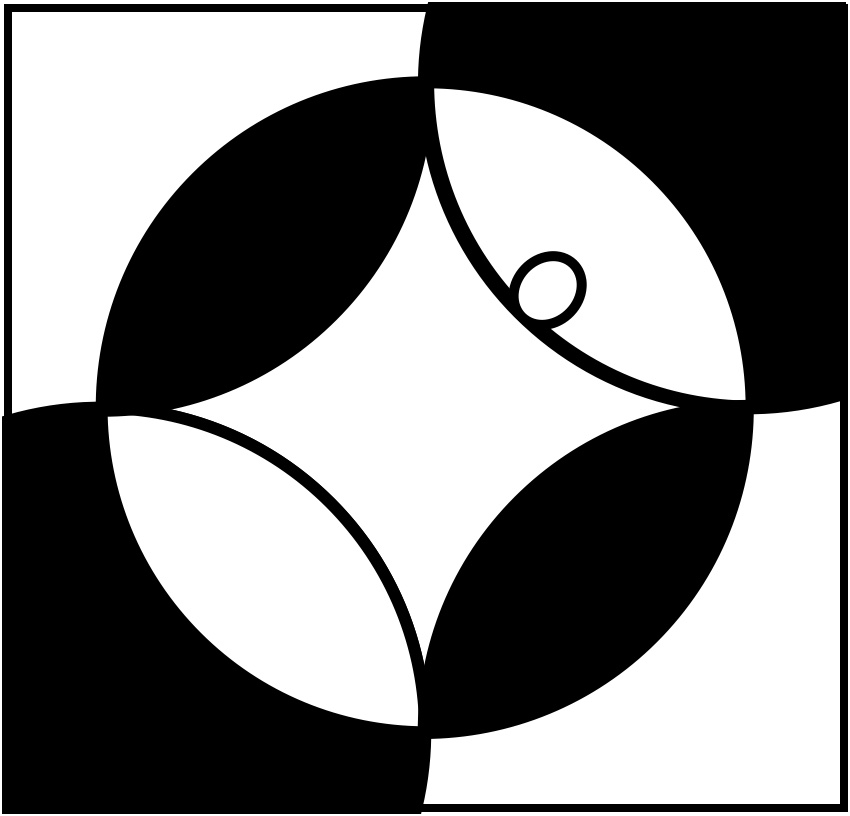Rudolf Hermeier: Zum Leben Eugen Rosenstock-Huessys
Zum Leben Eugen Rosenstock-Huessys
Für die Erwachten gibt es nur eine gemeinsame Welt. Heraklit
Eugen Rosenstock-Huessy wurde am 6. Juli 1888 in Berlin als Sohn eines Bankiers geboren. Er wuchs in einem liberalen jüdischen Elternhaus mit sechs Schwestern auf. Der hochbegabte Gymnasiast zeigte schon früh besondere Interessen für Sprachen und Zeitordnungen. So übersetzte er als Vierzehnjähriger einen altägyptischen Text und mit zu seinen ersten Arbeiten, die später veröffentlicht wurden, zählt »Zur Ausbildung des mittelalterlichen Festkalenders«. Sprache, Zeit und Geschichte können als Stichworte für sein lebenlanges Bemühen gelten.
Als sich der Vierundzwanzigjährige 1912 in Leipzig mit einem Thema zur mittelalterlichen Rechtsgeschichte habilitierte, sah das nach einer glänzenden akademischen Karriere aus. Doch der Kriegsausbruch 1914 setzte dem ein Ende. Der »Einjährige« folgte dem Ruf des deutschen Kaisers. 1914 wurde für Rosenstock noch in sehr persönlicher Beziehung ein entscheidendes Jahr: er begegnete der Schweizerin Margrit Huessy und heiratete sie; später wurde der Mädchenname seiner Frau seinem Namen angefügt. Den Krieg erlebte der deutsche Offizier in Frankreich, u.a. vor Verdun. Bezeichnend ist für ihn, daß er statt Kriegspropaganda zu betreiben, 1916/17 mit ausgewählten Soldaten mehrtägige Gespräche führte - erste praktische Anfänge der Erwachsenenbildung. Im Rückblick erschienen Rosenstock die ersten Weltkriegsjahre als seine »Genieperiode«. In der Einsamkeit als Soldat verfaßte er geistreiche »Reden« und Briefe, entwarf erste Konzeptionen einer »leibhaftigen Grammatik« und der »Europäischen Revolutionen« (letztere zur Zeit der Februarrevolution 1917 in Rußland). Doch ab Ende 1917 wurde ihm immer klarer, daß »Dienst und Opfer« sein Leben bestimmen müßten.
Aus dieser akzeptierten Bestimmung heraus ist es erklärbar, daß er 1918 nicht an die Universität zurückging, daß er sich dagegen in der Erwachsenenbildung.engagierte und in freiwilligen Arbeitsdiensten (Deutschland und Amerika). Freilich zwang ihn 1923 materielle Not - er mußte für Frau und Sohn sorgen - , einen Ruf an die Breslauer Universität anzunehmen (Ordinariat für deutsche Rechtsgeschichte, bürgerliches, Handels- und Arbeitsrecht). 1933 ging er nach Amerika. Er lehrte zunächst in Harvard und, nach einer Auseinandersetzung mit dem dort herrschenden Zeitgeist, darauf im Dartmouth College, Hanover / N.H., dem er dann treu blieb. Er erwarb einen Hof im benachbarten Norwich/Vt, wo er am 24. Februar 1973 starb. Er liegt neben seiner Frau auf dem dortigen Friedhof begraben. Auf seinem Grabstein steht der Vers aus dem Johannesevangelium von der Fleischwerdung des WORTES. Diese Skizze sei durch vier Hinweise ergänzt:
1. Ais Christ aufgewacht
In einem Brief an seinen Freund aus späten Lebensjahren Georg Müller schreibt Rosenstock 1957: »Ich bin als Christ aufgewacht, wollte mit fünfzehn Pfarrer werden. Von Sexta ab oder von der Nona. . . nahm ich am christlichen Religionsunterricht teil. Wir hatten einen herrlichen Chororganisten, Kaverau, bei dem mein Herz heute noch lacht: die Händel und Bach-, die höchst christlichen Weihnachts-, Oster- und Pfingstfeiern zu Hause waren höchst eindringlich . . . - Ein sehr alter imposanter Großonkel war mit meiner Mutter aktiv, mich zu überzeugen. Er war ein aktiver Protestant. Dabei konnte ich ohne Falschheit von einer anima naturaliter christiana reden . . . — Als ich mit siebzehn zum Pfarrer ging und um die Taufe nachsuchte .:, da erschien mir das als eine verspätete Nachholung. Das Ereignis hat seelisch bei mir nicht die geringste Epoche gemacht. Im Gegenteil. Bekehrt wurde ich nie.”
Später äußerte Rosenstock, daß bei ihm schon sein zentrales Interesse für »Gemeindebildung« früh mit der Einsicht verbunden gewesen sei, diesem nur als »Laie« nachgehen zu dürfen.
In Rosenstock begegnet man also einem Christen ohne »Bekehrung« und ohne Talar, zugleich aber auch einem, der sich die alte christliche Überzeugung von einer heilsgeschichtlichen Sendung des Christentums zu eigen gemacht hat. Es ist nicht verwunderlich, daß heute dieser Mann anstößig wirkt, schauen doch weite Gruppen der Christen auf die Bekehrung, die kirchlichen Weihen oder auf die wissenschaftliche Zumutbarkeit von Glaubensaussagen. Aber gerade in dieser Anstößigkeit liegt auch eine außerordentliche Zukunftschance, denn kaum ein anderer Denker der Gegenwart hat wie Rosenstock auf die universale Bedeutung des Christentums verwiesen - ein Ruf zum Erwachen, zum Geistes-gegenwärtig Leben.
2. Als Gewandelter 1918 heimgekehrt und fortan gelebt
Rosenstock sah in dem ersten Weltkrieg das große epochale Ereignis, das eine Änderung der Lebensweise erforderlich mache: nicht länger mehr könne der souveräne Nationalstaat als Leitfigur dienen, sondern eine neue Gestalt erfordere primär Anerkennung - die Weltgesellschaft. Insbesondere erkannte er, daß es 1918 für Deutschland wichtig wurde, sich als Teil der globalen (Wirtschafts-)Gesellschaft zu verstehen. Dieser Einsicht, davon war Rosenstock auch überzeugt, mußte er selbst im persönlichen Leben Rechnung tragen. So kam es dann, daß der noch nicht demobilisierte Soldat im November 1918 drei verlockende Angebote aus Universität, Staat und Kirche (katholische Zeitschrift »Hochland«) ausschlug, in Ruhe die letzten Soldaten nach Hause schickte und schließlich selbst an einen Ort der »Gesellschaft« ging, nämlich zu den Daimler-Benz Werken, um dort, wo zu wenig gesprochen wurde, der Sprache mehr Raum zu verschaffen (Herausgabe einer Werkzeitschrift). Gleichzeitig gründete er mit Freunden den Patmos-Verlag in Würzburg, in dessen Reihe »Bücher vom Kreuzweg« 1920 seine »Hochzeit des Krieges und der Revolution« erschien, das Dokument einer Metanoia durch die »Sprache der Ereignisse«.
Die Fabrik konnte nicht das Wirkungsfeld eines »Lehrers« bleiben. 1921 wurde Rosenstock der 1. Leiter der in Frankfurt/Main gegründeten »Akademie der Arbeit« — einer Institution der Erwachsenenbildung. »Der Arbeiter soll Mitarbeiter im Geist, nicht Student werden.« Das Sprechen unter Erwachsenen, in dem der Widerspruch immer wieder laut wird, hätte auch neue Lehrformen bei den Lehrern erforderlich gemacht, doch dem versagten sich Rosenstocks Lehrerkollegen, so daß er nach einem Jahr die Akademie verließ. Rosenstock erlebte ein »Sabbatjahr« - ohne alle Bezüge. Die Inflation zwang ihn, wie erwähnt, nach Breslau zu gehen. Sein Wirken in der Universität war dann aber — und dies meinte er, sei er der Weltkriegswandlung schuldig - mit weiterhin starkem Engagement in der Erwachsenenbildung verbunden (Hohenrodter Bund, Deutsche Schule für Volksforschung und Erwachsenenbildung). War es Ziel der Erwachsenenbildung, den Arbeiter als Gesprächspartner zu gewinnen (beispielhaft 1922 in der »Werkstattaussiedlung« mit dem Dreher May geschehen), so zielten Rosenstocks praktische Bemühungen - als geistige Forderung schon 1912 bewußt geworden — ab 1926 auf einen freiwilligen Arbeitsdienst, einen »Dienst auf dem Planeten«. Durch den »Arbeits-Dienst« sollte jedem die Chance geboten werden, in Lebensräume einzutreten, wo er die »Gebote der Erde«, die »Liebe«, d.h. die Solidarität aller Menschen, und die »Offenbarung« des WORTES, des GEISTES erfahren konnte. Insbesondere sah er die Gefahr, daß ein Sprechen ohne Dienst »akademisch blutarm« wäre. Die schlesischen Arbeitslager trugen im Widerstand gegen Hitler unerwartete Früchte in dem Kreisauer Kreis um Helmuth James von Moltke.
3. Als Teilnehmer am Mahle des HERRN zum Exodus bereit
1960 sagte Rosenstock in Heidelberg: Das Abendmahl »ist ein Haushaltsvorgang, in dem sich die Menschen mit Kräften ausrüsten lassen von einer bekannten Vergangenheit, einer geliebten und vertrauten Vergangenheit für eine den Tod bewältigende Zukunft.« In der Bereitschaft, zur rechten Stunde die geliebte Heimat zu verlassen, kann also ein Kriterium für die wirksame Teilnahme am Mahle des HERRN gesehen werden. Rosenstock sprach aus einer bewährten Einsicht heraus. Er hatte 1919 ein »Lügenkaisertum« vorausgesagt und dann nach Kräften versucht, sein Kommen zu verhindern - insbesondere hatte er auch scharf den ab Mitte der zwanziger Jahre immer stärker ins Kraut schießenden Führerkult bekämpft. Die sogenannte »Machtergreifung« 1933 empfand er als »Besiegter« und als Freigesprochener. Sein Antrag auf vorübergehende Schließung der juristischen Fakultät in Breslau fand nicht die notwendige Unterstützung. Er entschloß sich zur Auswanderung nach Amerika.
4. Als Argonaut den Weg ins 3. Jahrtausend gewiesen
Der »unreine Denker« Rosenstock war ein Verfechter der »reinen Lehre«. Diese »Lehre« kann als Gespräch zwischen Lehrer und Schüler gedeutet werden, das zwar im üblichen Sinne »zweckfrei« ist, doch eine gemeinsame Zeit-Bestimmung ermöglichen soll, die der Lehrer einbringen muß (so war es Rosenstocks Bemühen während der Weimarer Republik, der Weltkriegs-Datierung Anerkennung zu verschaffen). Also den Lehrer qualifiziert ein bestimmtes historisches Ereignis, dem im »Gang der Ereignisse« Vorrang gegenüber den Ereignissen zukommt, von denen sich die Schüler haben bestimmen lassen; soweit diese überhaupt schon historisch festgelegt sind. Ganz uninstitutionell kann gesagt werden: »reine Lehre« kann immer dann aktualisiert werden, wenn sich Menschen begegnen, die keine Zeitgenossen sind, weil sie durch verschiedene Ereignisse bestimmt sind, doch wo die Chance besteht, Zeitgenossen zu werden, d.h. zu einer gemeinsamen Bestimmung zu finden. Das setzt beim Lehrer die gegenwarts-relevantere Bestimmung voraus und beim Schüler die Hörbereitschaft. Dazu kommt noch etwas Drittes: die Anerkennung der Sprach-Bindung durch alle Teilnehmer — Namen und Worte dürfen nicht als »Werkzeuge« mißverstanden werden und man selbst darf sich nicht als »Techniker« verstehen. Es gilt die Einsicht zu beherzigen: nur selbstvergessen können wir Menschen unsere Bestimmung verwirklichen, selbstbewußt verfehlen wir sie.
Gerade eine weitgehend technisierte Welt verlangt besondere Anstrengungen, das Menschliche in unseren Beziehungen zu einander zu bewahren. Rosenstock macht darauf aufmerksam, daß dazu der Dank gegenüber unseren Vorfahren völlig unerläßlich ist. Wir müssen uns um unserer und unserer Kinder Zukunft willen auf alte Lebensformen einlassen und Elemente aus ihnen auf ihre Tragfähigkeit für unser Leben prüfen. Diese Fahrt in die Vergangenheit mit offenen Sinnen für die Zukunft nennt Rosenstock »Argonautenfahrt« (die Argonauten waren die ersten Weltumsegler, von denen die griechische Sage berichtet). Sie ist keineswegs ein archäologisches Unterfangen, geht es doch bei ihr um ein verzeitlichtes »goldenes Vlies«: »priesterliches Wissen der Zukunft« innerhalb eines »vernünftigen Gottesdienstes«. Dieser »Gottesdienst« ist eine große Zumutung für die Geistigen, eine sehr handgreifliche. Rosenstock mutet nämlich den »Feder«-Menschen zu, zeitweilig den »Spaten« in die Hand zu nehmen. Doch unsere Geistigen scheuen jegliche wirksame »Spaten«-Erfahrung. Das hat unheilvolle Folgen für unser geistiges Leben, das immer wieder von reiner Verbalradikalität heimgesucht wird. So wird kein öffentlicher Resonanz-Boden für eine neue Form des »vernünftigen« Opferns geschaffen, das für die Schaffung eines 3. Jahrtausends notwendig ist.
Rudolf Hermeier
aus: Eugen Rosenstock-Huessy: Friedensbedingungen einer Weltwirtschaft, Zur Ökonomie der Zeit, Haag + Herchen, Frankfurt am Main, 1988, p.331-335