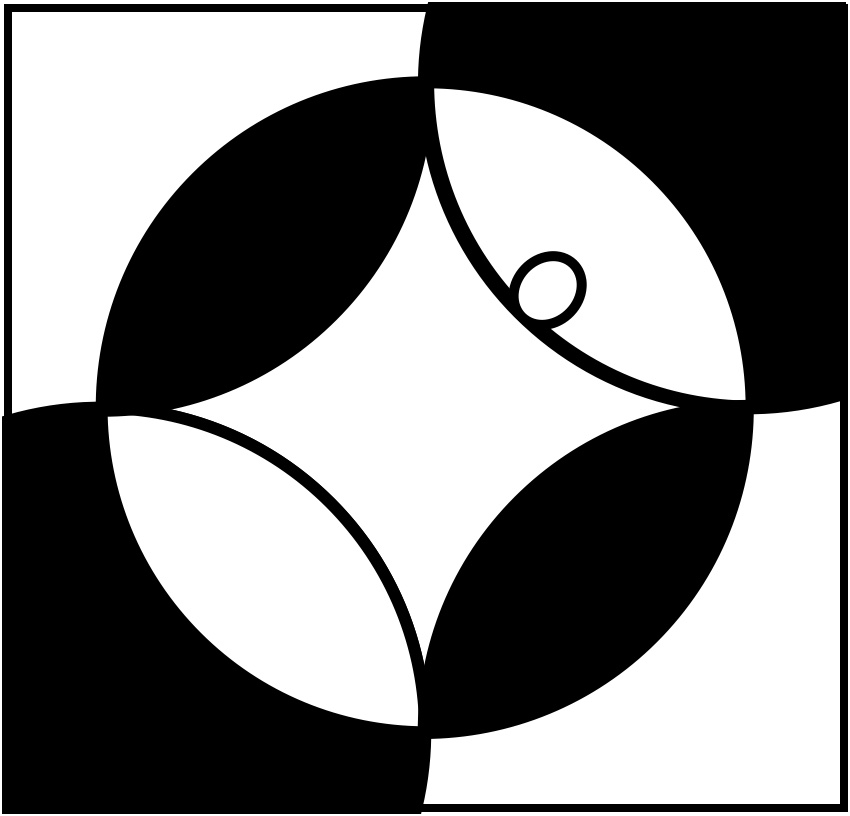Otto Kroesen: Matthäus und Lukas im Zwiegespräch
Matthäus und Lukas im Zwiegespräch
Einleitung
Wo kommt Jesus Christus her? Nur Lukas und Matthäus haben eine Geburtserzählung.
 Markus überspringt das. Markus beginnt mit Johannes dem Täufer und der Taufe Jesu, und dann, als Jesus aus dem Wasser steigt, wird er sofort von Gott adoptiert, so wie nach römischem Brauch die Kaiser ihren gewünschten Nachfolger als Sohn adoptierten. Der Geist kommt wie eine Taube auf ihn herab, und er hört eine Stimme: „Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden“ 1. So wie die Genealogie der Pharaonen und der römischen Kaiser angesichts dieser Adoptionspraxis nicht von großer Bedeutung ist, so ist bei Markus auch keine Geburtsgeschichte vonnöten, um Jesus als Gottes Sohn „auf den Schild zu heben“. Dies ist ein ganz anderer Ansatz.
Markus überspringt das. Markus beginnt mit Johannes dem Täufer und der Taufe Jesu, und dann, als Jesus aus dem Wasser steigt, wird er sofort von Gott adoptiert, so wie nach römischem Brauch die Kaiser ihren gewünschten Nachfolger als Sohn adoptierten. Der Geist kommt wie eine Taube auf ihn herab, und er hört eine Stimme: „Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden“ 1. So wie die Genealogie der Pharaonen und der römischen Kaiser angesichts dieser Adoptionspraxis nicht von großer Bedeutung ist, so ist bei Markus auch keine Geburtsgeschichte vonnöten, um Jesus als Gottes Sohn „auf den Schild zu heben“. Dies ist ein ganz anderer Ansatz.
Matthäus und Lukas können es so nicht angehen. Sie müssen beide begründen, warum mit Jesus Christus ein ganz neuer Zeitabschnitt in der Geschichte anbricht. Die Genealogie ist also keine gewöhnliche Genealogie, sondern begründet, warum diese neue Zeit anbricht. Aber Matthäus und Lukas brauchten diese Geburtserzählungen jeweils auf andere Weise. Wahrscheinlich waren sie mit der Arbeit des jeweils anderen nicht sehr zufrieden. Sie haben gegensätzliche Schwerpunkte und betonen daher andere Aspekte.
Kenner von Rosenstock-Huessy wissen, dass für ihn die Evangelien, die Geburt und das Ereignis der Ankunft Jesu Christi eine zentrale Rolle in seiner Interpretation der gesamten Gesellschaftsgeschichte von den Stämmen bis zur Gegenwart spielen. Hier folge ich seinem Ansatz. Dabei verspreche ich dem Leser, dass ich später nochmals darauf zurückkommen werde. Man kann sich als Theologe (und ein bisschen bin ich das immer noch), Rosenstock-Huessys Interpretation nicht anschließen, ohne ihre Glaubwürdigkeit im Lichte gängiger biblischer Interpretationen zu prüfen.
Matthäus ist der Zöllner Levi, der nach seinem eigenen Evangelium von Jesus zum Jünger berufen wurde (Matthäus 9, 9-13). Er ist also einer der Zwölf. Nach der Überlieferung schrieb er sein Evangelium auf Aramäisch, vielleicht sogar auf Hebräisch. Später wurde es dann übersetzt. Nach Rosenstock-Huessy schrieb er das Evangelium während der Verfolgung der christlichen Gemeinden, nach der Steinigung des Stephanus. Viele flohen daraufhin nach Syrien, Damaskus, Galiläa und jene Regionen. Paulus verfolgte die Kirche bis nach Damaskus. Matthäus gehört also auch zu der ersten Periode, in der die Apostel über die Auslegung des Alten Testaments im Licht der Verkündigung, Kreuzigung und Auferstehung Jesu Christi nachdachten. Seine Haltung ist laut Rosenstock-Huessy eine des Protests: Der Gerechte wird von den jüdischen Führern abgelehnt. Das macht sie zu Heuchlern. Sie töteten ausgerechnet den besonders Gerechten im Namen des Gesetzes. Außerdem weiß Matthäus als Steuereintreiber aus eigener Erfahrung, was es heißt, ausgeschlossen zu sein.
Lukas schloss sich als griechischer Arzt der Gemeinde in Jerusalem an, reiste später mit Paulus und Barnabas nach Antiochia und begleitete Paulus von dort aus immer wieder auf seinen Missionsreisen, bis hin zu seinem Aufenthalt in Rom. Lukas denkt in Generationen. Er schreibt sein Evangelium an Theophilus, also die Generation nach ihm. Und er schreibt auch die Apostelgeschichte, die erste Generation von Nachfolgern und über Paulus, der eigentlich schon zur zweiten Generation gehört. In seiner Auslegung hat er die griechisch sprechenden, neu gewonnenen Gläubigen als Leser im Blick, aber auch die Juden, denn die jüdische Inspiration, die sich nun von der Gesetzlichkeit Jerusalems befreit hat, gründet im ganzen Römischen Reich eine neue (christliche) Gemeinschaft, die eine Alternative sowohl zur jüdischen Revolte als auch zum Römischen Reich darstellt. Soviel zu diesem Hintergrund.
Ich habe oft festgestellt, dass selbst nachdenkende Kirchenmitglieder, die die biblischen Geschichten kennen, keine Ahnung von der Aufteilung der Themen der Geburtserzählungen zwischen Lukas und Matthäus haben. Ob die Hirten zu Lukas oder zu Matthäus gehören, wissen die meisten nicht und es ist ihnen auch egal. Deshalb hier auch die folgende Übersicht:
| Matthäus | Lukas |
|---|---|
|
|
Wir stellen uns vor, dass Matthäus und Lukas über ihre unterschiedliche Herangehensweise miteinander korrespondiert haben könnten. In dieser Vorstellung könnten sie auf die folgende Weise korrespondiert haben. Sie schrieben sich gegenseitig Briefe. Stellen Sie sich vor, diese wären in meinen Besitz gelangt, und ich zitiere hier kurz die wichtigsten Passagen.
Korrespondenz
Lukas: In den Gemeinden, die Paulus und ich in Kleinasien, Griechenland und an anderen Orten gegründet haben, auch in der Gemeinde in Rom, können die Leute mit deinem Evangelium nichts anfangen. Ich sollte natürlich nicht übertreiben. Wir kommen damit zurecht, denn es ist das einzige, was wir haben. Sonntag für Sonntag lesen wir daraus, wie Du es vorgesehen hast, parallel zu den Lesungen nach dem synagogalen Schema. Von der Synagoge kommend, erhalten die Gemeindemitglieder dann einen christlichen Kommentar zum alttestamentlichen Text. Das hast Du Dir übrigens schlau ausgedacht! Man liest Deine Geschlechtsregister im ersten Kapitel Deines Evangeliums parallel zu den Geschichten von Abraham und Sara aus der Genesis, die keine Kinder bekommen konnten. Du kannst also mit dem Geschlechtsregister von Abraham bis Jesus Christus beginnen. Die Geschichte von den Weisen liest Du parallel zu der Geschichte von Jakob und Esau, die sich wiedersehen, als Jakob von Laban zurückkehrt. Und so wie Jakob nach der Begegnung mit Esau fliehen musste, müssen auch die Weisen auf dem Rückweg König Herodes ausweichen. Sehr schön, weil es so auf das synagogale Schema abgestimmt ist! Und doch gibt es in diesen Geschichten alles Mögliche, das wir in Rom nicht bringen können. Aber lass mich damit anfangen: Warum hast Du das überhaupt getan - die Geburtsgeschichten zu schreiben? Was weisst Du über die Geschehnisse in der Kindheit von Jesus? Wurdest Du nicht erst berufen, als Du ein Zöllner warst, der von Jesus zum Jünger gemacht wurde? Warum also?
Matthäus: Warum soll ich nichts darüber wissen können? Versuch doch mal, wie ein Rabbi zu denken. Dann wirst Du mich vielleicht auch verstehen. Die Rabbiner wissen zum Beispiel, von welchem Baum Eva im Paradies gegessen hat. Das steht nicht in der Schrift. Trotzdem wissen sie es. Es war ein Feigenbaum. Ein Feigenbaum hat viele Blätter, und auch Adam und Eva bedeckten sich aus Scham mit Feigenblättern, als Gott sie rief. Ein Feigenbaum kann trügerisch sein. Er kann viele Blätter haben, und dann denkt man, dass er Früchte tragen wird. Und schaut man dann unter die Blätter, dann ist nichts da. Deshalb. Verstehst Du das? Nun, genauso geschah es mit dem Kind Jesus, wie ich es Dir gesagt habe. Israel befindet sich in einer Sackgasse. Das ist schon einmal geschehen. Ich zeige das auch in diesen Perioden von dreimal vierzehn Namen. Jedes Mal muss Gott einen neuen Anfang machen. Jedes Mal ist eine neue Inspiration nötig. Der Sohn Davids wird in Bethlehem geboren. Der heidnische König Herodes, der von den Edomitern abstammt, will ihn töten. Du weisst, dass unter uns Rabbinern (ich weiß nicht, ob ich inzwischen selbst einer bin) Edom mit dem Römischen Reich gleichgesetzt wird. Joseph und Maria müssen nach Ägypten fliehen, weil Joseph das im Traum gesehen hat - so war es auch bei einem früheren Joseph. Er träumte und sah voraus, dass seine Brüder sich vor seinem Stern beugen mussten 2. Genauso müssen sich die Könige von überall her vor dem Christuskind im Stall verbeugen. Siehst Du? All das ist in der Heiligen Schrift vorhergesagt. Wie kann ich davon nichts wissen? Das ist der wahre Ursprung von Jesus.
Lukas: Das ist schön, aber Du drückst es zu stark aus. Du sagst auch, dass bei Herodes ganz Jerusalem erschrocken war, als die Weisen kamen, um den neuen König zu suchen. Du stellst also das Königreich Israel unter Herodes als eine ägyptische Diktatur dar, die vom Volk in Jerusalem unterstützt wird 3. Joseph musste mit seiner Familie nach Ägypten fliehen, weil es dort besser war. Nun, so kann ich nicht weitermachen. Verstehst Du nicht, warum? Das führt nur zu Streit mit den Juden. Du suchst zu viel den Konflikt. Und die Christen aus den Heiden haben von dieser Kritik an Israel überhaupt nichts, weil sie in einen Konflikt hineingezogen werden, der nicht der ihre ist.
Matthäus: Warum ein Konflikt, an dem sie keinen Anteil haben? Herodes und die Weisen und der Stern - das ist doch auch alles ägyptische Mythologie, die von den römischen Kaisern übernommen wurde, wie ihr wisst. Auch sie gehorchen dem Rhythmus der Sterne, dem landwirtschaftlichen Kalender, und die Magier können aufgrund der Stellung der Sterne Vorhersagen machen, so wie sie in Ägypten den Anstieg des Nils vorhersagen konnten. Dies verleiht auch der hierarchischen Herrschaft der Römer einen religiösen Anstrich. Und da Herodes aus Edom stammte, was nach Ansicht von uns Rabbinern für das Römische Reich steht, muss all dies doch auch die Christen aus den Nichtjudenländern ansprechen?
Lukas: In der Tat, das stimmt. Darüber muss ich nachdenken. Denn natürlich kennen sie Herodes nicht. Vielleicht sollte ich etwas mit dem Kaiser machen. - Du merkst, dass ich darüber nachdenke, dein Werk selbst wieder aufzunehmen und ein Evangelium zu schreiben. Denn obwohl wir dein Evangelium in unseren Gottesdiensten verwenden, muss ich zu viel erklären und alles ein bisschen anders darstellen, weil der Kontext ein anderer ist. Deshalb sollte ich vielleicht etwas über den römischen Kaiser und die Volkszählung unter Quirinius sagen. Das war zwar erst zehn Jahre später, aber Du verstehst, wegen der Symbolik. Der Kaiser spricht und ihr müsst einfach gehen.
Matthäus: Aber Herodes ist ein wesentlicher Teil der Geschichte. Er steht für den Kompromiss der jüdischen Führer mit der römischen Macht. Das führt zum Kindermord an den Kindern in Bethlehem. Und in der Tat erinnert das an den Kindermord in Ägypten, an den Befehl des Pharaos, alle neugeborenen Kinder in den Nil zu werfen, als das Volk Israel in Ägypten war. So sieht es heute in Israel aus, dank dieses Kompromisses mit der römischen Macht. Deshalb war ich froh, dass Joseph der Name des Vaters von Jesus ist, das konnte ich gut gebrauchen. Joseph träumt in der alttestamentlichen Geschichte alles Mögliche, auch unser Joseph bekommt Träume. Die Weisen, sie waren die Vorhersager von Ereignissen aus der Position der Sterne. Wieder eine Parallele zu Joseph: Hier kommt der echte Stern. Dieser Stern geht vor den Weisen her, so wie die Wolkensäule vor dem Volk Israel auf seiner Reise durch die Wüste herging.
Lukas: So verstehe ich es besser, danke. Aber nimm die Tatsache, dass ganz Jerusalem zusammen mit Herodes erschrocken ist, als die Weisen kommen, um zu fragen, wo der König geboren wurde - damit verärgerst Du wiederum die Juden, nicht wahr? Weisst Du, wie viel Mühe wir uns geben mussten, um den Aposteln in Jerusalem klarzumachen, dass die Heiden nicht beschnitten werden sollen und auch nicht Juden werden sollen, um überhaupt teilnehmen zu können? Die Juden aus Jerusalem sind immer noch hinter uns her, weil sie meinen, dass dies eigentlich nötig wäre. Du hast es in deinem Evangelium viel zu weit getrieben, indem Du die jüdischen Führer mit ägyptischen Pharaonen gleichgesetzt hast!
Matthäus: Aber so war es auch. Doch wenn Du selbst etwas schreiben willst, dann schreib doch zuerst die Geschichte der Verfolgung auf, die nach der Steinigung des Stephanus stattfand. Die Situation war so bedrohlich, dass nur die Apostel es wagten, in Jerusalem zurückzubleiben 4. Sie hatten das Gefühl, dass sie weiterhin im Tempel auftreten mussten, um Besucher für die neue Sache zu gewinnen. Dein eigener Freund Paulus, damals Saulus, spielte eine wichtige Rolle bei der Verfolgung. Ich halte es für ein großes Risiko, dass spätere Historiker die Ernsthaftigkeit dieser Verfolgungen anzweifeln werden. Du wirst nicht viel davon aufgezeichnet finden. Also, schreib darüber! Gewöhnliche Kirchenmitglieder mussten nach Galiläa und Syrien fliehen. Christus ist uns dorthin vorausgegangen, sagte ich in meinem Evangelium, um uns zu ermutigen! Offensichtlich, denn wo der Druck ist, da ist er auch.
Lukas: Damals war es so, gut, dass Du mich daran erinnerst. Aber später haben Paulus und ich und andere auch viele Heiden mitgebracht, und die sollen das auch verstehen können, und man soll sie nicht mit allerlei Widersprüchen belästigen, die für sie nicht mehr relevant sind. Außerdem müssen wir mit den Juden zurechtkommen. Das hat nicht nur strategische Gründe, sondern knüpft an deinen Stammbaum und die Rede des Stephanus an: Es geht darum, eine Epoche in eine andere zu übertragen. Die Inspiration Israels muss auf die Christen aus dem Heidentum übertragen werden. Manchmal ist das so etwas wie eine Spaltung ohne Übertragung. Ich werde in meiner Version der Geschichte an die Patriarchen anknüpfen, denke ich. Das ist die Frühzeit Israels, oft noch ohne die Institution der Beschneidung und mit einem hebräischen Volk aus Sklaven und anderen Randgruppen. Diese Patriarchen waren Hirten, oder? Heute sind die Hirten nicht so beliebt. Sie sind arm, stehlen und lassen ihre Schafe auf dem Land anderer Leute laufen. Immer wieder findet Gott in den Verlorenen und Ausgestoßenen einen Anknüpfungspunkt. Sie sind ein Heer von Engeln, die die Ankunft des neuen Königs begrüßen. Wunderschön, findest Du nicht?!
Matthäus: Tut mir leid, zu dieser Art von Humor bin ich nicht fähig. Erinnere dich: Der Gerechte wurde hinausgeworfen und zum Sündenbock gemacht. Der Sohn Davids wurde von den Kindern Israels verworfen. Er hat dem Gesetz Substanz verliehen, und ohne ihn wäre das Gesetz nur eine förmliche Sache, Formalismus. Ich muss also das Gesetz gegen diese Machthaber in Stellung bringen, das wahre Gesetz, das sich im Glauben an Christus zeigt. Deshalb habe ich mich in meinem Evangelium rabbinisch verhalten: Poesie, Rhythmus, Sprichwörter, dreifache Sequenzen, um einen Punkt zu machen, alles von den Rabbinern abgeschaut. Hier, in Jesus, möchte ich sagen, findet die ganze rabbinische Tradition ihre Erfüllung und Inkarnation.
Lukas: Da haben wir es wieder, das Gesetz. Du machst das viel zu streng! Nicht ein Jota willst Du das Gesetz abschaffen 5. Jesus ist nur für die Juden da, die verlorenen Kinder Israels, sagst Du. Du bist zu sehr in deinem Streit festgefahren. Du willst mit dem Kind auch das Badewasser retten. Dabei ertränkst Du aber das Kind im Badewasser.
Matthäus: Paulus hat nicht ganz Unrecht. Er setzt den Geist des Gesetzes gegen den Formalismus des Gesetzes ein. Der Formalismus des Gesetzes macht tot und der Geist macht lebendig. Aber schüttet er damit nicht wiederum das Kind mit dem Bade aus? Ich muss erst noch sehen, was für ein undiszipliniertes Durcheinander das mit den Christen aus den Heiden wird. Wie dem auch sei, hier in Palästina ist das einfach nicht aktuell. Israel beginnt mit Abraham. Ich habe mich bemüht, verschiedene Perioden im genealogischen Register aufzuzeigen, genau wie Stephanus in seiner berühmten Rede: eine Phase vor dem Königtum, eine Phase mit den Königen und eine dritte Phase nach dem Exil. Jedes Mal leben wir in einer neuen Dispensation, in einer neuen Ära. In ähnlicher Weise müssen wir nach Jesus das Gesetz mit den Augen des verworfenen Gerechten lesen. Auch das ist eine neue Ära. So sehe ich das.
Lukas: Diese dreimal vierzehn Generationen, das ist ein guter Anfang. Das zeigt, dass eine Genealogie nicht statisch ist. Jedes Mal im Laufe der Zeit müssen sich die Dinge ändern, das ist gut. Übrigens, weisst Du, dass Du einen vergessen hast und dass Deine letzte Reihe, die nach dem Exil, nur dreizehn Namen hat? Eine Kleinigkeit, wohlgemerkt. Aber im Ernst: Du gehst nicht weit genug zurück. Auf diese Weise bist Du nicht umfassend genug. Wenn ich etwas schreibe, dann gehe ich in meiner Version bis zu Adam zurück. Ich habe etwas in meinem Kopf mit sechs Reihen von sieben Geschlechtern. Dann beginnt die nächste Siebenreihe mit Jesus. Und damit schließt sich der Kreis: von Adam zum neuen Adam. Das ist umfassender und lässt Platz für eine neue und letzte Siebenreihe, die mit Jesus Christus beginnt.
Matthäus: Zu welchem Preis macht man das so? Wenn man das Gesetz und insbesondere die Beschneidung weglässt, verliert man die Kontinuität. Wenn wir das Gesetz mit dem messianischen Blick des gekreuzigten Gerechten lesen, ist das ein gewaltiger Bruch, oder? Erinnern wir uns daran, dass die versprengten Anhänger Jesu Christi nach dem Mord an Stephanus eine harte Zeit hatten. Inzwischen haben sich diese Verfolgungen etwas beruhigt und es gibt eine lebendige Gemeinde in Jerusalem. Schließlich blieben die Apostel selbst an allen großen Festen im Tempel, um dort den Namen Jesu zu verkünden. Aber wir müssen vorsichtig sein. Wir können es uns nicht leisten, zu nachsichtig mit dem Gesetz zu sein.
Lukas: Ich muss sowohl Kontinuität als auch Wandel zeigen. Deshalb beginne ich mit dem Priester Zacharias im Tempel. Er erhält die Verheißung eines neuen Anfangs, eines Sohnes, der Johannes heißen soll. Das ist der Hintergrund für Johannes den Täufer. Zacharias und Elisabeth sind kinderlos, aber wie Abraham und Sarah erhalten sie die Verheißung eines Kindes. Zacharias schweigt und man kann das Unglauben nennen, aber im Buch Daniel schweigt Daniel auch, weil er überwältigt ist 6. Zacharias steht also für das gedemütigte Israel. Maria hat Miriam, die Schwester von Mose, als Vorbild, und Elisabeth hat die Frau des Priesters Aaron als Vorbild. Das alles schwingt mit. Das ist eine gute rabbinische Methode, nicht wahr? Das habe ich mir also gut von dir abgeschaut! Hannahs Hymne aus dem Buch Samuel ist das Vorbild der Hymne Marias. Es wird ein neuer Anfang gemacht. Hier spricht das wahre Israel. Das neue Israel kann auf uralte Beispiele eines solchen Neuanfangs zurückgreifen. Und zum Abschluss stelle ich zwei alte Menschen vor, Simeon und die Prophetin Hanna. Sie freuen sich über die Erfüllung der alten Verheißungen an Israel. Sie bestätigen die Kontinuität.
Matthäus: Es ist gut, dass Du für die Kontinuität eintrittst und sie zeigt. Aber Du sollest dann auch zeigen, dass es Dir mit dem Gesetz ernst ist! Auch das ist nicht nur in der Situation, in der wir uns befinden, notwendig, sondern es ist ein Wert an sich. Auch die Heiden sollen sich darauf einlassen. Sonst verlieren wir den Anschluss.
Lukas: Darüber denke ich wirklich anders. Aber ich will es nicht auf die Spitze treiben. Ich will ja die Apostelgeschichte neben dem Evangelium schreiben. Auch darin will ich Kontinuität und Wandel zeigen. Die Apostel, darunter auch Jakobus, der Bruder Jesu, waren sich einig, dass für Christen aus den Heiden das Gesetz nicht gilt, insbesondere die Beschneidung 7. Dieser Raum ist also dankenswerterweise vorhanden. Aber in meinem Buch Apostelgeschichte will ich das orthodoxen Juden, wie Du einer bist, nicht wieder unter die Nase reiben. Ich werde es positiver gestalten und mehr Gebrauch von der Metapher des Todes und der Auferstehung machen 8. Der Punkt, an dem sich die Geister scheiden, ist also nicht unbedingt das Gesetz, sondern der Glaube an die Auferstehung. Das ist für mich die entscheidende Metapher.
Matthäus: Ich möchte nicht darüber streiten. Ich bin mehr auf der Linie von Jakobus. Er stimmt zwar zu, dass Heiden, die zum Glauben kommen, nicht beschnitten werden müssen, aber vor allem, weil er nicht streiten will. Mit Nachdruck fügte er hinzu, dass es glücklicherweise noch überall Synagogen gibt, in denen ausreichend über Mose gepredigt wird 9. Das gibt einem Raum, und vielleicht ist es notwendig, aber ich halte es für ein abenteuerliches Unterfangen. Man kann den Geist wehen lassen, aber wenn die Menschen die Regeln und die Disziplin des Gesetzes nicht mehr befolgen, wo soll das enden?
Lukas: Es ist ein Abenteuer. Aber wir müssen es auf uns nehmen. Die Heiden haben die Macht Christi, des gekreuzigten Gerechten, wie Du es ausdrückst, erkannt und bilden eine neue Gemeinschaft, die sich wie ein Feuer über das ganze Römische Reich ausbreitet. Die Menschen erkennen, dass das Römische Reich moralisch leer ist. In der ecclesia finden sie Mitmenschen, Verbündete, die über die Grenzen der Familienbande hinweg füreinander eintreten. Nicht umsonst nennen wir uns in der ecclesia Brüder und Schwestern. Sie ist eine alternative Familie, die alles miteinander teilt und sich um die vielen Witwen und Armen kümmert. Das führt zu positiven, aber auch zu vielen negativen Reaktionen. Es erfordert unglaublichen Mut, sich selbst und die eigenen Interessen auf diese Weise zu überwinden. Paulus sagt es auch überall mit Nachdruck: Eine enorme Bedrängnis steht uns noch bevor und wir müssen darin ausharren. Denn diese neue Gemeinschaft heißt nicht umsonst ecclesia: öffentliche Versammlung. Überall ist die öffentliche Versammlung von den Römern abgeschafft worden, in allen Städten und Dörfern. Die haben nichts mehr zu sagen. Im Grunde genommen sagt das Volk nun: Hier ist das Volk! Langfristig macht das der römischen Macht ein Ende, darauf kann man warten. Aber weil das schon schwer genug ist, sollte man nicht etwas verlangen, was nicht wirklich notwendig ist. Und gleichzeitig ist es ganz wichtig, dass wir in dieser neuen Gemeinschaft auch die Juden mitnehmen, die es mit ihrem Glauben ernst meinen. Denn euer Herodes ist jetzt in Rom. Du siehst schon, dass die begeisterten Konvertiten verfolgt werden. Ich muss ihnen helfen, standhaft zu bleiben. Die große Krise, von der Paulus immer wieder spricht, rückt näher.
Matthäus: Wir sehen beide, dass wir als neue Gemeinschaft von Christen enormen Spannungen ausgesetzt sind. Wie können wir die Einheit unter uns bewahren? Die Situation Israels in Jerusalem erfordert eine andere Vorsicht als die, die Du brauchst. Wir müssen als Gemeinschaft in Palästina mit dem formalistischen Legalismus der jüdischen Führer fertig werden, die sich mit der römischen Macht arrangiert haben. Du und Paulus und andere haben eine Bewegung in Gang gesetzt, die die römische Macht schließlich von innen heraus untergraben kann. Wie können wir das zusammenbringen?
Lukas: Auch Paulus spricht in seinen Briefen oft von einer großen Krise, die bevorsteht. Und sie rückt näher. Wenn man nüchtern ist, kann man vorhersehen, dass die radikalen Zeloten und ihre Anhänger den Kompromiss der jüdischen Führer mit der römischen Macht in Stücke schlagen werden. Man kann auch vorhersehen, dass die Selbstbereicherung des Römischen Reiches und die privilegierte Stellung Roms das Reich in eine Krise stürzen werden. Auch Du hast diese Krise und diesen Konflikt mit Rom in deinem Evangelium vorausgesehen. Du selbst hast den Untergang des Tempels vorausgesagt. Aber Du nimmst immer noch an, dass es, wie zur Zeit der Makkabäer, um die Aufstellung des Kaiserbildes im Tempel gehen wird 10. Auch damit blickst Du auf eine frühere Krise zurück. Es wird jetzt wirklich nicht mehr so sein wie damals. Wenn ich dieses Kapitel von Dir in meiner Evangeliumsversion übernehme, werde ich auch daran etwas ändern. Ich werde sagen, wenn die Leute sehen, dass Jerusalem von Armeetruppen umzingelt ist, dann können sie sich ausrechnen, dass das das Ende der Stadt sein wird 11. Das scheint mir aktueller zu sein. Wenn das passiert, wird es auch die Christen in Rom treffen. Sie werden, was auch immer die Juden in Palästina tun werden, unter schwerer Verfolgung leiden. Wo wird das hinführen? Ich muss es also tun. Ich muss meine Version darlegen und sie so schnell wie möglich erscheinen lassen.
Matthäus: Ich grüße dich aus Syrien! Zum Glück sind wir weit weg von Jerusalem. Ich bin sicher, dass sich die christlichen Gemeinden, sollte es dazu kommen, aus Jerusalem zurückziehen werden. Wir beteiligen uns nicht am Kampf gegen Rom. Es sind Dunkle Zeiten. Haltet auf Deine Weise durch.
Verantwortung
Schon seit längerer Zeit beschäftige ich mich mit den Zusammenhängen der vier Evangelien. Der Grund dafür ist natürlich die wichtige Stellung, die die Evangelien im Werk von Rosenstock-Huessy 12 einnehmen. Für ihn ist Christus der Wendepunkt in der Zeit, in der Geschichte. Dieses Ereignis muß seine Spiegelung auch in den Evangelien gefunden haben. Darüberhinaus übt er massive Kritik an der Bibelwissenschaft seiner Zeit, weil sie nicht anerkennt, dass die Evangelien diese Wende in der Geschichte beschreiben. Übrigens trägt unsere Zeit immer noch diese überholte Bibelwissenschaft mit sich herum.
Ein Teil meiner Motivation, mich mit diesem Thema zu befassen, besteht auch darin, dass ich als Pfarrer oft Schwierigkeiten hatte, gut aus den Evangelien zu predigen. Ich hatte Angst vor billiger Gnade, wie Bonhoeffer es nennt. Vor allem zu Beginn meiner Laufbahn fiel es mir leichter, mich mit der alttestamentlichen Kritik an ungerechten Verhältnissen und der Sehnsucht nach einer Zukunft in Gerechtigkeit und Frieden zu befassen. Dass die Evangelien und das Neue Testament im Allgemeinen über diese jüdische Spannung zwischen Anfang und Ende hinausgehen, das wusste ich schon damals, aber ich konnte es eigentlich nicht gut artikulieren, weil ich es nicht so artikulieren wollte, dass die Spannung zwischen Anfang und Ende dadurch aufgehoben wurde. Und das würde passieren, sobald Liebe und Gnade gepredigt werden. Ich habe also Nachholbedarf, und das tue ich, indem ich darauf aufmerksam mache, dass Jesus Christus einen Weg zwischen Anfang und Ende, einen Weg vom Anfang zum Ende eröffnet. Eine Kette von gescheiterten Heiligen, die sich ganz hingegeben haben, eine Kette von Epochen, eine Kette von Versuchen, die nicht gelingen, bietet eine Reihe von Zwischenschritten. Die Teilnahme an diesem Weg kann zwar den Stress nehmen (so kleine Schritte, dass man nicht vorankommt), aber sie kann einem auch bewusst machen, dass die Vollendung nicht ohne einen selbst erreicht wird (Hebräer 11). Das ist der christliche Weg.
Die Evangelien sehen diesen christlichen Weg, indem sie jedes Mal ein Stück Antike überwinden und diese doch auch wieder auf den christlichen Weg umschalten, vorschalten, sagt Rosenstock-Huessy. Matthäus überwindet den Tribalismus Israels, sucht aber auch nach einem Stamm, der keine Sündenböcke braucht. Markus überwindet die Hierarchie des Imperiums, ermöglicht aber auch eine Hierarchie, die den Blick für die Unterschicht hat. Lukas überträgt die Inspiration Israels von einer Epoche in die nächste und ermöglicht eine Abfolge von Epochen, die dennoch nicht Stillstand und Wiederholung ist, gerade wenn die Inspiration Israels der tragende Grund dafür ist. Johannes schreibt Poesie, aber es ist keine willkürliche Phantasie, sondern eine Poesie, die in dem am Kreuz auferstandenen Christus ein Gravitationszentrum findet, um das sie kreist. So kann eine ursprünglich heidnische Form auf den christlichen Weg gebracht werden.
Jeder, der sich am Studium der Evangelien beteiligen möchte, zum Beispiel durch eine Antwort auf diesen Beitrag, ist willkommen. Wir können uns austauschen, vielleicht mal eine Rosenstock-Huessy-Tagung dem Thema widmen, wir können uns gegenseitig auf Publikationen aufmerksam machen. Rosenstock-Huessy folgt der kirchlichen Tradition, die davon ausgeht, dass die Evangelien eigentlich alle, mit Ausnahme des Johannesevangeliums, vor dem Jahr siebzig, vor dem Fall Jerusalems, geschrieben wurden. Es gibt nur wenige Exegeten, die ihm in diesem Punkt folgen. Einer, der ihm folgt, ist John A.T. Robinson (der übrigens Rosenstock-Huessy nicht kennt) 13, der über die Datierung der neutestamentlichen Schriften geschrieben hat. Es gibt auch nicht viele Leute, die die Zwei-Quellen-Theorie in Frage stellen, nach der Markus das erste Evangelium wäre und Lukas und Matthäus noch aus einer verlorenen zweiten Quelle geschöpft hätten, einer Quelle, die hauptsächlich Worte Jesu enthält. Markus enthält nur wenige Worte und Gleichnisse. William A. Farmer muss hier natürlich erwähnt werden 14. In unserer Zeit auch Richard Bauckham 15. Auch er vertritt den Standpunkt, und darin stimmt er mit Rosenstock-Huessy überein, dass die Evangelien durch die Annahme von Quellen im Hintergrund, deren Belege fehlen, ihrer Glaubwürdigkeit beraubt werden.
Otto Kroesen
aus dem Mitgliederbrief 2024-12 Dieser Text in niederländischer Sprache
-
Markus 1,11 ↩
-
1 Mose 37,10 ↩
-
Matthäus 2,3 ↩
-
Apostelgeschichte 8:1. ↩
-
Matthäus 5,18 ↩
-
Daniel 10:15 ↩
-
Apostelgeschichte 15 ↩
-
Apostelgeschichte 23:6; 24:21 ↩
-
Apostelgeschichte 15:21 ↩
-
Matthäus 24:15 ↩
-
Lukas 21:20 ↩
-
Die Frucht der Lippen, in Rosenstock-Huessy, E 1963. Die Sprache des Menschengeschlechts, Bd. I en II, Verlag Lambert Schneider, Heidelberg, pp. 796-904. Raymond Huessy hat auch eine Ausgabe mit einer ausführlichen Einführung und mit den verschiedenen Versionen dieses Textes herausgegeben, in The Fruit of Our Lips – The Transformation of God’s Word into the Speech of Mankind, Eugen Rosenstock-Huessy, Wipf & Stock, Eugene, Oregon, 2021. ↩
-
Robinson, John A.T., 2000. Redating the New Testament, Wipf & Stock, Eugene, Oregon, Original SCM Press, 1976. ↩
-
Farmer, William R., 1964. The Synoptic Problem – a critical review of the problem of the literary relationships between Matthew, Mark, and Luke”, McMillan, New York. ↩
-
Bauckham, Richard, 2006 Jesus and the Eyewitnesses – The Gospels as Eyewitness Testimony, Eerdmans, Grand Rapids, Michigan. ↩