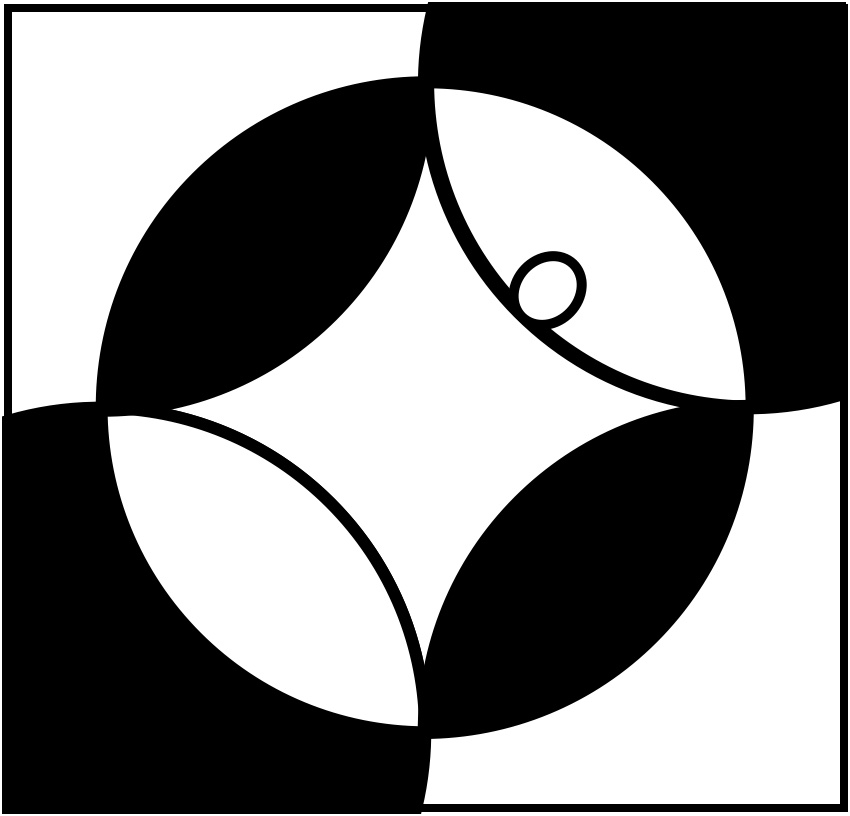Marlouk Alders: Die Tochter
Pfingsten 2025
Ich bekam das Buch „Die Tochter/Das Buch Rut“ 1990, als gefeiert wurde, dass ich als Pflegekind zu einer Familie kam. In den Jahren zuvor hatte sich langsam etwas entwickelt, ich hatte mich immer mehr dazugehörig gefühlt, und das wurde nun bestätigt. Ich hatte mich nie als Tochter meiner leiblichen Eltern gefühlt. Daher war dieser Schritt für mich zu diesem Zeitpunkt von enormer Bedeutung: Eine Anerkennung, dass ich es wert war, (Pflege-)Tochter zu sein und zu einer Familie zu gehören.
In dem Büchlein „Die Tochter“ schrieb mir der Vater dieser Familie, ein Nachricht dass sich mein Leben nun in die Geschichten all jener großen Töchter einschrieb, die unsere Menschheit zur Einheit einer großen Familie aufgerufen hätten, um so eines Tages Frieden zu erreichen. Und dass ich wieder in der Reihe all dieser Frauen stand (…), die inmitten männlichen Begehrens und selbstverständlich Bekommens das Licht bis zum Ende dieses Kampfes weitergetragen hatten.
Was für eine erstaunliche Anerkennung für den einsamen Kampf, den ich als Frau bis zu diesem Zeitpunkt mit Männern geführt hatte, dachte ich damals.
Ich begann mit der Lektüre von Martin Bubers Übersetzung von „Das Buch Ruth“ zu lesen und fand es nicht leicht zu ergründen. Mein Ringen mit diesem ersten Teil des kleinen weißen Buches schien im Nachhinein eine Metapher dafür zu sein, dass meine Pflegetochterschaft genauso schwierig war. Die (erwachsenen) Kinder konnten die Entscheidung ihrer Eltern nicht akzeptieren. Es gab keine Einheit in dieser kleinen Familie, und meine „Tochter-Sein“ wurde aus diesem Grund rückgängig gemacht.
Ich konnte nicht wie Ruth in der Fremde aufgenommen werden!
Das war für mich eine erstaunliche Erfahrung und ließ mich an allem zweifeln: Ich zweifelte an meinem Wert als „Tochter“. Ich zweifelte daran, ob das, was damals in der Nachricht stand, wahr war. Ich zweifelte daran, ob es jemals einen Platz für mich in dieser Welt geben würde. Ich zweifelte an der Menschheit an sich.
Wie sollte ich noch mein flackerndes Licht inmitten des männlichen Begehrens und selbstverständlich Bekommens weiter tragen? Wie sollte dieses Ereignis jemals zur Frieden geraten?
Der zweite Teil von „Die Tochter“ blieb ungelesen. Er wurde wie ein abgeschlossenes Kapitel, das sich gleichzeitig nie ganz schließen ließ. Das änderte sich, als ich 2007 im Rahmen des Projekts „Weitersagen Mensch“ einen Brief erhielt.
Dieser Brief warf in mir alle möglichen Fragen auf: Warum konnte ich das Buch „Die Tochter“ nicht mehr aufschlagen? Habe ich Angst, dass es alles von mir verlangt, was ich nicht geben will oder kann? Habe ich Angst, dass es mir eine neue Form der Bevormundung aufbürdet, während ich das alte Joch kaum abgeschüttelt habe? Oder war es etwas anderes? Was bedeutet es, „Tochter“ zu sein? Ist das etwas, woran ich nicht (mehr) glaube? Habe ich Angst, mich wieder auf etwas einzulassen, an das ich keinen Glauben habe? Habe ich Angst, wieder abgelehnt zu werden? Möchte ich (noch) „Tochter“ sein? Was hat das zu bedeuten? Was ist eigentlich „Tochter Sein“?
Inzwischen hatte ich so viel von Eugen Rosenstock-Huessy gelesen, dass ich wusste, dass er mit seiner „Tochter“ etwas anderes meinte als die Pflegtochter, die ich gerne gewesen wäre. Und obwohl ich das wusste, warum konnte ich mich trotzdem nicht dazu durchringen, „Die Tochter“ zu lesen?
Als ich mir das noch einmal genau ansah, stellte ich fest, dass Rosenstocks „Tochter“ und die Pflegtochter durch die Nachricht des Vaters in meinem Exemplar von „Die Tochter“ miteinander verbunden waren und dass ich diese beiden Dinge voneinander trennen musste. Es war an der Zeit, das Buch „Die Tochter/Das Buch Rut“ wieder aufzuschlagen.
Ich habe „Die Tochter“ unzählige Male gelesen, und jedes Mal, wenn ich es las, erlebte ich es anders und las jedes Mal etwas Neues. Immer wieder hatte ich andere Fragen: Stimmt das, was da steht, oder was ich davon verstehe? War ich damit einverstanden oder nicht? Was bedeutete das? Hatte das etwas für mich zu bedeuten?
Mal kam es mir so vor, als würde Eugen Rosenstock-Huessy alle Männer in den Boden stampfen und die Frauen in den Himmel heben.
Ein anderes Mal kämpfte ich damit: Will mir jetzt ein Mann vorschreiben, wie ich vorzugehen habe? Wird mir hier eine neue Form der Bevormundung aufgezwungen? Und es gab Empörung: Warum müssen die Frauen das in Ordnung bringen, was die Männer vermasselt haben? Warum müssen Frauen das verletzte Herz der Männer retten? Was ist mit den Männern, die das Herz der Frauen verletzt haben?
Und in diesem Zusammenhang: Was und wo liegt die Verantwortung der Männer selbst? Inwieweit ist all dies aus der männlichen (gescheiterten) Perspektive geschrieben? Fehlt hier nicht gerade die Perspektive der Tochter? Wäre es nicht besser, wenn Frauen aus ihrer weiblichen Perspektive heraus überlegen, wie es ihrer Meinung nach weitergehen soll? Ich habe mich bewusst zurückhaltend geäußert und war beim Lesen sehr kritisch! Außerdem verstrickte ich mich in die Frage, auf wen Rosenstock-Huessy eigentlich Bezug nahm, und irgendwann schien es mir, dass er selbst auch nicht immer genau wusste, worauf er hinauswollte. Obwohl ich glaubte zu verstehen, was er meinte, schien mir alles belanglose Wortspielerei.
- Die Mutter (die/eine Frau) und/oder das Mütterliche/Weibliche im Menschen.
- Eine Tochter (die/eine Frau) und/oder die Tochter/das Weibliche im Menschen.
- Der Vater (der/ein Mann) und/oder das Väterliche/Männliche im Menschen.
- Der Sohn (der/ein Mann) und/oder der Sohn/das Männliche im Menschen.
Und ich wunderte mich darüber, dass man zwar mütterlich, weiblich, väterlich, männlich sein kann, aber nicht Töchterlich, geschweige Söhnlich. Der Dikke van Dale brachte keine Antwort. Ich konnte den Kern dessen, was dort stand, noch nicht erfassen. Um wen oder was ging es?
Ähnlich war es mit dem Wort „dienen“ oder ‚Dienstbarkeit‘. Dienstbarkeit wird oft als sorgen für andere (oft einen Mann) in Unterordnung und Gehorsam sein (meist einer Frau) verstanden. Manchmal aus Eigeninteresse, um sich selbst gut zu fühlen oder von anderen gemocht zu werden. The “disease to please”!
Oder Dienstbarkeit in Unterordnung und Gehorsam sein aus Angst, weil man den anderen für mächtiger hält als sich selbst. Mit der traurigen Folge, dass man sich selbst aus Selbstschutz und/oder Lebenserhaltung zurücknimmt und dadurch sich selbst in Körper, Geist und Seele untreu wird. Die Wörter „dienen“ und „Dienstbarkeit“ haben dadurch einen bitteren Beigeschmack bekommen.
Einer der Seitenwege, den ich eingeschlagen habe, war die Suche nach einer positiveren Erklärung dieses Wortes und der Unterscheidung, die getroffen werden muss! Der russische Priester/Philosoph Zelinsky drückt es so aus: „Echte Dienstbarkeit weigert sich, den Menschen auf die Funktion zu reduzieren, die er erfüllt, die Funktion der Arbeitskraft, die Funktion des Konsumenten.“ (Und welche Funktionen es noch zu erfüllen gibt!) „Echte Dienstbarkeit überwindet Gegensätze und Spaltungen, schlägt Brücken und versöhnt Menschen, Gemeinschaften, Mensch und Natur, Mensch und Gott. So ist die Bereitschaft zu dienen und sich dienen zu lassen von wesentlicher Bedeutung für das Überleben der Menschheit.“
Das „Nein“ sagen, wie es Eugen Rosenstock-Huessy mehrfach getan hat, und dabei eine bewusste Entscheidung zu treffen, der Welt so zu dienen, wie er es mit Herz, Seele und Verstand für notwendig erachtete, kann man auch so sehen. Dienen bedeutet, aus seinem Innersten heraus das zu geben, was einen beseelt. Oder wie es in der Einleitung zu „Dienen auf dem Planeten“ heißt: „Was mich be-stim-t.“
Und wenn ich mir dann noch einmal das Wort Dienstbarkeit anschaue, dann stellt sich heraus, dass es nicht so sehr darum geht, was ich geben kann oder will oder um eine neue Form der Bevormundung. Nein, es geht vielmehr um meine Fähigkeit zu unterscheiden, ob es einer lebendigen oder einer toten, einer reinen oder einer verdorbenen, einer echten oder einer unechten Sache dient. Es geht um Inhalt und Beziehung. (Watzlawick) Und um mein Ja und Nein dazu und um den richtigen Zeitpunkt!
Als ich das Buch das nächste Mal las, konnte ich sehen, wie Eugen Rosenstock-Huessy bereits im Jahr 1919 zu verdeutlichen versuchte, wie notwendig es war, Raum und Zeit für diese weibliche Perspektive, die weibliche Art zu reagieren, zu schaffen. Und das vor allem in der Gestalt der Tochter.
Glücklicherweise wurden mir auch Puzzleteile über die Bedeutung von Die Tochter gereicht: Aus einer der Kisten mit dem Nachlass von Ko Vos kam ein Stapel Papier. Alle bezogen sich auf „Die Tochter“. Es schien, als würde sie mir vom Himmel aus doch noch weise Worte schenken und mir Rat und Erklärung geben. In einer Sprache, die ich verstand, machte sie mich weiter mit dem Verständnis von „Die Tochter“ vertraut. Ein Geschenk aus dem Jenseits! Ich zitiere hier, was für mich wichtig war:
Ko Vos im Vorläufer des „De Rozenstok“-Newsletters vom Oktober 1988:
- “Der Mann in uns ist auf den Raum ausgerichtet, in dem wir leben, er will Probleme sachlich, technisch und schnell lösen. Die Frau in uns sieht die Probleme von Hunger, Krieg und Umweltverschmutzung ganz anders. Die Frau in uns weiß um den Lauf der Zeit, sie weiß, dass es Generationen dauert, bis neue Dinge Gestalt annehmen. Sie wagt es, zu erwarten, sie weiß, dass geboren zu werden ein ganz anderer Prozess ist als etwas zu organisieren oder zu erschaffen. Kriege und Kriegsgerüchte sind für die Frau in uns die Geburtswehen einer neuen Zeit. Wehen lassen sich nicht wegwischen, man muss sie durchstehen.”
- „Das Gegenteil der Mutter ist die Tochter, die nicht in die Vergangenheit, sondern in die Zukunft blickt und dort ‚bitte‘ sagt. Auch diese Aufgabe muss gelebt werden, wenn wir das Menschsein nicht verlieren wollen. Das bedeutet, dass wir an die Zukunft glauben müssen. Das Wort “glauben” ist ein schwieriges und vor allem schwer belastetes Wort. Jeder versteht darunter etwas anderes. Aber hier geht es um die einfache und elementare Funktion des Menschseins in Bezug auf die Zukunft. Die Zukunft kennt man nicht, man weiß sie nicht, man kann sie nicht berechnen, man muss an sie glauben, sonst geht man nicht in diese Zukunft hinein.„
- “Die Tochter spricht eine Sprache, die man in keinem Kurs lernen kann. Sie hat nicht gelernt, sie hat keine Diplome. Sie folgt der Stimme ihres Herzens. Weil sie mit Leib und Seele der Zukunft angehört und diese Zukunft erwartet, hat sie gelernt, die vielen Stimmen um sich herum zu unterscheiden. Die Tochter kann „hören“. Ihr Herz sagt ihr, zu welchen Stimmen sie „Ja“ und zu welchen sie „Nein“ sagen soll. Sie sagt ‚Ja‘ zu den Stimmen, die die Schöpfung zu ihrem Ziel führen, sie sagt „Nein“ zu den Stimmen, die den Frieden blockieren. Ihr Herz trifft diese Entscheidung.„
- “Wenn heute der Ruf nach der Frau laut wird, dann hat das alles damit zu tun, dass das Beherrschen (Kontrollieren, Dominieren) Platz machen muss für Dienen und Dienstbarkeit. Es hat auch alles mit dem Verhältnis der Geschlechter zu tun, in dem wir bis über beide Ohren in Schwierigkeiten stecken. Es ist in Wirklichkeit der Ruf nach der Tochter. Die Tochter, die an eine Zukunft glaubt, an eine neue Zeit, und die so gut „hören“ kann, dass sie nur noch dem Mann gehören will, den sie als Braut zum Bräutigam nennen kann. Mit anderen Worten: dem Mann, der noch bereit ist zu Veränderung, zu Umkehr, zum Dienst an der Planet. Die Kinder aus einer solchen Ehe werden wieder Namen tragen, die voller Verheißung sind!”
Brief von Freya von Moltke an Ko Vos, 1. März 1989, über das erschienene „Weisse Buchlein“:
- “Ich kann mir ja immer nicht vorstellen, dass “Die Tochter” verstanden wird. Ich glaube ich weiß ein gut Teil von dem, was drin steht. Drin ist auch Eugens Prophetie. Ich weiß, woraus alles geflossen ist. Aber es steht mehr drin als Eugen selber weiß. Das ist das Grosse. Ich glaube, die Frauen von heute sind gezwungen, Umwege zu machen. Darum fürchte ich, dass sie keine Ohren für Die Tochter haben. Vielleicht die Männer - aber auch nur wenige, denn die Männerwelt aufzubrechen, das wird mehrere 100 Jahre brauchen. Wir sind erst am Anfang.”
- “Als Eugen begann, mir Briefe zu schreiben, hat er zuerst gemeint, ich brauche gar nichts von ihm zu lesen. Dann beginnt er aber mehr und mehr mir Sachen ans Herz zu legen zum lesen. Da ist Die Tochter ganz vorn. Und ich muss sie noch weiter öfters lesen. Das weiß ich.”
Antwort von Ko an Freya, 18. März 1989:
- „Denn schreibst Du noch über die Tochter. Ich denke, dass Du Recht hast, dass dies kaum noch verstanden werden kann. Doch bin ich überzeugt, dass es höchste Zeit ist, dass auch diese Stimme jetzt da ist. Gerade weil man überall spürt die Frau irgendwie an der Reihe, sollen alle Stimmen da sein und kann Eugens Stimme nicht fehlen. Er bringt eine Dimension ein, die, soweit ich weiß, nur ihm gegeben ist zu sehen.“
Als ich „Die Tochter“ danach noch einmal las, konnte ich für mich den Kern des Buches zusammenfassen:
“Aus dem geistigen Bankrott des männlichen Denkens muss letztlich eine neue Antwort geboren werden. Wir müssen aufhören, die Frau als Verführung/Versuchung/Spielball zu sehen, sie nicht fesseln und erniedrigen. Wir müssen aufhören, die Quelle zu verschmutzen. Weil das männliche Denken zu sehr in die Kräfte der menschlichen Natur und in die Schöpfung eingegriffen und dabei den Boden durch Raubbau erschöpft und zerstört hat, ist es mit Blick auf die Zukunft wichtig, dass das ewig Weibliche, das Geduld und Leiden besitzt, in Gestalt der Tochter beseelt an die Arbeit geht und mit Blut, Schweiß und Tränen Lebenssaft auf Gottes Acker bringt, damit der Keim im verdorrten Samen wieder eine Chance bekommt, zu sprießen. Daraus entsteht eine neue Pflanze. Und nur so kann die Steppe wieder blühen und wird die Erde wieder Frucht und Samen tragen. So wird der neue Geist gezeugt und fließt wieder aus der Quelle. Mit einem Blick für Form und Schönheit, Verfall und Reinheit, Tod und Leben, Unechtem und Echtem kann man entdecken, wer „die Tochter“ wirklich ist. Damit wir aus Liebe zueinander eine Ehe eingehen, die uns heilig ist. Umso der Gesellschaft zu dienen. Denn: „Das Leben ist die Liebe und die Liebe ist der Geist des Lebens!“
In dem Moment, als ich als (Pflege-)Tochter in eine Familie aufgenommen werden sollte, habe ich das persönliche Vorwort des Vaters gelesen (dass mein Leben jetzt (1990) Teil der Geschichten all dieser großen Töchter wurde, die unsere Menschheit zur Einheit einer großen Familie aufriefen, um so eines Tages Frieden zu erreichen. Und dass ich wieder in der Reihe all dieser Frauen stand (…), die inmitten männlichen Begehrens und selbstverständlich Bekommens das Licht bis zum Ende dieses Kampfes weitergetragen haben.) Ich habe das als persönlichen Auftrag verstanden, den ich intuitiv wieder abgelehnt habe, als ich als (Pflege-)Tochter abgeschrieben wurde.
Ruth entscheidet sich in Seelenverwandtschaft, mit einem grundlegenden Vertrauen in das, was sie ist und sein darf. Sie schätzt sich selbst wert. Dadurch wird sie gesehen und bekommt den Platz, der ihr zusteht. Sie wird wertgeschätzt! Dort, wo ihr Leben in Trümmern lag, suchte sie nicht nach Möglichkeiten, wie sie alles wieder zusammenkleben könnte, sondern danach, wie aus diesen Ereignissen etwas Neues entstehen könnte, das wieder Hoffnung für die Zukunft gibt.
Als Pflegekind gab es keine echte Zukunft. Das hatte mich in einen Spagat gebracht, aus dem ich nicht so leicht herauskam. Auf diese Weise registriert zu werden, hätte zu einer neuen Form der Bevormundung führen können. Es brauchte Zeit und Raum, um zu sehen, wie aus diesen Ereignissen etwas Neues entstehen konnte, das wieder Hoffnung für die Zukunft gab.
Genau wie Ruth konnte ich mich dabei von der Glaubenskraft der Töchter leiten lassen, die mir vorausgegangen sind. In Seelenverwandtschaft, mit einem grundlegenden Vertrauen in mich selbst und in das, was ich sein darf.
So schätze ich mich selbst wert! In meiner Vergangenheit wurde ich nicht gesehen und bekam nicht den Platz, der mir zustand. Ich wurde nicht wertgeschätzt. In der Zukunft kann ich gesehen werden und den Platz bekommen, der mir zusteht. Ich kann wertgeschätzt werden. In der Zukunft liegt das, was mir zusteht. Dienen und gedient werden!
Es wurde mir klar, dass es darum ging, mich selbst einzuschreiben. Indem ich mich selbst in das Leben einschreibe, in die Geschichten all dieser großartigen Töchter, die unsere Menschheit zur Einheit einer großen Familie aufrufen, kann all dies eines Tages zu Frieden führen. Und mit dieser Einschreibung wird deutlich, dass ich das persönliche Vorwort als persönlichen Auftrag annehmen kann.
Ruth fragt Boas: Warum habe ich Gnade gefunden in deinen Augen, dass du mich kennst, da ich eine Fremde bin? Boas antwortet: Du hast das Abenteuer gewagt.
Marlouk Alders
Dieser Text in niederländischer Sprache