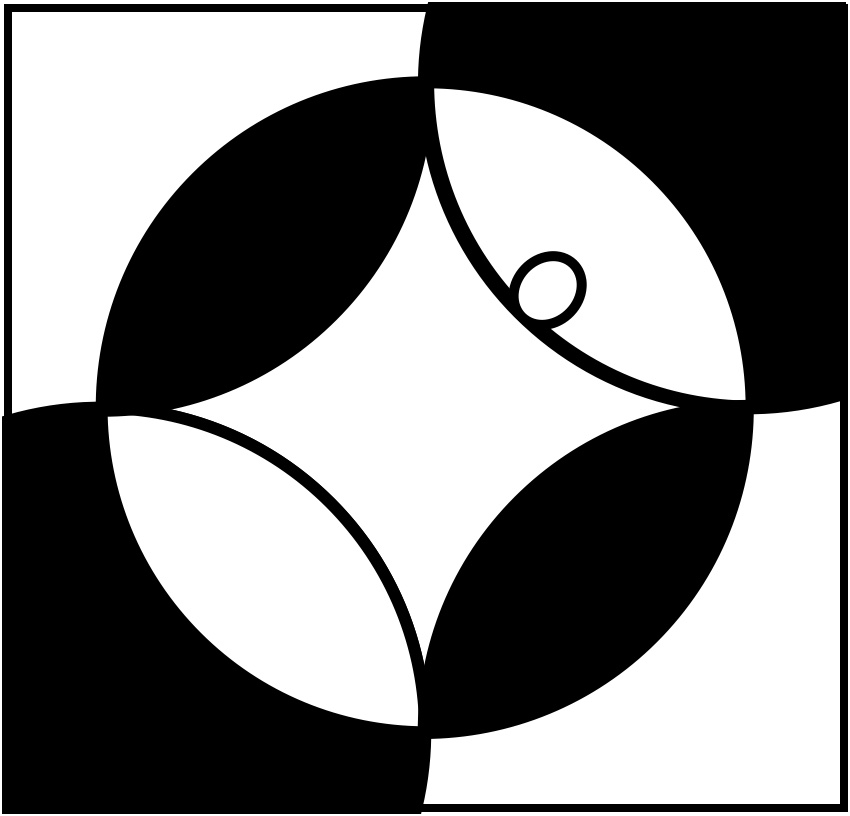Vittorio Hösle über Rosenstock-Huessy
3. Die Veränderung der philosophischen Situation durch die Reformation: Paracelsus’ neue Naturphilosophie und das Nein im Gott Jakob Böhmes
Philosophisch gesehen (und allein darum geht es hier) war die Reformation Martin Luthers sowohl ein Fortschritt als auch ein Rückschritt. Das Abschütteln der Autorität der katholischen Kirche und der scholastischen Philosophie bedeutete die Eröffnung neuer Freiräume, die sich zwar einzelne Denker des Mittelalters durchaus schon selbst genommen hatten, die aber nun allgemein, für jeden einzelnen Christen, galten. Gleichzeitig konnte aber dieser Gewinn an Autonomie nur dadurch legitimiert werden, daß der Christ direkt an das Wort Gottes gebunden wurde. Der unmittelbare Rückgriff auf die Bibel war sachlich plausibel; denn wenn die katholische Kirche ihre Autorität auf den menschgewordenen Gott zurückführte, gleichzeitig sich aber das Interpretationsmonopol der Aussagen Christi vorbehielt, war der Begründungszirkel nur zu manifest: Christus legitimiert die Kirche, aber die Kirche erklärt, was Christus eigentlich gelehrt habe. Es ist vielmehr erstaunlich, daß es so lange dauerte, bis der Ruf nach einem eigenen Zugang zum Wort Gottes geschichtsmächtig wurde. Externe Faktoren waren unabdingbar: einerseits der Verlust moralischer Glaubwürdigkeit durch das Betragen der Renaissancepäpste und -bischöfe, andererseits die Chance, die die deutschen Fürsten sahen, dank der Reformation die Oberherrschaft des Kaisers abzuschütteln. Denn Luther konnte nur siegen, ja, überleben, weil sich sein Landesherr seiner annahm, und zwar nicht nur aus religiösen Gründen.
Eugen Rosenstock-Huessy (1888-1973), einer der letzten deutschen Universalgelehrten in den Geistes- und Sozialwissenschaften, hat in seiner großen Studie über «Die europäischen Revolutionen» im Zusammenhang mit der Reformation von einer «Fürstenrevolution» gesprochen. Die Formung religiös autonomer Kleinstaaten mit eigenen Landesuniversitäten (während Paris eine europäische Universität gewesen war) und einem dem Landesherrn ergebenen und ein hohes Sozialprestige genießenden Beamtenstand ist eines der wichtigsten Resultate der deutschen Reformation gewesen. England begnügte sich im 17. Jahrhundert wie im Mittelalter mit zwei Universitäten, ohne daß dies seinen Aufstieg zur wirtschaftlich und politisch fortschrittlichsten Nation Europas im mindesten behindert hätte, Deutschland dagegen hatte trotz seiner späten Übernahme der Institution etwa vierzig Universitäten. Fürsten und Professoren/Pastoren/Beamte wurden die Säulen der neuen Ordnung, und während die ersten 1918 verschwanden, ist Deutschland im Grunde bis heute, und zwar auch in den katholischen Gebieten, ein Professoren- und Beamtenstaat geblieben, wie es ihn sonst nirgends auf der Welt gibt. Während in den meisten Fragen das Luthertum eine Mittelstellung einnimmt zwischen der katholischen Kirche und den reformierten Bekenntnissen, die sich viel entschiedener von mittelalterlichen Vorstellungen befreiten als Luther, gibt es einen Streitpunkt, in dem der Calvinismus der katholischen Lehre viel nähersteht als dem Luthertum, nämlich hinsichtlich des Widerstandsrechts, an dem Katholizismus und Calvinismus festhalten. Luther hingegen verwirft es radikal, und sosehr er sich durch die Schrift (Römerbrief 13) dazu ermächtigt glaubte, so offenkundig ist in externer Betrachtung, daß dies der Preis war, den er für den Schutz der Fürsten zahlen mußte. Die eigenwillige Verquickung des Pathos der Gewissensfreiheit mit Unterwürfigkeit auch gegenüber ungerechter Obrigkeit ist lange eines der Merkmale des Luthertums zumal in Deutschland geblieben. (Bezeichnenderweise findet sich eine Verteidigung des Widerstandsrechtes - der Stände, nicht jedes einzelnen - bei dem Calvinisten Johannes Althusius (1563-1638), dessen Konzeption eines föderalen Ständestaates mit Subsidiarität von Jean Bodins Rechtfertigung des französischen Absolutismus stark abweicht und der den Freiheitskampf der Niederlande legitimierte.)
Vittorio Hösle, Eine kurze Geschichte der deutschen Philosophie: Rückblick auf den deutschen Geist, Verlag C.H.Beck, München 2013, p.39ff
Hähnel:
Ist denn die Wiedereinführung der Wehrpflicht sinnvoll?
Hösle:
Innerhalb der EU haben nur sechs Staaten die Wehrpflicht nie abgeschafft: Dänemark, Estland, Finnland, Griechenland, Österreich und Zypern. Seit 2014 haben Litauen, Schweden und Lettland die Wehrpflicht wieder eingeführt. Zahlreiche Experten argumentieren, moderne Kriegsführung setze technische Kenntnisse voraus, die nur eine Berufsarmee erwerben könne. Das ist nicht falsch.
Aber die enorme psychologische Bedeutung des Wehrdienstes besteht darin, dass die Institution gleichsam ausspricht, erwachsen werden heiße Verantwortung übernehmen. Das heißt unter anderem, der Gesellschaft etwas zurückzugeben für die Jugend, in der man viel mehr Rechte als Pflichten hatte. Deswegen ist ein verpflichtendes Jahr für die Allgemeinheit bei jungen Menschen beiderlei Geschlechts eine gute Idee, das unter anderen geschichtlichen Bedingungen als den jetzigen nicht notwendig in Militärdienst bestehen muss, sondern ggf. auch in anderen Aufgaben.
Zumindest ein Freiwilligendienst muss als naheliegende Option für junge Menschen bestehen, damit sie reifen. Einer der großen Philosophen des 20. Jahrhunderts, Eugen Rosenstock-Huessy, hat sich schon in den 1920er und 1930er Jahren für derartige freiwillige Arbeitsdienste ausgesprochen, zuerst in Deutschland, dann in den USA.
Vittorio Hösle, Mit dem Rücken zu Russland, Verlag Karl Alber, Baden Baden 2022, p.93ff