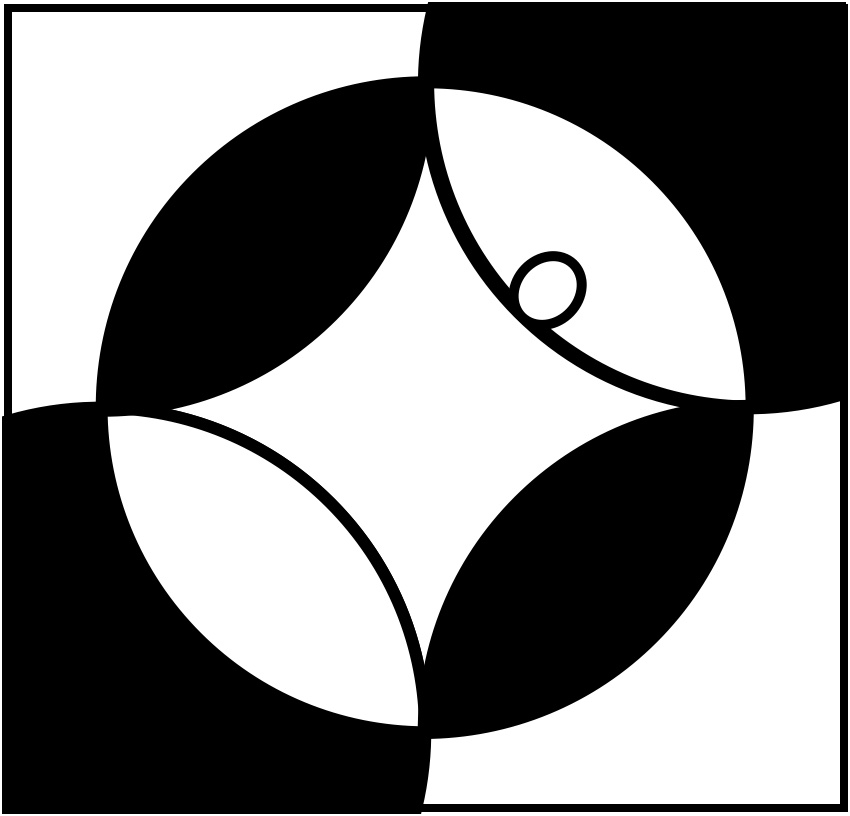Georg Müller: Vorchristliche Heilsgeschichte (1958)
Vorchristliche Heilsgeschichte1
Georg Müller
Eugen Rosenstock ist der Meinung, daß die Christenheit, aufs ganze gesehen, erst seit der Französischen Revolution vergessen hat, daß sie sich in einem heilsgeschichtlichen Prozeß befindet, der durch die Erscheinung Christi und die von diesem Ereignis ausgehenden Folgewirkungen bezeugt wird. Ist man bereit, dieser Grundeinsicht zuzustimmen, so bedarf es keines weiteren Glaubensschrittes zu der Vermutung, daß das Mittelpunktereignis der heilsgeschichtlichen Offenbarung seine adventliche Vorgeschichte gehabt haben müsse. In den vier Evangelien, die das Erdenwirken Christi bezeugen, ist uns die „Frucht der Lippen“ überliefert, die zu schaffen nach Jesaia 57, 19 der Herr verheißen hat. Es könnte sein, daß in der Aufeinanderfolge der Vierzahl der Evangelien sich die Vorbereitung des menschlichen Sprechens auf die in ihnen errungenen Sprachstufen widerspiegelt. Es könnte sein, daß wir in ihnen eigentümliche Hinweise auf das Wesen dieser ebenso sprachlichen wie geschichtlichen Stufen finden, die die Menschheit durchlaufen mußte, ehe die Zeit erfüllt war, d. h. ehe sie die endgültige Offenbarung des Wortes zu vernehmen imstande sein konnte.
Rosenstock spricht von einem Gesetz des Geistes, wonach die ursprünglichste und gewichtigste Einsicht jeweils am spätesten artikuliert, d. h. in verbindliche Sprache gefaßt wird. Das Johannes-Evangelium als das zuletzt niedergeschriebene unter den vier Evangelien enthält die tiefste Einsicht in dar Wesen Christi, wenn es diesen als das „Wort“ bezeichnet, das von Anfang an bei Gott war. Einen geistigen Prozeß verstehen heißt, ihn in seiner letzten gültigen Sprachform erfassen und von hier aus ihm schrittweise in die Vergangenheit nachgehen. Der geistige Prozeß kehrt also den natürlichen um. In unserer kurzen Betrachtung beachten wir insofern dieses geistige Gesetz, als wir zunächst die Aussagen Rosenstocks über die Notwendigkeit der Vierzahl der Evangelien ins Auge fassen, um nach einer kurzen Charakterisierung der Sprachstufen unter grammatischem Gesichtspunkt unsere Aufmerksamkeit auf die großen Epochen vor- bzw. außerchristlicher Geschichte zu lenken. Innerhalb der auf diese Weise‘ erforderlichen drei Abschnitte unserer Besinnung selbst verzichten wir - der Kürze halber - auf die Anwendung des Gesetzes des Geistes oder der Sprache und ordnen die Aussagen in der Abfolge ihrer geschichtlichen Gegenstände.
1.
Die vier Evangelien des Matthäus, Markus, Lukas und Johannes sind die „Lippen“ des auferstandenen Christus. Sie enthüllen den Sinn seines Todes, indem sie uns berichten, was es bedeutet, daß sein Herz brechen mußte. Innerhalb der vier Evangelien vollziehen sich ebenso viele Prozesse, die Wandlungen ihrer Verfasser schildern: Matthäus, der jüdische Zöllner, der Jesu Ruf gefolgt ist, begibt sich aus seinem Volkstum heraus und tut den ersten Schritt in eine alle Völker verbindende Kirche hinein, Markus, der Schüler des Petrus, .für den Jesus von Anfang an der Sohn Gottes ist, erkennt, daß der älteste Apostel, Petrus, ein Mensch wie andere war und Christus nicht gleichgesetzt werden kann. Lukas, der griechische Arzt und Begleiter des Paulus, unternimmt den Nachweis, daß der von Paulus verkündete Christus für die Heiden das Gleiche leistet, was Jesus für die Juden geleistet hat. Johannes, der Jünger, den Jesus liebte, faßt dessen Wesen von seinem kindhaften Herzen her als geboren in dem ewigen Wort Gottes, das von Anfang bei Gott war.
Die Sinnhaftigkeit in der Aufeinanderfolge der vier Evangelien ist auch dem Zweifler einsichtig. Ich zitiere Rosenstock: „Der Name Jesu setzt sich in der Alten Kirche aus vier Bestandteilen zusammen: Jesus, Christus, Sohn Gottes, Heiland. Die vier griechischen Anfangsbuchstaben dieser vier Namen werden gelesen als ICHTHYS (Fisch); die vier Evangelien brachten diese Namen hervor. Matthäus, der Sünder, wußte, daß der Herr sein persönlicher Retter (Heiland = SOTER) gewesen sei. Markus erfaßte ihn von Anfang an als Sohn Gottes (HYIOS THEOU). Lukas erblickte in ihm den „Christus“, der Paulus bekehrt hatte, obwohl dieser Jesus niemals begegnet war - für Paulus konnte Jesus nichts anderes als ausschließlich der Christus sein. Johannes schließlich, der kindhafte Geist, verstand ihn als seinen älteren Bruder, und das bedeutet, daß er ihn sich persönlich, als „Jesus“, dachte. Jesus, Christus, Gottes Sohn und Heiland waren die Aspekte, unter denen die vier Evangelisten schrieben.“ In der Abfolge der Evangelien bezeugt sich, wie gesagt, das „Gesetz des Geistes“, wonach das Zentralste oder Primärste eines Ereignisses zuletzt artikuliert wird: „Die Eigenart Jesu, durch die er in seiner Umgebung am weitesten, sichtbarsten und durchdringendsten wirkte, besteht darin, daß er Sünder rettete. Die engste Berührung mit seinem Herzen, in dem er am stärksten Jesus, diese eigene, wirkliche und einmalige Person war, besaß Johannes. Dieser überliefert die innersten Gedanken Jesu; Matthäus berichtet all die äußeren Glaubensbeweise, die Jesus als den Heiland offenbaren … In dieser Reihenfolge wiederholt sich die Erfahrung Jesu von sich selbst, die erst am Ende als die seines innersten Lebens sichtbar wurde. Daß eine Aussage über uns nicht gleich uns selbst betrifft, sondern zuerst nur unsere Oberflächenfunktion, entspricht der Erfahrung jeder lebenden Seele. Wir werden zunächst an unserem weniger zentralen Schicksal sichtbar. Der äußere Mensch wird früher erkannt als der innere, die historischen Tatsachen früher als ihre dauernde Bedeutung. Erst durch Pfingsten und die Erfahrung des Paulus unter den Heiden wurde die dauernde Bedeutung des Christus bekannt, während Petrus an seiner eigenen geschichtlichen Erfahrung mit dem lebendigen Sohn Gottes festhalten konnte. Die Reihenfolge der vier Evangelien ist notwendig, weil diese Reihenfolge die natürliche Ordnung umkehrt, die mit der natürlichen Individualität Jesu beginnt. Und eine solche Umkehr der Natur ist notwendige Abfolge bei jeder menschlichen Artikulation. ICHTHYS: Jesus, Christus, Sohn Gottes, Heiland: das ist die korrekte natürliche Ordnung, um diese Individualität zu offenbaren. Die linguistische, gesprochene und geschriebene Durchleuchtung dieser Individualität muß in der entgegengesetzten Ordnung und Reihenfolge bewußt gemacht werden: Heiland, Sohn Gottes, Christus, Jesus.“
Sind diese Hinweise auf die innere Sinnhaftigkeit der vier Evangelien schon eindrücklich genug, so wird ihre Aufeinanderfolge im Blick auf die Heilsgeschichte - im Sinne der Abstimmung auf die vorchristlichen Sprachstufen - erst recht bedeutsam, wenn man die in ihnen sich vollziehenden Handlungen bedenkt. Rosenstock spricht von einem Szenarium für vier dramatische Handlungen:
„Erste Szene: Matthäus, der Zöllner, läßt die Ziffern und Einträge seiner Konten hinter sich und erfährt die Vollmacht, die menschliche Worte haben können, wenn sie ein Mensch auf dem Wege zu seinem Tode spricht.
Zweite Szene: Petrus, der bäurische Fischer, wird nach Rom in das Zentrum der letzten westlichen Himmelswelt mit ihrem Gottmenschen Cäsar berufen - mit der Astrologie seiner Tempel und ihrer Sinnzeichen -‚ und hier verkündet er den wahren Tempel, das Wort und die wahren Sinnzeichen dieses Tempels: die Apostel.
Dritte Szene: Lukas, der griechische Arzt, erfahren in der Heilkunst, wird in die jüdische Umwelt berufen, wo man Nein sagt zur Körperwelt und die Begegnung mit körperlichen Symbolen fürchtet, wendet dieses Nein ebenso auf das natürliche Gesetz der Juden wie das der Heiden an und verkündet demgegenüber das schöpferische Ja der Christen.
Vierte Szene: Johannes, der Prophet der Offenbarung, betritt den griechischen Kosmos und erlöst Kunst und Dichtung der Griechen, indem er Gottes Dichten zu seinem Thema macht: er zeigt, auf welche Weise Gott ein Gedicht verfaßt.“
Es sind bestimmte Menschengruppen, die die einzelnen Evangelisten jeweils im Auge haben und die sie unterschiedlich ansprechen müssen, um ihnen die Botschaft von Jesus Christus zu verkünden: „Johannes sprach zu Menschen, die mit Künsten und Wissenschaften vertraut waren. Lukas sprach zu den größten Religiösen und Puritanern der Alten Welt. Markus sprach zu den zivilisiertesten Angehörigen des Tempelstaates. Aber Matthäus drang, dank seines „schlechten Geschmacks“, bis zur archaischen Schicht aller Gesellschaft durch, bis zu der Stammeswelt des Rituals. Auf diese Weise schuf Matthäus eine Version des Evangeliums, die der universalste und grundlegendste Charakterzug des neuen Lebens werden sollte. Die Messe und die Eucharistie, d. h. der innere Kern alles Gottesdienstes, ist bei Matthäus vorgezeichnet.“
Es ist im Rahmen eines kurzen Berichts nicht möglich, die Einzelnachweise anzuführen, mit denen Rosenstock die Sonderart der einzelnen Evangelien deutlich macht. Jedenfalls weicht er von der heute im allgemeinen gültigen Auffassung darin ab, daß nach ihm Johannes nicht hellenistisch und Lukas nicht als bloßer Pauliner interpretiert werden darf. Uns gehen hier die Bezüge an, die sich aus der eigenartigen Blickrichtung der einzelnen Evangelien zu den vorchristlichen Stufen sprachlicher bzw. geschichtlicher Entwicklung ergeben. Matthäus ‚ der Jesus als ein Opfer ansieht, das, ähnlich wie es im Ritual totemistisch verfaßter Stämme geschieht, dem Leben seines Volkes gebracht wird, hat, gerade weil er das Judentum überwindet, Beziehung zu der ältesten Stufe artikulierter Menschensprache. Markus, der in Rom, der politischen Hauptstadt der damaligen Welt und dem Mittelpunkt des Kaiserkultes, schreibt, zielt eben auf diese Himmelswelt oder Sternenreligion, wenn er den Sohn Gottes als das künftige Herz des Kosmos verkündet. Lukas, der „Akademiker“ unter den Evangelisten, vermittelt seiner jüdischen Umwelt als Grieche die Offenbarung, daß im Menschen Jesus die göttliche Inkarnation, der Christus Gottes, am Werk gewesen ist. Für die Griechen war es keine ungewohnte Vorstellung, daß ein Mensch zu den Göttern erhoben wurde. Den Juden umgekehrt mußte es als ärgste Gotteslästerung erscheinen, wenn der Mensch Jesus als der Christus Gottes verkündet wurde. Es ist also nicht das Lukas-Evangelium. das sich an die griechische Bildungswelt richtet, sondern das Evangelium des Johannes. Sein Bericht über Jesus, den man von jeher als „Dichtung“ im tiefsten Sinne empfunden hat, gibt Jesus und seinem Werk eigentlich „poetischen“ Charakter: Johannes bezeugt, daß in Person und Werk Jesu, in seinem Leben und seinem Sterben, Gott selbst als „Poet“, als Schöpfer, unmittelbar am Werke ist.
Erst das Ins-Auge-fassen dieser unterschiedlichen Schwerpunkte der Evangelien macht deutlich, daß ihre Vierzahl notwendig ist, um die von ihnen vierfach verkündete Wahrheit durchzusetzen. Eugen Rosenstock wirft die Frage auf, was aus der Offenbarung, d. h. aus dem Glauben, daß in dem Menschen Jesus Gott selbst Fleisch geworden ist, geworden wäre, wenn das Zeugnis über diesen Glauben lediglich in eine der bis dahin ausgebildeten Geschichtswelten hinein verkündet worden wäre. Was hätte sich ereignet, wäre damals nicht die „Fülle der Zeiten“ gewesen? Hätte zu Jesu Lebenszeit die Menschheit noch in nebeneinander und gegeneinander lebenden Stämmen ihr Dasein geführt, so würde Jesus bestenfalls zum Helden eines Mythos erhoben worden sein. „Die Christen”, so sagt Rosenstock, „würden einen Stamm mehr gebildet haben, indem sie als seine Jünger Ostern gefeiert hätten und innerhalb dieses kleinen Kreises seinen Mythos jährlich erneuert hätten.“ Würde das Erdenleben Jesu in die Epoche der Reiche gefallen sein, würde er also etwa in Aegypten zur Zeit der Ausbildung des Pharaonen- und Sternenkultes gelebt haben, so würde man aus dem Lauf der Sterne seinen Untergang abgelesen haben; man würde statt seiner einen anderen Christus mit einem besseren Horoskop erwartet haben: Jesus hätte also keinesfalls den Pharao verdrängen können. Wäre Jesus in eine Umgebung hineingeraten, die ausschließlich jüdisch bestimmt gewesen wäre, so wäre mit seinem Tode jede Erinnerung an ihn vernichtet worden. In den Augen Israels mußte sein Tod am Kreuz den Beweis bedeuten, daß er nicht der von Gott erwartete Messias gewesen ist. Und was würde schließlich aus dem Bericht über Leben und Tod Jesu, aus der Überlieferung seiner Aussprüche und Handlungen geworden sein, wenn er in einer ausschließlich griechisch bestimmten Umgebung gelebt hätte? Das Evangelium des Johannes wäre vermutlich zur Totenklage um einen früh verstorbenen Freund geworden: zu einem Gedicht wie die Ilias des Homer, die um den Tod des Achill herumgesungen worden ist, oder zu einem in Dialogform gegebenen Bericht, vergleichbar dem „Kriton“ oder der „Apologie“, in denen Plato die Erinnerung an seinen Meister Sokrates lebendig erhält. Das Hineinwirken des Evangeliums in die Stammeswelt, in die Kaiserreiche, in die Judenheit und in das hellenistische Griechentum konnte nur erfolgen, wenn die gleiche Wahrheit, die sich in Leben und Tod Jesu bezeugt hatte, auf diese vierfach unterschiedliche Weise verstanden und verkündet wurde. Indem Johannes das einmalige Leben Jesu auf das anfängliche Wollen Gottes mit den Menschen bezog, leistete er den entscheidenden Dienst: nur hierdurch wurde das Ereignis des Todes Jesu über die Bedingungen hinaus einsichtig, die von den bisher in der Geschichte wirksamen Lebenswelten oder Sprachstufen geboten wurden. „Johannes besiegelte das Aufkommen einer Aera hinter Stamm, Tempel, Dichtung und Israel. Die zyklischen Umläufe konnten nun abgelöst werden durch einen neuen Geschichtstag, weil die vier Ströme der Sprache nun vereinigt waren und in Ewigkeit fortströmen können wie im Ursprung am ersten Tage der Schöpfung. Die unendliche Wiederholung der Kreisläufe war abgebrochen, als das Kreuz als Zeichen des Anfangs, unter dem die Sprachströme zusammenlaufen, erhöht wurde.“
2.
Die vier Geschichtswelten, von denen die Rede war - die der Stämme und die der Reiche, die Israels und die des Griechentums - sind gleichbedeutend mit den vier Strömen vorchristlicher Sprachbildung, Nur in einem von ihnen, nur im israelitischen Sprachstrom, vollzieht sich eine Art Erfassung der Welt als Geschichte, wie sie seit der Erscheinung Christi für die gesamte Menschheit eingängig wurde. Weder die Stämme noch die Reiche, noch die Dichter und Denker Griechenlands sind über eine zyklische Auffassung geschichtlichen Lebens hinausgekommen. Insofern war es also notwendig, daß Jesu Erdenwandel auf alt-israelitischem Boden geschah und zugleich in einem Lande, in dem sich alle bisherigen Geschichtswelten oder Sprachströme begegneten. Rosenstock macht darauf aufmerksam, daß die vier Sprachströme ihr eigentlich beherrschendes Motiv in unterschiedlichen grammatischen Ausdrucksformen zur Geltung bringen. Er zeigt ferner, daß diese unterschiedlichen Sprecharten in überraschender Weise im Grundtenor der einzelnen Evangelien zum Klingen kommen. Matthäus wird zum Jünger durch einen plötzlichen Zuruf Jesu: Folge mir nach! Er läßt sich vom Imperativus personalis leiten. Das entspricht der Namengebung. die das Leben der Stämme bei der Initiation artikuliert; der zum Stammeskrieger ernannte Knabe erhält den verpflichtenden Namen eines Stammesheros. Für Markus ist der Bericht über Jesus ein Ausfluß des Subjectivus lyricus insofern, als die Erzählungen des Petrus, die seinem Bericht zugrundeliegen, von dem Erlebnis der Kameradschaft des Jüngerkreises mit ihrem Herrn getragen waren. Lukas demgegenüber, der sowenig wie Paulus den Menschen Jesus persönlich gekannt hat, ist der Berichterstatter der bei seiner Erzählung der historischen Abfolge der Ereignisse folgt. Indem er von der Geburt Jesu an erzählt, ist sein Evangelium Ausdruck des Narrativus historicus. Markus setzt die Kameradschaft der zwölf Jünger den Sternenbildern des Tierkreises entgegen, die nach der Anschauung der Reichskulte Himmel und Erde beherrschten. Lukas mußte sich beziehen auf die eigensinnige Frömmigkeit der Juden, die es nicht dulden konnten, daß sich ein Mensch mit Gott verglich. Johannes schließlich berichtet im Indikativus abstractus. Er bedurfte keiner äußeren Bestätigung, um sich von der Erwählung seines Freundes Jesus durch Gott überzeugen zu lassen: »Er gewann seinen Anhaltspunkt aus Jesu Sieg über die endlosen Kreisläufe des Rituals, der Aeonen und Revolutionen, die die Alte Welt in den Abgrund stürzten. Er beginnt mit dem Prozeß, der durch die Kraft des Wortes in Bewegung gebracht wird, mit seinem Indikativus abstractus ‚Im Anfang war das Wort‘. “Johannes also, um das noch einmal deutlich zu sagen, vollbringt die eigentlich „griechische“ Leistung unter den Evangelisten, insofern er einen gleichsam abstrakten oder „objektiven“ Beweisgrund für die Wahrheit des Evangeliums liefert.
Die Vierheit der Evangelien macht nach alledem deutlich, daß es tief berechtigt ist, wenn wir mit der Erscheinung Christi unsere Zeitrechnung einsetzen lassen. Sie ist ferner ein Zeichen dafür, daß die unterschiedlichen Sprachformen, deren sich die Evangelisten vorzugsweise bedienen, bzw. die Geschichtswelt mit denen sie sich vorzugsweise auseinanderzusetzen hatten, die vier Hauptströme des vorchristlichen Geschichtslebens der Menschheit und gleichzeitig die vier Hauptstufen in der Artikulation der menschlichen Sprache bedeuten. In diesem Sinne ist das Wort Eugen Rosenstocks zu verstehen, daß in der Vierheit der Evangelien das „ursprüngliche Kreuz der Grammatik“ wiederhergestellt wird. Die vor- und außerchristlichen Rituale erstarrten in der Magie, die Sternenwelten der großen Reiche führten zur Routine. Bloßes Griechentum verleitet zu intellektuellem Spiel und zum Sport der Logik. Erst im Kreuz — d. h. in der vierfachen Bezeugung ein- und derselben Wahrheit für jeweils unterschiedliche Geschichtsstufen und somit auch unterschiedliche Sprachweisen — wandelt sich das Kreuz der Grammatik in eine „Grammatik des Kreuzes“ um: „Als die vier Evangelien Jesu Lippen wurden, formten sie sich bei Matthäus so, daß sich Markus veranlaßt sah, sich in das innerste Heiligtum zu begeben; bei Markus so, daß Lukas veranlaßt wurde, die Berichte über die Vergangenheit zu prüfen. Schließlich bei Lukas so, daß Johannes getrieben wurde bis zum ewigen kosmischen Sitz der Wahrheit vorzustoßen. Auf solche Weise wirken die vier Männer in die neue Welt hinein: in das innerste Heiligtum, die Zeiten der Vergangenheit und die ewige Wahrheit. Sie reformierten das Kreuz der Grammatik, in dem sie eine Grammatik des Kreuzes schufen, in deren Formen sterbliche Menschen gemeinsam von der Wahrheit berichten können.“
Der Vierzahl der sinnhaft aufeinanderfolgenden und einander notwendig ergänzenden Evangelien entspricht die Vierzahl der vor- bzw. außerchristlichen Geschichts- und Sprachstufen. Daß die geschichtlichen Stufen mit den sprachlichen indentisch sind, wird man nur einsehen können, wenn man sich die Unterscheidung zwischen vorformaler und formaler Sprache zu eigen macht. Nur um diese geht es in der zunehmenden Artikulation des menschlichen Sprechens. Nur um diese geht es daher auch bei der Anerkennung der Stufen sprachlicher Artikulation. Es geht um das, was man auch menschliche Hochsprache nennen könnte, um die Sprache, in der es um Leben und Tod des Menschen geht, um Gebot und Gebet, um Dichtung und Wissenschaft.
Unter unformaler Sprache haben wir all die Tongebung zu verstehen, in der der Mensch von jeher Tierlaute oder Naturgeräusche nachzuahmen verstanden hat. Es ist keine Frage, daß diese unartikulierte Art des Sprechens nicht nur in unseren sogenannten Interjektionen, sondern auch in der Bildung dieses oder jenes Hauptwortes, Eigenschaftswortes oder Tätigkeitswortes anklingt. Es ist aber eine unmögliche Vorstellung, daß sich aus Nachahmung bloßer Naturlaute die eigentliche menschliche Hochsprache entwickelt habe. Das konnte man nur in einer Zeit, annehmen, in der das Entwicklungsdogma das Denken beherrschte und jedes Große in der Welt der Erscheinungen auf primitive Anfänge zurückgeführt wurde. Die menschliche Hochsprache entsteht im Ritual. Daher ist das Wesen eigentlich menschlicher Sprachentfaltung nur deutlich zu machen, wenn man zu verstehen sucht, welche Rolle menschlichem Sprechen im Ritual des Stammeslebens zukommt, das aller Bildung von Reichen und Völkern geschichtlich vorausgeht. Vorausschauend mögen noch einmal die Stufen menschlicher Sprachentfaltung genannt werden, die sich an den Epochen geschichtlicher Entfaltung sichtbar machen lassen, die bis zum Beginn unserer Zeitrechnung die Menschheit des ägyptisch-vorderasiatischen Kulturkreises durchlebt hat:
Im Leben der Stämme ist das wichtigste Moment menschlichen Sprechens die Namengebung am Totempfahl. In Ägypten löst sich der Pharao aus dem Totem des von seinen Toten beherrschten Stammes und erhebt sich und sein Haus zum Mitglied der den Himmel beherrschenden Sternenfamilie. Indem der Pharao gewissermaßen der erste Mensch ist, der mit Betonung von sich als einem Ich sprechen kann, ist die ägyptische Geschichtsstufe gleichzeitig die Stufe der Herausbildung der pronominalen Sprache. Es hat diese auch schon früher gegeben: außerhalb des Rituals, in seinem gleichsam „präformalen“ Familienkreise, hat auch der Mensch der Stämme schon pronominal gesprochen. Aber daß das pronominale Sprechen zum Bestandteil der Hochsprache wurde, setzt den ungeheuren Vorgang der Reichsbildung voraus, die den Totendienst der Stämme verbannte und sie durch den Dienst der Sterne ersetzte. Die dritte der vorchristlichen Sprachstufen entfaltet sich in Opposition zu den Sternenreichen oder Himmelswelten, die vier Jahrtausende hindurch das Leben in den Hochkulturen Nordafrikas und Asiens bestimmen. Es ist ein Exodos in die Wüste, eine Loslösung aus dem Sternenreich, das die Voraussetzung zu solcher neuer Sprachstufe bildet. Diese Loslösung führt auf israelitischem Boden im Zusammenhang mit dem doppelten Exodos - des Abraham aus dem Lande Sinear und des Mose aus Ägypten - zu der Entdeckung des außerweltlichen Gottes, der nicht nur der Herr der Sterne, sondern auch der Herr der Toten ist. Sprachlich gesehen kommt er infolge der Ansprache durch das göttiche Du zu einer Zurückdrängung des in den Reichen allzu hoch gesteigerten pronominalen Sprechens. Mit anderen Worten: dem Pharao gleichwie jedem Gewaltmenschen, der ihm nacheifernd an die Stelle Gottes als selbständig handelndes Ich sich setzen wollte, wird Halt geboten. Auch dem Stamme wird verwehrt, sich selbst und seine Existenz als göttlich absolut zu setzen. Es beginnt ein Sprechen, das ein echtes Gebet ermöglicht, ein Gebet, in dem der Mensch sich als der von Gott Angesprochene und von ihm Verurteilte erkennt.
Auf andere Weise als auf dem Boden Israels wirkt sich die Begegnung mit den Himmelswelten, den Großreichen Ägyptens und Vorderasiens, auf griechischem Boden aus. Es ist die große Entdeckung Homers, daß es vieler Städte und vieler Stämme Menschen gibt. Ihm erscheint die Erde größer und weiter, als sie innerhalb eines der Reiche erfaßt wurde, für die der Sichtbereich einer bestimmten Sternenkonstellation mit der Ausdehnung der Welt selbst gleichgesetzt wurde. Und überall auf dieser weiten Erde gibt es tapfere und wackere Männer! Für den Stammeskrieger gab es „Menschen“ nur innerhalb der nächstverwandten Clans, für den Reichsbürger nur innerhalb seiner Sternenwelt. Sprachlich bedeutet das, daß es erst auf griechischem Boden zur Aufnahme der dritten Person und der unbestimmten Fürwörter in den Bereich des verbindlichen Sprechens kommt. Das Unbestimmte des Lebens außerhalb der blutsmäßig gebundenen Stämme und der unter ihrer besonderen Sternenkonstellation erfaßten Reiche wird schon immer durch irgendwelche Wortbildungen bezeichnet worden sein. Aber es war von allen Schauern des Unheimlichen und Gefahrdrohenden umwittert. Erst die vielerfahrenen, die Meere befahrenden Griechen verloren diese ursprüngliche Angst vor dem Unbekannten und Unbestimmten. Mit der Hineinnahme der unbestimmten Fürwörter, zunächst in das dichterische, dann in das allgemein erzählende und darstellende Wort, und mit der Anerkennung des Gemeinmenschlichen wurden die Griechen zum Volke der Philosophie und Wissenschaft.
3.
Mit diesen Andeutungen mag es zunächst genug sein. Es könnte schon jetzt eingesehen werden, daß die Artikulation unseres Sprechens, d. h. die Verbindung bestimmter Wortarten und ihrer Beugungen mit klaren Vorstellungen, Ergebnis eines Prozesses ist, dessen einzelne Stufen jeweils ganz entscheidende Mutationen im Bewußtsein der von ihnen betroffenen Menschen voraussetzen. Es bleibt vorbehalten, die drei Stufen der ägyptischen, der israelitischen und griechischen Entfaltung näher zu charakterisieren. Hier mag lediglich auf das Stammesritual eingegangen werden, das ursprunghaft alle Elemente menschlichen Sprechens enthält und daher die Grundlage bietet für die Erörterung der Fragen, die mit dem Ursprung artikulierten menschlichen Sprechens verbunden sind. Nach den Beobachtungen Eugen Rosenstocks sind es vor allem zwei Ordnungen menschlichen Zusammenlebens, die ohne das Ritual des Stammes niemals entstanden wären: die Totenehrung und die Ehe. Um das Zweite vorauszunehmen, so bedarf es wohl kaum einer Begründung, daß die weitverbreitete Vorstellung, wonach Stämme sich aus dem Zusammenschluß von Einzelfamilien gebildet hätten, als kindliches Märchen entlarvt werden muß. Ehe und Familie sind „Inseln des Friedens“, für die nur durch feierliche Stiftung vonseiten des Stammes Gewähr geboten werden kann. Es ist hier nicht der Ort, von der Bedeutung der Alters- und Heiratsklassen zu reden. Es genügt, daran zu erinnern, daß der Stamm die Ehe nur dadurch vor Zerstörung zu bewahren vermochte, daß er zu bestimmten Zeiten Orgien gestattete, die den Trieben freie Bahn ließen. Ohne das würde der Mensch der Frühzeit überfordert worden sein. Bedenken wir, welche schweren Probleme nach vieltausendjähriger Zivilisierung auch heute noch mit dem menschlichen Geschlechtsleben verbunden sind!
Für unsere Betrachtung wichtiger ist das andere: die Erhebung des Grabes zum Mutterschoß. Der Mensch ist das einzige Wesen, das seine Toten nicht verscharrt, sondern bestattet. Über den Gräbern der Toten wurde die artikulierte Sprache des Menschen geschaffen. Denn nur mit Hilfe der Sprache war es möglich, die „natürliche“ Beziehung zwischen Geburt und Tod zu überwinden. „Der ganze Grundzug unserer Sprachentwicklung - alles Sprechens, alles Singens, aller Gesetzgebung, aller Predigt, aller gedruckten Literatur - liegt in dieser Umkehrung, wonach der Tod der Geburt vorausgeht.“ Beisetzung des Toten ist eben nicht ein natürliches Geschehnis, sondern eine Revolution gegen die Natur. Menschliche Solidarität zeigt sich darin, daß der Mensch den Tod in Geburt verwandelt. Man muß sich vor Augen halten, daß die mit den Toten dahingeschwundene seelische Kraft als weiterhin wirksam geglaubt wurde und daß diese seelische Kraft bei der Initiation von einem jüngeren Angehörigen des Stammes in sich aufgenommen wurde: „Das Begräbnis ist eine zweite Geburt, die ein vorher Geschehenes zu neuem Leben erweckt; die Initiation ist ein erster Tod, der den Menschen daran denken läßt, daß er Nachfolger haben wird.“
Die Initiation ist nun in der Tat vor der Eheschließung der wichtigste Vorgang im Stammesleben und daher auch der Vorgang, der für die Artikulierung menschlichen Sprechens grundlegend geworden ist. Denn Initiierung bedeutet gleichzeitig Namengebung. Tiere mögen innerhalb ihrer Gattung an bestimmten Lauten sich gegenseitig erkennen. Junge Tiere erkennen ihre Mutter am Lockruf, geschlechtsreife ihren Partner am Brunstschrei oder Balzgesang. Aber kein Tier gibt dem anderen einen Namen! Namengebung ist ausschließlich Sache des Menschen. Und wenn vor dem Totempfahl der zu initiierende Knabe den Namen des gefallenen oder verstorbenen Stammesvorfahren erhielt, -bedeutete dieser Name Ruf und Befehl in einem: „Namen sind Verheißungen, die erfüllt werden müssen. Jeder Name, der an dem für ihn angebrachten Ort ausgerufen wird, ist ein Akt des Glaubens, der Zusammengehörigkeit, des Gehorsams und des gesellschaftlichen Wirkens. Er beruht ganz und gar auf dieser Dreifaltigkeit: ein Name, der nicht mehr diesen dreieinigen Zusammenschluß zwischen der Öffentlichkeit, dem Sprecher und dem Geist hervorbringt, ist tot und muß begraben werden.“
Der Name war von Ursprung her mit Bedeutung geladen. Er war als Ruf Befehl und Aussage zugleich. So ist es zu verstehen, daß der Vokativ in seiner ursprünglichen Bedeutung für menschliches Zusammenleben sowohl nominale wie verbale Bedeutung hat. Die feierliche Ausrufung des Namens am Totempfahl bezeichnete seinen neuen Träger nicht nur als Inhaber dieser oder jener Eigenschaft, als Besitzer dieses oder jenes Merkmals, sondern gab ihm zugleich Weisung für das ganze Leben. Der Name war zugleich Imperativ und befahl ein bestimmtes Verhalten, in Nacheiferung des Beispiels, das der frühere Träger des gleichen Namens gegeben hatte. Ähnliches gilt für alle Akte, die mit feierlicher Sprache im Ablauf des Rituals geschehen. Immer geht es dabei um die Wechselbeziehung zwischen „Haupt“ und „Zunge“, zwischen dem Gesetzgeber, der ein Priester oder Stammesältester sein kann, und den Stammesangehörigen. Was wir heute Muttersprache nennen, ist der sprachliche Ausdruck der Erfahrung einer Menschengruppe, wie sie zuerst ursprunghaft - als „Vatersprache“ - von den Angehörigen eines Stammes im Ritual artikuliert worden ist. Darin liegt die Typusbedeutung des Rituals für die Erfassung des Wesens menschlicher Sprache überhaupt. Die artikulierte Menschensprache ist nicht von Ursprung her Erfindung einzelner begnadeter Menschen, wieviele ihrer auch im Laufe des geschichtlichen Prozesses zu ihrer Bereicherung beigetragen haben mögen, - sie ist zunächst aus dem Hören auf eine gleichsam übermenschliche, vom Totempfahl her ertönende Stimme zu verstehen.
Hiermit wird die grammatische Situation deutlich, die die Grundlage für alles formale, das heißt eben artikuliertes menschliches Sprechen ist. Die Menschen sind Hörer, die von den Toten her durch einen Sprecher angerufen werden: „Im Ritual werden die Hörer genau so wichtig genommen wie die Sprecher: sie marschieren mit tiefer Verbeugung auf oder sie liegen ausgestreckt oder auf den Knien da. Sie werden zum Hören und Gehorchen aufgefordert. Dieser Vorgang ist so wesentlich, daß die Versammlung als Ganzes stärker durch ein erregendes Hören als durch den Sprecher in Stimmung versetzt wird. Der stärkste Eindruck im ersten Akt eines Rituals ist für gewöhnlich der, daß eine Stimme ertönt, die die Versammelten anspricht. Die Menschheit will als die zweite Person der Grammatik erfaßt werden, die in einem eindrücklichen Ritual angesprochen wird. Im Imperativ gibt es kein Ich, da gibt es nur ein Du im Herzen eines jeden Hörers. In der Grammatik des Menschen steht als erstes das Du, an zweiter Stelle das Ich. Wenn er nur hört, kann jedermann vom Geist angesprochen werden. In diesem Prozeß, wo wir geformt werden, überwältigt uns der Geist, und inspiriert beginnen wir zu singen und zu tanzen. Dann wird die Geschichte berichtet als der Mythos des Ich. Schließlich werden die Vorgänge wiederholt. Weil bei diesen Gelegenheiten alle Lebenszeiten in Gang gebracht werden, bestand die Möglichkeit, alle Geschöpfe aufzurufen.“
In diesen Worten ist zweierlei ausgesagt. Zunächst, daß das Wesen menschlicher artikulierter Sprache nur dann recht erfaßt werden kann, wenn man es aus einem ursprünglichen Hören versteht als ein Antworten auf einen Ruf, der aus dem Jenseits des Todes an die Menschheit erging. Und dann: daß im Ritual grundsätzlich alle Hauptrichtungen menschlichen Sprechens in Tätigkeit gesetzt werden: Befehl und Beschwörung, Gesang und Bericht. Es gäbe also weder Gesetz noch Planung, weder Kunst noch Wissenschaft, wenn nicht der Grund zu allem im Stammesritual gelegt worden wäre. - Aber die Sprache bedurfte langer Zeit zu ihrer Entfaltung für alle Lebensbeziehungen der Menschen. Und daher ging der Weg menschlicher Sprachentfaltung vom Stammesleben über die Sternenreiche, über Israel und Griechentum, zum vollen Wort der Evangelien.
Eugen Rosenstock-Huessy: Des Christen Zukunft,
- p.268f: Zwei Generationenweg des handelnden Geistes
Unsere Soldaten warten auf die Gelegenheit, nicht einfach nach Hause zu kommen, sondern sich einem neuen Frieden zuzuwenden und in die Zukunft einwandern zu können. Die Moral dieser Armee wird weitgehend von einem Umschwung in den Herzen der das Wort führenden Generation abhängen, von den Leuten, die lehren, sprechen und gelegentlich denken. Unsere Schulen haben sich bemüht, den Jungen und Mädchen jene Werte beizubringen, die wir für erstrebenswert halten. Dieses bedeutete meistens, daß sie dazu aufgefordert wurden, das zu fühlen, was wir dachten. So hörten sie auf zu fühlen. Nun, die Entdeckung des Zwei-Generationen-Weges des handelnden Geistes bewirkt eine riesige Umstellung. Die Jungen müssen jetzt erst einmal Gelegenheit haben zu fühlen, zu spüren, zu ahnen, für sich selbst zu kämpfen, das Böse zu bekämpfen, die Welt zu beschützen, ehe wir zu ihnen in der Theorie sprechen können. Die Alten müssen das ausdenken, was die Jungen über die Zukunft gefühlt haben oder fühlen können. »Wir können von der Menschheit sagen, daß sie in einem ständigen Konflikt zwischen jung und alt begriffen ist.« Jugend wird nicht durch Jahre gekennzeichnet, sondern durch den schöpferischen Impuls, irgend etwas fertigzubringen. Die Älteren sind diejenigen, die vor allem danach trachten, keinen Fehler zu machen. Die Logik ist der Olivenzweig der Älteren an die Jüngeren Anders ausgedrückt, nie sollte der Denker (jeder Mensch, ob alt oder jung, dem eine Frage gestellt wird, befindet sich in dieser peinlichen Lage) den Handelnden (den Menschen, der im Begriff steht, etwas zu unternehmen, womöglich auf Grund der Antwort des Denkers) dazu auffordern, den Abstand des Denkers zu teilen. Fragen liegen außerhalb des Lebensstromes selber. Wer fragt, steigt aus. Dieses tut jedoch unsere akademische Erziehung, und die bewußte Absonderung des Denker-Antwortenden wird als das einzig richtige Gefühlsklima empfohlen. »Reg dich nicht auf«; das ist kein weiser Rat für junge Menschen. Wenn die Jungen sich nicht mehr aufregen können, entartet die Welt ebenso sehr, wie wenn alte Menschen den Kopf verlieren. - p.273
Das Miteinanderexistieren von mehr als einer Generation zur selben Zeit, die Entbindung vom blinden Kreislaufe und einander folgenden Ursachen hat man die Errungenschaft des Heiligen Geistes genannt. Er wurde als ein aus dem Vater und dem Sohne Hervorgegangener erfasst. Wir wissen es alle, dass des Vaters Denken in die Antriebe des Sohnes eintreten soll.. ……VATERSCHAFT IST DAS NEUDENKEN DER WELT IM LICHTE UNSERER KINDER.
-
erschienen in EU 4/58 [Evangelische Unterweisung 4/1958] ↩