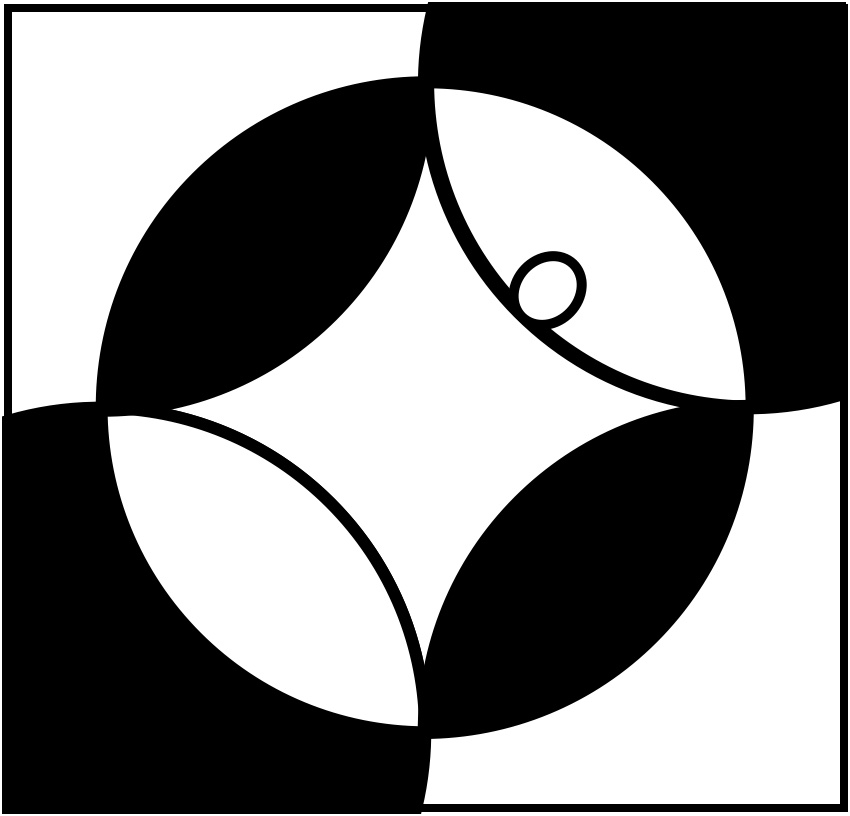Georg Müller: Religionsphilosophie und Heilsgeschichte
Religionsphilosophie und Heilsgeschichte
Franz Rosenzweig und Eugen Rosenstock
Im Juli 1913, während eines langen Nachtgesprächs zwischen dem fünfundzwanzigjährigen Dozenten für Rechtsgeschichte an der Leipziger Universität und dem um anderthalb Jahre älteren Philosophiestudenten entzündete sich das Feuer, das seitdem zeitweise nur zu glimmen schien, aber durch die dokumentarische Neuveröffentlichung des zentralen Werkes jedes der beiden Denker1 - zweier Werke, die in einer spannungsreichen und kaum ausschöpfbaren Polarität zueinander stehen - vielleicht erst jetzt zu rechter Glut gelangen wird. Franz Rosenzweig (geb. 1886 in Kassel) hat stets bekannt, daß er den „Stern der Erlösung” ohne die erregende Begegnung mit Eugen Rosenstock (geb. 1888 in Berlin) nie geschrieben hätte, und dieser- ordentlicher Professor der Rechte in Breslau von 1923 bis 1933, heute am Dartmouth-College in Hanover USA - entwickelt sein bedeutungsvolles Sprachdenken im ständigen Gedenken an den im Jahre 1929 frühzeitig verstorbenen Freund.
In dem Briefwechsel der beiden, der in den Monaten Juli bis November 1916, als sie beide Frontdienst taten - der eine als Leutnant vor Verdun, der andere als Unteroffizier in Mazedonien -, seine höchste Lebendigkeit erreichte, geht es vordergründig um die Auseinandersetzung zwischen Christentum und Judentum. Beide Briefschreiber entstammen liberalen jüdischen Elternhäusern. Aber Eugen Rosenstock hat von Beginn seines bewußten Lebens an dem „Wort” vertraut; der „stille Gott” der Philosophen oder des Pantheismus ist niemals eine Versuchung für ihn gewesen. Anders der junge Philosoph aus Kassel: er glaubte, sein aufgeklärtes Judentum mit dem deutschen Idealismus in Einklang bringen zu können. Als er durch das rückhaltlose Bekenntnis des jüngeren Freundes aufgeschreckt wurde, verteidigte er energisch die These, daß es für einen Juden keinen Durchgang durch das Heidentum zum Christentum und zuletzt nur eine Rückkehr zum Judentum geben könne. Die Summe dessen, was aus dem Leipziger Religionsgespräch in den „Stern”und in „Des Christen Zukunft” eingegangen ist, bildet den Hauptstrang einer religiösen Nebenströmung der Existenzbesinnung, die sich gleichzeitig in der Philosophie vollzog. Denn in einem waren die beiden Freunde von Anfang an einig: sie trauten der Bibel, und sie mißtrauten der Kunst der bloßen Begriffe. Sie waren davon überzeugt, daß die Rettung der europäischen Kultur nur aus dem Bereich „übereuropäischer und übermenschlicher Mächte” erhofft werden könne. Der Jude Franz Rosenzweig und der evangelische Christ Eugen Rosenstock teilen diese letzte Grundüberzeugung mit dem Katholiken Ferdinand Ebner, dessen Werk „Das Wort und die geistigen Realitäten”2 zu gleicher Zeit mit Rosenzweigs „Stern” entstand und erschien (Regensburg 1921). Sie alle drei bekennen sich zu dem Satz: „Die Sprache ist wahrhaftig die Morgengabe des Schöpfers an die Menschheit und doch zugleich das gemeinsame Gut der Menschenkinder, an dem jedes seinen besonderen Anteil hat, und endlich das Siegel der Menschheit im Menschen. Sie ist ganz von Anfang, der Mensch wurde zum Menschen, als er sprach; und doch gibt es bis auf diesen Tag noch keine Sprache der Menschheit, sondern sie wird erst am Ende sein” (Stern I S. 29). Im einzelnen gibt es unterschiedliche Ansätze: Ebners Methode ist „pneumatologisch”, die Rosenzweigs „mosaisch-prophetisch”, Rosenstock bezeichnet seine eigene als „nennkräftig-christlich”. Rosenstock und Rosenzweig sind sich darin einig, daß unter allen Wörtern die alten Namen der Offenbarung, und des Kultes das eigentliche Geheimnis der Sprache in sich tragen.
Dabei ist von Rosenzweig zu Rosenstock eine zunehmende Erhellung der nur abgeleiteten und dienenden Rolle unseres begrifflichen Denkens zu beobachten. Das ist der Grund dafür, daß der „Stern” der Religionsphilosophie angehört, während Rosenstock die Bezeichnung Philosophie für sein christliches Sprachdenken entschieden und mit vollem Recht ablehnt. Denn über Offenbarung zu „philosophieren” verbietet sich, wo es einem mit der Inkarnation, der Fleischwerdung des Wortes, ganz ernst ist. Unrichtig wäre es hinwiederum, den „Stern der Erlösung” als ein Werk spezifisch jüdischer Religionsphilosophie zu charakterisieren. Dazu gibt weder die ursprüngliche Intention des Verfassers noch der Inhalt dieses einzigartigen, an ein Triptychon gemahnenden Werkes hinreichenden Anlaß. Rosenzweig hat bis zuletzt an der geistigen Gemeinschaft mit seinen christlichen Freunden festgehalten. Er bestritt ihnen freilich die Gemeinschaft im Sakramentalen. Er blieb dabei, daß es für den frommen Juden keine Metanoia, keine Buße oder Sinnesänderung, sondern nur eine Teschubah, nur eine Rück-, Um- oder Wiederkehr zu seinem Volke geben könne. In diesem Punkte gibt es für Rosenzweig kein Paktieren: „Ich erkenne diesen missionstheologischen Begriff des ,Christen aus Israel’ nicht an. Der Jude zwischen Kreuzigung und Wiederkunft kann für die christliche Theologie nur negative Bedeutung haben”, so heißt es in Briefen aus dem entscheidenden Jahr 1916, und: „Der metaphysische Grund des Antisemitismus ist erstens, daß wir die Wahrheit haben, zweitens, daß wir am Ziel sind und daß wir zwischen uns und dem Vater im Himmel keinen Dritten brauchen.” Aber der „Stern” selbst, so will es Rosenzweig, wenn er auch nur von einem Juden geschrieben werden konnte, ist kein Werk jüdischer Philosophie, sondern ein „Geschenk, das der deutsche Geist seiner jüdischen Enklave verdankt” (an Rudolf Hallo 1923). Und zur Bekräftigung dessen kann er unter anderem auf seine eindrucksvolle Würdigung der religiösen Sendung Goethes verweisen, die den Schlußband des „Stern” eröffnet.
Von Hegel zum „Stern der Erlösung”
Rosenzweigs zweibändiges Werk „Hegel und der Staat”, das 1920 erschienen ist, gehört zu den Standardbüchern der Hegel-Literatur. Über das gleiche Thema hatte er acht Jahre vorher in Freiburg promoviert. Später hat er bekannt, daß ihm die „Schädlichkeit” der Hegelschen Philosophie - in der letzten Ausschöpfung ausschließlich begrifflicher Methoden - bereits früh deutlich geworden sei. Andererseits war er während der entscheidenden Auseinandersetzung mit Rosenstock noch im Dualismus von Offenbarung und Welt befangen. Der Anteil des deutschen philosophischen Idealismus an der Religionsphilosophie des „Stern” wird sich daher schwer bestimmen lassen. Gar nichts zu tun hat sie mit der Mystik, der erste Kritiker der zwanziger Jahre das ungewöhnliche Werk gern zuweisen wollten. Das damals unerhört Neue lag im Ernstnehmen der Ungeschiedenheit der drei „Substanzen” Gott, Welt und Mensch, deren jede eine Wirklichkeit für sich ist, wobei sie als Wesenheiten sich gegenseitig gleichmäßig transzendent sind. „Wenn das alte Denken sich das Problem stellt, ob Gott transzendent oder immanent sei, so versucht das neue, zu sagen, wie und wann er aus dem fernen zum nahen Gotte wird und wieder aus dem nahen zum fernen”, so schrieb Rosenzweig in einer späteren Einführung zum „Stern”. Ferner:
„Was Gott getan hat, was er tut, was er tun wird; was der Welt geschehen ist, was ihr geschehen wird; was dem Menschen geschieht, was er tun wird: das alles kann nicht von seiner Zeitlichkeit losgelöst werden, also daß man etwa das kommende Reich Gottes erkennen könnte, wie man die geschaffene Schöpfung erkennen kann, oder die Schöpfung so ansehen dürfte, wie man das Reich der Zukunft ansehen darf, genauso wenig wieder Mensch sich den Blitzstrahl der immer nur gegenwärtigen Erfahrung zur Vergangenheit verkohlen lassen darf und ebenso wenig ihn von der Zukunft erwarten”.
Auf solcher Grundlage unternimmt es Rosenzweig zunächst, das Verständnis für die Religion der Vorwelt, d. h. der heidnischen Antike, zu bereiten. Hier sind Gott, Welt und Mensch einander gegenseitig verschlossene Wirklichkeiten, denen es an Kommunikation miteinander mangelt. Das wird anders mi Bereich biblischer Erfahrung. Der Dreifalt göttlicher Hinwendung zur Welt und Menschheit in Schöpfung, Offenbarung und Erlösung ist der mittlere Hauptteil des Werkes gewidmet, Ständig wird die hier sich bereitende menschliche Erfahrung von dem außerchristlichen Bereich - zumal des Islam, aber auch Chinas und Indiens - abgehoben. Es ist nun einmal die besondere Begnadung des biblischen Erlebnisbereichs, daß in ihm Gott als der die Geschichte Bestimmende erscheint: An die Stelle, die in der Vorwelt der Freiherr seines Selbst einnahm, tritt in der erneuten und allezeit sich erneuernden Welt der Knecht seines Gottes” (II, S. 18). Dabei kommt es sowohl in der religiösen Erfahrung wie im Bericht darüber auf das lebendige Gespräch an: „Wie der bloße Schöpfer stets in Gefahr ist, zurück ins Verborgene zu sinken, so die bloße Seligkeit der in Gottes Liebesblick versenkten Seele zurück ins Verschlossene. Der verschlossene Mensch steht ähnlich wie der verborgene Gott an der Grenze der Offenbarung und scheidet sie von der Vorwelt” (ebd.S. 17). Mystik hat hier keinen Raum. Das lebendige Sprechen ist stets zeitgebunden und zeitgenährt; vor allem läßt es sich sein Stichwort stets von anderen geben und gibt es an andere weiter. Es gilt für beides - für die religiöse Offenbarung wie für ihre Weitergabe -, daß sie nur vom Sprachdenken her echt verstanden wird: „Der Unterschied zwischen altem und neuem Denken liegt nicht in laut und leise, sondern im Bedürfnis anderer und, was dasselbe ist, im Ernstnehmen der Zeit: Denken heißt hier (im alten Denken), für niemanden denken und zu niemandem sprechen. Sprechen aber heißt (im neuen Denken), zu jemandem sprechen und für jemanden denken, und dieser Jemand ist immer ein ganz bestimmter Jemand und hat nicht bloß Ohren wie die Allgemeinheit, sondern auch einen Mund”. Mit diesen Sätzen hat Rosenzweig im Rückblick auf den „Stern” im Jahre 1925 das neue Denken charakterisiert, das ihm mit seinen christlichen Freunden gemeinsam ist.
Für manchen Leser, der an der von Rosenzweig gegebenen Phänomenologie der theologischen Grundbegriffe weniger interessiert ist, wird die Konfrontation von Judentum und Christentum im dritten Band des Werkes das eigentlich Fesselnde sein. Rosenzweig widmet hier dem Jahreskreis der jüdischen Feste und zugleich dem christlichen Kirchenjahr eine faszinierende vergleichende Darstellung und Deutung. Israel erlebt in seinem festlichen Jahr den ewigen Tag der Erlösung in Bekenntnis und Handlung voraus und ist darin die stille Mahnerin der Kirche vor den Lockungen des Allgemein-Menschlichen. Im Erleben der Offenbarung Gottes in seiner Volksgeschichte ist das Judentum als solches - nicht der einzelne Jude! - bereits erlöst. Im Christentum kommt es demgegenüber nicht auf Volkseinheiten, sondern auf die einzelne Seele an. Deshalb lebt das Christentum nicht gleich Israel von der Offenbarung, sondern von der Erlösung, d. h. von der Gnade des ständigen Neubeginns. Der Blick in die Zukunft - auf den Tag der Wiederkunft - ist somit für den frommen Juden der Kraftquell des Glaubens, für den Christen aber lediglich ein Zielbild der Hoffnung. Erst wenn das „Feuer” des Judentums sich vereinigt mit den „Strahlen”, die von der Erscheinung Christi ausgehen, wird die Stunde der Wiederkunft geschehen. Die Abirrungen, durch die der Christ ständig versucht wird - die Spiritualisierung des Gottes-, Apotheosierung des Mensch-, Pantheisierung des Weltbegriffes, - gefährden das Judentum nicht.
„Hier nämlich erweist sichs, daß der Jude gar nicht in sein eignes Innere niedersteigen kann, ohne daß er in diesem Niedersteigen ins Innerste zugleich zum Höchsten aufstiege. Dies ist ja der tiefste Unterschied zwischen dem jüdischen und dem christlichen Menschen, daß der christliche von Haus aus oder mindestens von Geburt wegen Heide ist, der Jude aber Jude. So muß der Weg des Christen ein Weg der Selbstentäußerung sein, er muß immer von sich selber fort, sich selber aufgeben, um Christ zu werden. Des Juden Leben hingegen darf ihn gerade nicht aus seinem Selbst herausführen; er muß sich immer tiefer in sich hineinleben; je mehr er sich findet, um so mehr wendet er sich ab von dem Heidentum, das er draußen hat und nicht wie der Christ in seinem Innern, - um so mehr also wird er jüdisch” (III S. 190).
Platonismus und christliche Geschichtserfahrung
Eugen Rosenstock erkennt die hier aufgewiesene Dreigliederung alles Menschentums an; er ist gleich dem Freunde davon überzeugt, daß die Kirche ohne die Synagoge nicht leben kann. Sie würde sonst ihre „Gewalt über die Gezeiten” verlieren. Aber er hat dieser jüdischen Religiosität, welche die von Gott selbst zubereitete Einheit des Judentums als das eigentliche Sakrament versteht, seine tapfere Bejahung der von der Wortoffenbarung ausgehenden und alle Stämme, Reiche und Völker angehenden Heilsgeschichte entgegengesetzt. Die Methodik seines Denkens hat der Freund mehrfach zu charakterisieren versucht: als ein„Philosophieren in Kalenderform”, als ein „Denken in Familiengliedern”, In der vergleichenden Gegenüberstellung des jüdischen und des christlichen Jahres haben wir ein eindrückliches Zeugnis des Kalender-Philosophierens vor uns. „Nur für Juden und Christen besteht jene feste Orientierung in Raum und Zeit, besteht die wirkliche Welt und die wirkliche Geschichte”(II S. 16). Wenn Rosenzweig von einem „Denken in Familiengliedern” spricht, so deutet dieser Ausdruck auf den Grundzug des Rosenstockschen Lebenswerkes hin, der seinen soziologischen mit seinen geschichtlichen und spracherhellenden Werken gemeinsam ist. Er erklärt zugleich die bewundernde Charakterisierung Rosenstocks in einem Briefe des Freundes an Hans Ehrenberg aus dem Jahre 1918: „Er ist der monistischste Denker, den ich kenne”. Es geht hier um die volle Anerkennung der menschlichen Wirklichkeit. Man hat diese Wirklichkeit in der Vergangenheit unter dem Einfluß Platos und Descartes eingeschränkt auf die Subjekt-Objekt- Beziehung, als wenn der Mensch als beobachtende Innerlichkeit einer sich ihm zur Erkenntnis darbietenden Außenwelt gegenüberstünde. Wie aller wirklich lebendigen Gegenwartsphilosophie ist die Überwindung solchen geschichtsfremden „Platonismus” auch den Sprachdenkern selbstverständlich. Rosenstock aber hebt sich dadurch von Rosenzweig und Ebner ab, daß er die geschichtliche Wirklichkeit des Menschen als erster wahrhaft ernst nimmt. Der Mensch ist für ihn nicht nur Subjekt für sich selbst und Objekt für andere, sondern gleichzeitig „Trajekt” von der Vergangenheit her und „Präjekt” auf die Zukunft hin. Dieser vierfachen Inanspruchnahme des Menschen - dem „Kreuz der Wirklichkeit” - hat Rosenstock in dem kürzlich erschienenen ersten Band seiner „Soziologie”3 eine abschließende Darstellung gewidmet, auf die der Leser der „Zukunft” und der vor ihr in Deutschland neu erschienenen Bücher (Die europäischen Revolutionen, 2. Aufl.; Der Atem des Geistes, 1951; Heilkraft und Wahrheit, 1952; Der unbezahlbare Mensch, 1955) ein und für allemal verwiesen sein mag.
„Des Christen Zukunft” ist ein tiefgläubiges Buch und zugleich ein Dokument für das „mündige” Christentum, das Dietrich Bonhoeffer gefordert hat. Es ist in Amerika entstanden, als die kriegsbedingte deutsch-amerikanische Verfeindung die Frage nach der Zukunft der christlichen Völker besonders dringlich erscheinen ließ, hat aber in den seitdem verflossenen Jahren nichts an Bedeutung verloren. Es geht um die Zukunft des Christen, nicht im eschatologischen Sinne, sondern im Sinne des geschichtlichen Fortlebens der Christenheit auf dieser Erde. Rosenstock wagt es, die persönliche Erfahrung von Schuld und Vergebung auf die Geschichte anzuwenden. Es gibt z. Z. keinen zweiten Denker, der in ähnlicher Weise den christlichen Sinn der Geschichte - das Verständnis der Geschichte als Heilsgeschichte - bekennt und bezeugt. Dabei geht es ihm nicht um Deutung des Geschichtsprozesses, wie sie von Idealisten, Materialisten und Biologisten versucht worden ist: „Der Mensch ist nicht dazu erschaffen, die Wege der Geschichte zu kennen; ihm ist einzig erlaubt, an sie zu glauben” (S. 129). Von diesem Bekenntnis zum Sinn und göttlichen Auftrag unserer Gegenwart und unserer Zukunft her versteht sich die Mission, die einer christlich verstandenen Soziologie heute aufgetragen ist: „So wie in vorhergegangenen Jahrtausenden christlicher Geschichte sich Männer gefunden haben, die erst den Einen Gott und dann die eine Erde bezeugt haben, so müssen wir jetzt drittens Gottes Eine Zeit finden, bezeugen und für sie gegen die Privatpläne kämpfen, die sich ungeduldige Menschen für das Abstoppen aller Geschichte ausgedacht haben” (S. 47).
Für dieses Abstoppen der Geschichte sind die dualistischen Denksysteme verantwortlich, die an der eigentlichen Wirklichkeit des Menschen vorbeisehen, weil sie ihn entweder als Subjekt oder als Objekt mißverstehen. Sinnvolle Ordnung im menschlichen Zusammenleben kann nur hergestellt werden, wo man den Menschen wieder als Glied der Familie und der Geschlechterfolge ernstnimmt. Die zunehmende Individualisierung und Massierung unseres Gegenwartslebens rührt daher, daß wir die ursprüngliche Funktion von Staat und Kirche verkennen: „Während die christliche Reform die Glieder der Familie zunächst zum Mütter- und Vätersein anhielt, liegt die moderne Betonung auf Jungen und Mädchen, Männern und Frauen. Kirche und Staat dachten an uns als Eltern und Kinder; Kunst und Wissenschaft sehen in uns Individuen. Sie schulen uns für Technik und Muße, nicht für Staat und Kirche” (S. 67). Daß Staat und Kirche grundlegendere Voraussetzungen unserer menschlichen Wirklichkeit sind als Kunst und Wissenschaft wird dem deutlich, dem die Geburt der artikulierten Sprache aus Kultus und Recht einsichtig geworden ist und der da weiß, daß in dieser artikulierten Sprache das göttliche Wort durch alle Wandlungen der Geschichte vernehmbar wird. Auch die außerchristlichen Religionswelten haben ihren Anteil an dem „Gespräch”, das der Mensch von Beginn seines Menschseins an mit Gott und dem Kosmos führt. Aber die Epochen des Geschichtsprozesses, in dessen Mitte die Erscheinung Christi steht, sind besonders eindrucksvolle Zeugnisse für das jeweils neue und über alle Trübungen hinaus wirksame Sprechen Gottes mit den Menschen. Daran wird durch noch so große Wichtigtuerei anscheinend rein menschlicher Bestrebungen ebenso wenig etwas geändert wie durch das vermeintliche Versagen ganzer Zeitalter: „Unser ‚Heute’ ruht zwischen unserer Abhängigkeit von der Kirche trotz ihrer Sünden und unserer Anhänglichkeit an unsere Schwestern und Brüder trotz ihrer Unchristlichkeit. Wer also aus der individuellen Wolke seiner Privatreligion heraus will, muß zweierlei tun: er muß die Sünden der christlichen Vergangenheit auf sich nehmen; er muß hellhörig werden für die Rhythmen der nichtchristlichen Menschheit” (S. 200).
Individuum und christliche Gemeinde
Als „Vorort” und „Fabrik” bezeichnet Rosenstock die beiden Lebensräume, in deren Beziehungslosigkeit zueinander die Schizophrenie des modernen Menschen sich besonders deutlich widerspiegelt. Über sie Klarheit zu gewinnen, ist erst dann möglich, wenn man das bedenkenlose Gerede vom Menschen als einem Individuum aufgibt: „Das moderne Individuum - nach außen ein heimatloser, ruheloser, unverbindlicher Nomade, nach innen ein Kreuzworträtsel oder durcheinander geratenes Nervenbündel - ist direkt das Gegenteil der christlichen Patriarchen, an die sich das Evangelium nach 1500 richtete” (S. 74). Die hohe Auszeichnung, etwas Individuelles zu verwirklichen, kommt der Familie und der lebendigen Arbeitsgruppe eher zu als dem zwischen Vorort und Fabrik pendelnden Einzelmenschen: „Der Maßstab für Erfahren, Lehren und Lenken kann nicht der anomalen Zusammendrängung dieser Vorgänge innerhalb eines Individuums entnommen werden. Der geschichtliche Mensch wird von anderen belehrt und regiert andere; und aus diesen Beziehungen ist er gezwungen, sich selbst zu verwirklichen. ,Er’ existiert niemals, sondern ist immer zwischen zwei Zeiten, zwei Lebensaltern als Sohn und Vater, Laie und Fachmann, zwischen dem Ende eines Zeitalters und dem Anfang eines anderen” (S. 322). Deshalb bedarf es der Rückbesinnung darauf, in welchen Grundverhältnissen wir die eigentliche Wirklichkeit unseres Lebens gewinnen. Damit, daß man sich aus dem vielfach entseelenden Betrieb in die unverbindliche Sphäre des Vororts zurückzieht, ist nichts getan, denn hier herrscht eine eigentümliche Mentalität:
„Mentalität ist das, was von der Seele übrig bleibt, wenn man die kreuzigenden Erlebnisse, die in kräftigeren und lebendigeren menschlichen Beziehungen ihre Frucht tragen, ausläßt. Die Mentalität weiß nichts von Himmel-Hoch-Jauchzen und Zu-Tode-Betrübt-Sein, von Schreien und Fluchen, von Wehklagen und Stöhnen, Rufen und Tanzen und Weinen und Singen . .. Neurosen und Nervenzusammenbrüche wuchern in den Vororten, weil es an jener Gemeinsamkeit fehlt, nach der die tieferen Nöte und Leidenschaften schreien. Der Fluch des modernen Menschen ist deshalb der, immer unverbindlicher zu werden aus Angst, sich in irgendeine Sache zu weit einzulassen” (S. 38 f.).
Aus dieser unverbindlichen Mentalität vermag keinerlei Betriebs- oder Arbeitsseligkeit zu erlösen. Wir müssen neu verstehen, daß es die Familie ist, „in der der Mensch zuerst seinen Namen bekommt und der er später seinen Namen gibt. Aus diesem Erhalten und Ausgeben unseres Namens besteht der Vorgang der Beseelung” (S. 43). So wenig wir aus den Stätten unserer „Freizeit” die Probleme unseres politischen- und Arbeitslebens verdrängen können, so sehr sind wir im Bereiche des beruflichen und öffentlichen Lebens gezwungen, von allen Freuden und Leiden, allen Zwängen und Entscheidungen unseres Familienlebens abzusehen. Daher ist es notwendig, daß die Bedeutung der Arbeitsgruppe für die Reform unseres Wirtschaftslebens begriffen wird: „Männer und Frauen verschiedenster Herkunft und Beschäftigung, des Klimas und des Glaubens müssen sich gegenseitig von der unfruchtbaren Isolierung in Vorort und Fabrik befreien und werden ihre Vertretung durch politische Machtgruppen mit befreiendem Lachen abschütteln müssen” (S. 62). Aber die Bildung solcher „neuer Formen der Bruderschaft” setzt voraus, daß der Mensch sich wieder als geschichtliches Wesen begreift und erkennt, daß seine Geschichtlichkeit zutiefst in dem Worte begründet ist, das ihn durch die Verkündigung in der Gemeinde erreicht. Dabei geht es zuvorderst darum, daß seit Jesu Tod am Kreuz der Mensch berufen ist, das anscheinend ewig wiederkehrende Leben vom letzten Ende her zu verstehen:
„Der Christ hat das Ende der Welt, seiner Welt, hinter sich: Anfang und Ende haben ihre Plätze gewechselt. Der natürliche Mensch beginnt heidnisch in der Geburt und durchlebt die Zeit vorwärts zum Tode hin; der Christ lebt in der gegensätzlichen Richtung vom Ende des Lebens zu einem neuen Anfang. Im Überleben des Todes sieht er den ersten Tag derSchöpfung wieder vor sich. Er steigt aus dem Grabe seiner selbst in die Offenheit einer wirklichen Zukunft. … In der Blüte der großen heidnischen Kulturen hatte der Mensch sich als ein Meister hervorragender schöpferischer Anfänge erwiesen; durch das Christentum aber wurde er Meister des schöpferischen Endes, der Begrenzung seiner selbst und aller seiner Unternehmungen. Fähig, nun beides, Ja und Nein, zu sagen, teils zu sterben und teils zu überleben, ist er vollständig und tritt ein in die volle Freiheit der Kinder Gottes” (S. 108 f.).
Von der vergleichenden Lektüre beider Bücher bleibt eine bedrängende Frage zurück. Obwohl er das Judentum mit ungeheurem Ernst ergriffen hat, vermag Franz Rosenzweig, „über” Religion zu philosophieren, während der vom Evangelium übermächtigte Eugen Rosenstock christliche Heilsgeschichte verkündigt. Der Grund für diese auffällige Tatsache ist kein anderer, als daß der eine die Menschwerdung Gottes in Christus leugnet und der andere in ihr das entscheidende Ereignis der menschlichen Geschichte erblickt. Sollte es da nicht an der Zeit sein, sich nicht nur über das Verhältnis von Judentum und Christentum, sondern auch über die Unterschiedlichkeit von christlichem Sprachdenken und bloßem Philosophieren gewissenhafte Gedanken zu machen?
-
Franz Rosenzweig, Der Stern der Erlösung. 3. Auflage. Verlag Lambert Schneider, Heidelberg 1954, 3 Teile, zus. 589 S., Ln, 19,80 DM. - Eugen Rosenstock-Huessy, Des Christen Zukunft oder Wir überholen die Moderne. Neubearbeitung der amerikanischen Ausgabe. Chr. Kaiser Verlag, München 1955, 352 S., Ln. 15,-DM. ↩
-
Es ist bezeichnend für die geistige Situation, daß auch dieses Werk im Jahre 1952 neu aufgelegt wurde; vergl. die Besprechung in Zw./DNF. 1955/10, S. 719. ↩
-
Eugen Rosenstock-Huessy, Soziologie Bd.I: Die Übermacht der Räume. Kohlhammer-Verlag, Stuttgart 1956, 335 S., Ln. 23,- DM. ↩